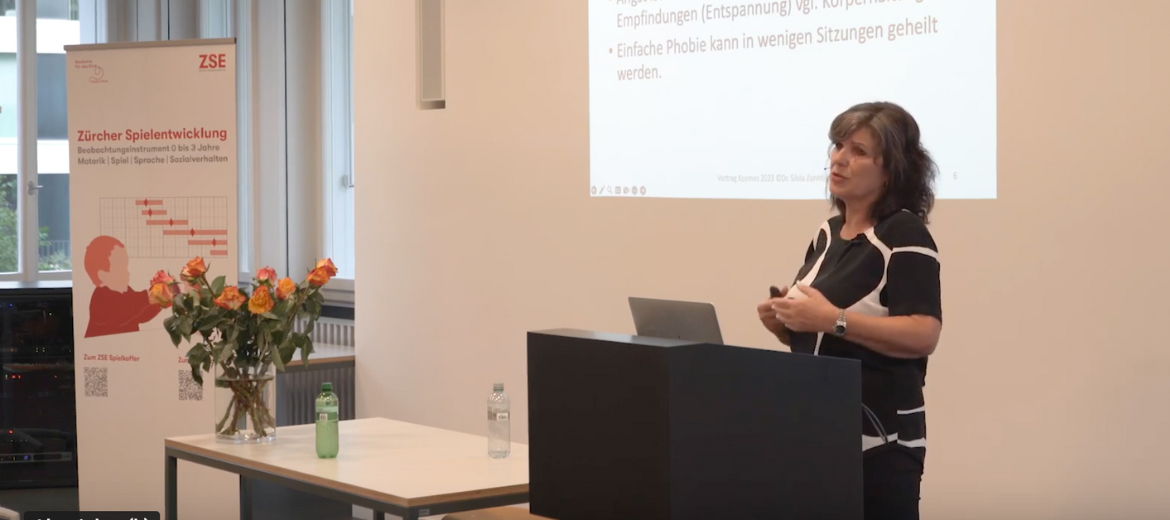Wie wird mein Kind mutig?

Mut zeigt sich auf verschiedene Weise: beim Sprung vom Fünf-Meter-Turm oder beim Verteidigen eines Freundes im Streit. Was hilft einem Kind, mutig zu werden? Und wie können Eltern es unterstützen?
Es war das erste Elterngespräch, das mein Mann und ich im Kindergarten hatten. Unsere Tochter besuchte seit einem halben Jahr die Tigergruppe und fühlte sich dort wohl. Sie sei gut angekommen, verstehe sich mit den anderen Kindern, sei neugierig und offen, berichtete die Erzieherin. Alles schien gut zu laufen. Doch zum Schluss fiel der Satz, der mich aufhorchen liess: «Was ihr allerdings schwerfällt, ist, für sich einzustehen. Sie lässt sich schnell etwas wegnehmen, traut sich nicht zu sagen, was sie will oder was nicht», sagte sie. «Es wäre schön, wenn sie ein bisschen mutiger wird.»
Mutiger werden? Sofort sprang in mir die Erinnerung an meine Kindergartenzeit an. Ich war ein sehr schüchternes Kind und das Gegenteil von mutig. Lief meine Tochter nun auch Gefahr, ein unsicheres Kind zu werden? «Wir müssen es schaffen, dass sie sich mehr traut», sagte ich zu meinem Mann auf dem Heimweg.
Aber wie geht das? Wie kann man seinem Kind dabei helfen, seine Ängste zu überwinden und Mut zu entwickeln? Woran liegt es, dass manche Kinder scheinbar mutiger sind als andere? Und was ist Mut überhaupt?
Der Entwicklungspsychologe Moritz Daum von der Universität Zürich formuliert es so: «Mut entsteht in einer Situation, die man als gefährlich oder unsicher einschätzt. Das Gefühl der Angst, des Unwohlseins kommt auf. Mut führt dazu, dass man dieses Gefühl überwindet und sein Ziel, das man in dieser Situation hat, trotz der Angst erreicht.»
Oder wie es die deutsche Liedermacherin Sarah Lesch in einem ihrer Songs formuliert: «Mut heisst nicht, keine Angst zu haben. Mut heisst, dass man trotzdem springt.»
Mut hat viele Dimensionen
Was italienische Kinder als mutig empfinden, haben die Psychologinnen Sara Santilli und Maria Cristina Ginevra von der Universität Padua gemeinsam mit ihren Kollegen in einer 2020 erschienenen Studie erläutert. Dabei wurden 592 Mädchen und Buben zwischen acht und zehn Jahren gefragt, was ihr bisher mutigstes Erlebnis war. Die meisten – rund ein Drittel – beschrieben eine körperliche Handlung als etwas, das ihnen viel Mut abverlangt hat, wie etwa einen Hund aus einer Dornenhecke zu befreien.
Moritz Daum überrascht das nicht. «Gerade in dieser Altersspanne verbindet man Mut oft mit physischen Aktivitäten», sagt der Entwicklungspsychologe. Es gebe aber auch psychologischen, emotionalen oder sozialen Mut. «Psychologischer Mut kann sich beispielsweise zeigen, wenn man Durchhaltevermögen hat. Emotionaler Mut, wenn man fähig ist, seine Gefühle auszusprechen, und sozialer Mut, wenn man für sich oder andere einsteht. Das ist dann die sogenannte Zivilcourage.»
Nicht jede Dimension von Mut ist bei einem Menschen gleich stark ausgeprägt.
Den Kindern der italienischen Studie war durchaus bewusst, dass es auch andere Arten von Mut gibt. Neben dem körperlichen Mut beschrieben sie nämlich auch Situationen, in denen sie im moralischen oder psychologischen Kontext mutig waren.
Moralisch, weil man zum Beispiel einem Mitschüler half, der verprügelt wurde, und psychologisch, weil man sich traute, vor einem grossen Publikum zu singen. Was bei den Ergebnissen besonders interessant ist, ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Mädchen berichteten mehr von körperlichem Mut, Buben hingegen von psychologischem.
Dass Mut viele Dimensionen haben kann und von Kindern unterschiedlich empfunden wird, weiss auch die deutsche Pädagogin und Buchautorin Susanne Mierau. «Für manche Kinder ist es schon mutig, der Tante, die sie kaum kennen, die Hand zu geben oder Nein zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen. Anderen wiederum fällt das gar nicht schwer.»
Einige Kinder sind ängstlich, manche risikofreudig
Und: Nicht jede Dimension von Mut ist bei einem Menschen gleich stark ausgeprägt. So kann ein Kind im Schwimmunterricht vom Drei-Meter-Turm aus Furcht vor dem Sprung wieder runterklettern, aber sich wenig später für seinen Freund einsetzen, der in der Umkleidekabine gehänselt wird.
Dass manche Kinder mutiger sind als andere, hat verschiedene Gründe. Wenn ein Baby geboren wird, kommt es mit individuellen Persönlichkeitsmerkmalen zur Welt. «Bereits bei Kleinkindern kann man beobachten, dass die einen eher ängstlich und die anderen eher risikofreudig sind», so Daum. «Und Risikofreude hängt eng mit dem Aufbringen von Mut zusammen.»

Ein Persönlichkeitsmerkmal, das in Bezug auf Mut auch eine wichtige Rolle spielt, ist die Extraversion. Das zeigt eine Studie, die der Psychologe Peter Muris mit Kolleginnen und Kollegen 2009 veröffentlicht hat. Extravertierte Kinder sind aktiver, geselliger und enthusiastischer, haben ein grösseres Selbstvertrauen und sehen Angstsituationen oft als Herausforderung, stellten die Forschenden von der Universität Rotterdam fest. Die genetisch bedingte Persönlichkeit sei dann wie eine «Baseline» oder eine Grundvoraussetzung, die im Laufe des Lebens mit vielen verschiedenen Erfahrungen sowie Wissen über sich selbst und über seine Kompetenzen angereichert werde.
Eine gute Bindung fördert Mut
Das eine ist also die Anlage, das genetische Potenzial, das andere die Umwelt. Das Zusammenspiel der beiden Komponenten ist verantwortlich für die Entwicklung von Mut.
In den ersten Lebensjahren steht die Bindung zu den engsten Bezugspersonen im Mittelpunkt der kindlichen Entwicklung. Sie spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, mutig zu werden, also zu lernen, seine Angst zu überwinden, für sich einzustehen oder sich neuen Situationen zu stellen. «Fühlt sich ein Kind sicher gebunden, weiss es, dass auf seine Bedürfnisse angemessen reagiert wird, es geschützt und beschützt ist, entwickelt es grosses Vertrauen in sich und seine Umwelt», sagt Daum. «Das ist wertvolles Futter für das Wachsen von Mut.»
Einem Kind mit guter Bindung falle es auch leichter, seine Emotionen zu regulieren. Gefühle werden ernst genommen, benannt und dürfen da sein. Das unterstütze ein Kind dabei, mutiger zu sein, meint Daum. «Denn Mut ist ja nichts anderes, als zu lernen, mit dem Gefühl der Angst umzugehen.»
Der Umkehrschluss – ängstliche Kinder sind zwangsläufig unsicher gebunden – funktioniere aber nicht. «Manche Kinder haben einfach einen sehr ängstlichen Charakter, und selbst wenn sie viel Zuwendung und Schutz erfahren, ändert das nichts an ihrer Persönlichkeit.» Zudem könne es auch sein, dass ein Kind ängstliche Eltern hat, die ihre Ängste wiederum auf das Kind übertragen.
Habe ich ein gutes Bewusstsein für Gefahren, kann ich diese auch leichter überwinden und somit mutig sein.
Susanne Mierau, Pädagogin
Susanne Mierau findet, dass Angst in unserer Gesellschaft oft negativ besetzt ist. «Dabei ist es ein wichtiges Gefühl, das uns zeigt, in einer gewissen Situation achtsam oder vorsichtig zu sein», sagt die Pädagogin. Vielleicht hat man Angst, weil man sich verletzen könnte, oder man ist verängstigt, weil man noch nie ohne Eltern einen Freund besucht hat. «Das zu spüren, ist gut. Die Aufgabe der Eltern ist es wiederum, solche Gefühle zu spiegeln, also in Worte zu fassen und nicht aus dem Alltag zu verbannen.»
Dadurch lernen Kinder zunächst einmal, ihre Angst oder eine Gefahr zu erkennen. Mit der Zeit können sie diese dann immer besser einschätzen.
«Je mehr Erfahrungen Kinder diesbezüglich machen können, umso schneller erlangen sie eine sogenannte Risikokompetenz», sagt die Pädagogin. «Diese ist wichtig, um Mut zu entwickeln. Habe ich ein gutes Bewusstsein für Gefahren, kann ich diese auch leichter überwinden und somit mutig sein.»
Eltern sind bedeutsame Vorbilder im Umgang mit Angst
Kinder lernen am Modell. Wie Eltern mit Gefühlen wie Wut, Trauer oder Angst umgehen, ist daher essenziell. «Wir dürfen unseren Kindern ruhig sagen, wenn wir selbst Angst haben, oder ihnen erzählen, in welchen Situationen wir als Kinder ängstlich waren», sagt Mierau. «Das hilft ihnen ungemein.» Im besten Fall thematisiert man die Angst nicht nur, sondern zeigt seinem Kind auch, wie man sie bewältigt: «Die Hängebrücke ist ganz schön wacklig, das macht mir Angst. Aber ich werde jetzt mal ein paar Schritte wagen und sehen, wie es sich anfühlt.»
Überwindet ein Kind seine Angst und macht die Erfahrung, es geschafft zu haben, dann fühlt es sich selbstwirksam, hat also das Gefühl, mit seinem Handeln etwas bewirken zu können. So entsteht Selbstbewusstsein. «Das Kind lernt, dass die Situation gar nicht so schlimm war, wie es sie sich vorgestellt hat, und beim nächsten Mal kann es auf diese Erfahrung zurückgreifen und weiss, dass es imstande ist, die Angst zu bewältigen», sagt Entwicklungspsychologe Daum. Zudem sollte Eltern bewusst sein, dass es oft viele kleine Schritte benötigt, um seine Angst zu überwinden.

Besonders herausfordernd mag das für Eltern sein, die risikofreudig und wagemutig sind, aber Kinder haben, die sich nicht so viel trauen. Dann sei es besonders wichtig, nicht zu viel zu verlangen.
Die Pädagogin Susanne Mierau sieht das ähnlich: «Eltern dürfen nicht zu viel erwarten oder das Kind zu sehr pushen und sollten ein gutes Gespür für die Ängste des Kindes entwickeln. Gleichzeitig sollten sie aber auch lernen, nicht zu behutsam zu sein und das Kind aus seiner Komfortzone herauszulocken. Das ist manchmal eine schwierige Gratwanderung.»
Eltern sind demnach nicht nur wichtig, wenn es um einen gesunden Umgang mit Angst geht, sondern sollten ihre Kinder auch ermutigen, sich Herausforderungen zu stellen.
Kinder brauchen Gelegenheiten, um Mut zu üben
Werden Kinder älter, fällt es ihnen zunehmend leichter, Ängste zu überwinden. Das hat dem Entwicklungspsychologen Daum zufolge mit der Gehirnleistung zu tun. «Denn die Regulation von Emotionen hängt sehr stark mit der Entwicklung zweier Bereiche im Gehirn zusammen», sagt er. «Dem präfrontalen Cortex, also der Region, die unser Verhalten steuert, und der Amygdala, wo Situationen emotional bewertet und Gefahren analysiert werden.»
Je weiter diese Bereiche ausgereift seien, umso leichter falle es einem Kind, Mut zu entwickeln. Aber auch wenn Kinder mit der Zeit von alleine mutiger werden, brauchen sie dennoch Gelegenheiten, um Mut zu üben. «Wenn Kinder nicht die Möglichkeit haben, sich in Situationen zu begeben, in denen sie eine gewisse Unsicherheit erfahren, wo soll dann das Gefühl der Selbstwirksamkeit herkommen?»
Kinder haben einen grossen Wunsch nach Autonomie Diesen darf man nicht unterdrücken.
Mit anderen Worten: Wir Eltern müssen ein Rahmengerüst schaffen, in dem sich Kinder frei bewegen können, um sich an Angstsituationen heranzutasten. Nur so können sie eine angemessene Risikokompetenz entwickeln.
Susanne Mierau findet es problematisch, dass Kinder immer weniger Freiräume haben. Früher seien Buben und Mädchen oft stundenlang draussen in Gruppen unterwegs gewesen, heute sei das nur noch selten der Fall, meint sie. Dabei hätten Kinder einen grossen Wunsch nach Autonomie, den man nicht unterdrücken dürfe. «Doch der Drang, sich freier zu bewegen, gerade wenn Kinder älter werden, macht vielen Eltern Angst, denn man ‹weiss› ja, was alles schiefgehen kann», sagt Mierau.
Aber stimmt das wirklich? Ist unsere Welt gefährlich für Kinder?
Tatsächlich war das Leben hierzulande noch nie so sicher wie jetzt, gerade für Kinder. Die medizinische Versorgung zählt zu den besten der Welt. Und tödliche Verkehrsunfälle bei Kindern nehmen seit Jahren ab. Das zeigen die Daten der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. 1980 wurden 1670 Kinder im Alter bis 14 Jahre schwer verletzt, davon 78 getötet, 2021 noch 184, davon zwei tödlich.
Die Sicherheit ist also hoch. Trotzdem spielen Kinder heute weniger unbeobachtet draussen als früher. Eine 2016 veröffentlichte Studie im Auftrag von Pro Juventute zeigt, dass Schweizer Kinder aus deutschsprachigen Gebieten im Durchschnitt gerade einmal 32 Minuten ohne Aufsicht draussen spielen, in der Romandie sogar nur rund 20 Minuten. Die Kinder waren zwischen fünf und neun Jahre alt. Je älter sie waren, umso länger spielten sie unbeaufsichtigt.
Die Überfürsorge mancher Eltern ist ein grosses Problem
Expertinnen wie Margrit Stamm kritisieren die Tendenz, die Freizeit der Kinder mehr und mehr zu verplanen und zu begleiten. «Heute gibt es viel mehr überfürsorgliche Eltern als noch vor 20 oder 30 Jahren», sagt die emeritierte Professorin für Pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Freiburg. Allerdings beobachte man dies vor allem im gebildeten Mittelstand. Die übermässige Fürsorge äussere sich darin, dass die Eltern sich konstant ums Kind bemühen und möglichst alle Bedürfnisse und Wünsche erfüllen. Ausserdem hätten sie oft Angst um ihr Kind, wollten es stets kontrollieren und ihm jegliche Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, so Stamm.
Eltern würden ihren Kindern mit diesem Verhalten signalisieren: «Ich traue dir nicht zu, deine Konflikte selbst zu lösen, ich traue dir nicht zu, dass du es alleine schaffst.» Dabei wäre genau das Gefühl des Zutrauens der Schlüssel. «Wenn Kinder spüren, dass Eltern ihnen etwas zutrauen, dann können sie Selbstvertrauen entwickeln», sagt Stamm. «Und das ist die Grundlage, um mutig zu werden.»
Kinder spüren, wenn ihre Eltern Angst haben, und diese kann sich schnell auf sie übertragen.
Margrit Stamm, Erziehungswissenschaftlerin
Die Erziehungswissenschaftlerin betont jedoch, dass sie den Eltern für das Verhalten nicht die Schuld geben wolle. Überbehütung sei ein strukturelles Problem. «Wir leben heute in einer Sicherheitsgesellschaft. Überall lauert scheinbar Gefahr. Wie soll man als Mutter beziehungsweise Vater dann das Vertrauen finden, das alles gut geht?»
Sich dessen bewusst zu sein, wäre schon ein wichtiger erster Schritt. Und immer wieder reflektieren: Ist das wirklich gefährlich? Kann ich das meinem Kind zutrauen? Kann ich mich erst einmal zurückhalten, um ihm die Chance zu geben, eine Herausforderung selbst zu meistern?
Als Mutter mit der eigenen Angst konfrontiert
Kinder seien enorme Seismografen. «Sie spüren, wenn ihre Eltern Angst haben, und diese kann sich schnell auf sie übertragen», sagt Stamm. Daher würde es sich sehr lohnen, wenn auch Eltern versuchten, ihre Ängste in den Griff zu bekommen und eine Vertrauenskultur in der Familie zu etablieren.

Ich wurde mit meiner Angst konfrontiert, als meine Tochter einen Ferienkurs besuchen sollte. Mittlerweile war sie in der Schule und wir hatten einen einwöchigen Zirkuskurs gebucht, den sie zusammen mit ihrer Freundin machen wollte. Einen Tag vor Kursbeginn wurde ihre Freundin krank, sie musste also alleine starten. «Das mache ich auf keinen Fall», schimpfte sie. Ich war kurz davor, zu sagen: «Musst du auch nicht, dann warten wir eben, bis deine Freundin wieder gesund ist», da antwortete mein Mann: «Natürlich gehst du dahin, das wird bestimmt toll.»
Entwickeln Kinder eine gute Risikokompetenz, hilft ihnen das als Teenager, Gefahren realistischer einzuschätzen.
Moritz Daum, Entwicklungspsychologe
Ich biss mir auf die Zunge und beschloss, mich rauszuhalten. Bis zum nächsten Morgen sagte sie noch viele Male, dass sie dort nicht hingehen werde, doch mein Mann liess sich nicht abbringen. Er begleitete sie zum Kurs, motivierte sie und sie blieb dort. Als ich sie abholte, kam mir ein strahlendes Kind entgegen, das nicht mitkommen wollte.
«Die Geschichte zeigt, wie wichtig unterschiedliche Bezugspersonen für Kinder sind», erklärt Pädagogin Mierau. «Ein Elternteil ist vielleicht ängstlicher, nimmt das Kind schneller in Schutz und der andere fordert es mehr. Für die Entwicklung ist es gut, wenn dem Kind verschiedene Verhaltensrepertoires zur Verfügung stehen.» Für Kinder, die in Einelternfamilien aufwachsen, kann dies ein Onkel, eine Lehrerin oder ein Freund der Familie sein.
In der Pubertät kann es passieren, dass Jugendliche nicht mehr zu wenig, sondern zu viel Mut zeigen. «Insbesondere Buben im Jugendalter neigen zu Übermut», sagt Moritz Daum. «Die eigenen Kompetenzen werden überschätzt und bestimmte Situationen nicht realistisch eingeschätzt.»
Das habe auch mit den unterschiedlichen Entwicklungstempi von Mädchen und Jungen in diesem Alter zu tun. Die kognitive Kontrolle sowie die Emotionsregulation seien noch nicht so ausgereift, was wiederum zu riskantem Verhalten führen könne. «Sind dann noch Freunde dabei, kann es sich schnell hochschaukeln», weiss Daum. Eltern können daran nicht viel ändern. «Aber auch hier kann man sagen: Wenn Kinder eine gute Risikokompetenz entwickelt haben, hilft ihnen das als Teenager sehr, Gefahren realistischer einzuschätzen», sagt der Entwicklungspsychologe.

Je älter die Jugendlichen werden, umso wichtiger werden die sogenannten Lebenskompetenzen, die sie im Laufe der Zeit erlernt haben. Für die Entstehung von Mut sind ein gutes Selbstvertrauen, Risikokompetenz sowie eine angemessene Emotionsregulation essenziell. «Irgendwann werden diese Kinder flügge und müssen alleine klarkommen», sagt Margrit Stamm. «Sie werden sehr davon profitieren, wenn sie die Chance bekommen haben, sich vielen Herausforderungen zu stellen, und dadurch immer wieder erfahren haben: Ich kann das.»
Meine Tochter ist mittlerweile in der zweiten Klasse. Erst vor Kurzem hat sie im Schulhof einen Streit zwischen zwei Mitschülern geschlichtet. Ihre Lehrerin erzählte mir beim Elternabend davon. Da wurde mir klar: Sie ist ein selbstbewusstes und mutiges Mädchen geworden.