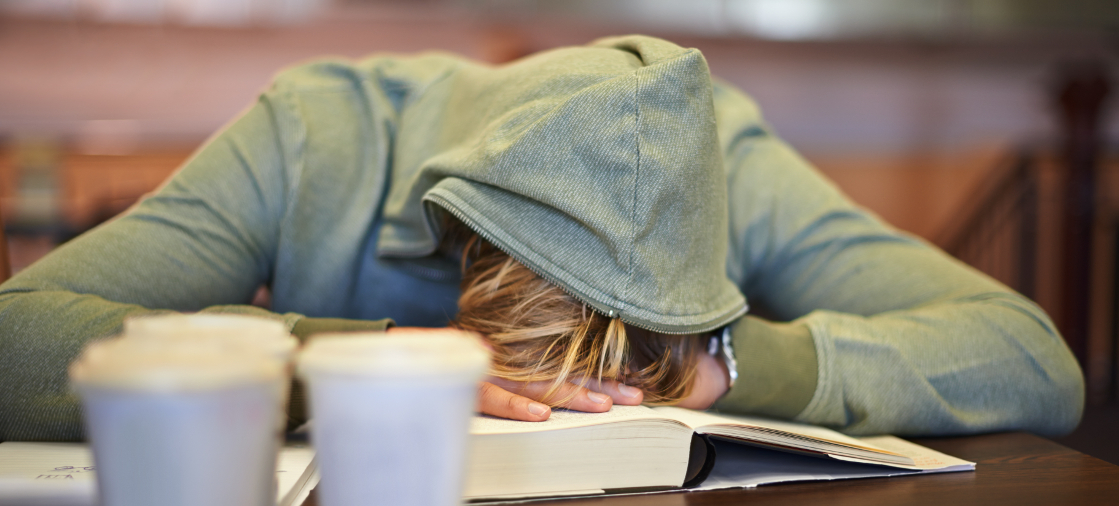Schlafstörungen bei Teenagern

Bei Kindern und Jugendlichen kommen Schlafstörungen häufig vor – in unterschiedlicher Ausprägung. Wann sollten Eltern auf jeden Fall fachliche Unterstützung suchen? Und was können sie und ihr Kind für einen erholsamen Schlaf tun?
Der 13-jährige Lars hat seit Jahren Einschlafprobleme: Abends liegt er ein bis zwei Stunden wach, bevor er endlich schlafen kann. Dabei beschäftigen ihn oft Sorgen und Ängste – zum einen vor der Schule, aber immer öfter auch die Angst, nicht schlafen zu können. Seine Eltern machen sich Sorgen, dass sich sein Schlafdefizit negativ auf die Schulleistungen auswirken könnte.
Schlafstörungen sind bei Jugendlichen keine Seltenheit – und haben in den letzten Jahren zugenommen: Laut einem Bericht des Deutschen Ärzteblatts hat sich der Anteil der 15- bis 19-Jährigen, die unter einer nicht organischen Schlafstörung leiden, von 2006 bis 2016 mehr als verdoppelt.
Insgesamt leiden etwa 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen irgendwann in ihrer Entwicklung an einer Schlafstörung. Das kann sich deutlich auf ihren Alltag auswirken: Die Teenager sind tagsüber müde und unkonzentriert, haben schlechte Laune und sind in der Schule weniger leistungsfähig.
Typisch für eine Schlafstörung ist, dass der Schlaf in irgendeiner Form beeinträchtigt ist, was oft zu Müdigkeit oder Schläfrigkeit am Tag führt. Doch im Einzelfall ist es gar nicht so einfach, zu erkennen, welche Schlafstörung vorliegt und was die genauen Ursachen sind. Wie schwer die Schlafstörung ausgeprägt ist und wie stark sie sich auf den Alltag auswirkt, kann ebenfalls sehr unterschiedlich sein.
«Wenn das Kind oder der Jugendliche tagsüber sehr müde ist oder dazu neigt, einzuschlafen, oder wenn es wegen der Schlafprobleme zu Stimmungsschwankungen, Konzentrationsproblemen oder deutlich verschlechterten Schulleistungen kommt, sollte man dies ärztlich abklären lassen», sagt Martina Hug, Oberärztin am Fachbereich Entwicklungspädiatrie des Universitäts-Kinderspitals Zürich. «Das Gleiche gilt, wenn im Schlaf auffälliges Verhalten auftritt, etwa Atemaussetzer oder ungewöhnliche, rhythmische Bewegungen. Aber auch dann, wenn die Eltern eine Beobachtung nicht einordnen können und darüber beunruhigt sind, sollten sie sich nicht scheuen, fachliche Unterstützung zu suchen.»
Schlafstörungen: Zuerst zum Kinderarzt
Erster Ansprechpartner ist in den meisten Fällen der Kinderarzt. «Er kann prüfen, ob hinter den Schlafproblemen eine körperliche Ursache steckt, wie etwa häufiges Husten bei Asthma oder Schmerzen», erläutert Alexandre Datta, leitender Arzt und stellvertretender Abteilungsleiter der Neuro- und Entwicklungspädiatrie und Co-Leiter des Zentrums für Schlafmedizin der Basler Universitätskliniken. «Auch Müdigkeit am Tag kann vielfältige Ursachen haben, die nicht unbedingt mit dem Schlaf zusammenhängen müssen, etwa Eisenmangel oder psychische Ursachen wie eine Depression.» Der Kinderarzt wird daher sorgfältig nach den Ursachen fahnden.
Dabei ist es wichtig, Müdigkeit von Schläfrigkeit, also der Tendenz, einzuschlafen, abzugrenzen. «Anhand der Symptome kann er einschätzen, welche Art der Schlafstörung vorliegt», sagt Datta. «Dementsprechend kann er die Eltern beraten und selbst erste Behandlungsmassnahmen einleiten – oder das Kind, wenn notwendig, an einen Facharzt oder an eine Schlafambulanz überweisen.»
Abends wach und tagsüber müde
Insgesamt lassen sich sechs Kategorien von Schlafstörungen unterscheiden. Die weitaus häufigsten Schlafprobleme bei Kindern und Jugendlichen sind Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen und Müdigkeit am Tag. Man spricht hier auch von einer Insomnie. «Neben Kleinkindern sind besonders häufig Jugendliche ab 11 bis 12 Jahren betroffen», berichtet Datta.
«Zum einen nimmt in diesem Alter der Schlafdruck ab, sodass das Einschlafen abends schwerer fällt. Zum anderen verschiebt sich der Schlafrhythmus aus hormonellen Gründen nach hinten: Die Jugendlichen gehen später ins Bett und schlafen morgens länger – und wenn sie, etwa wegen der Schule, früh aufstehen müssen, führt das häufig zu einem chronischen Schlafdefizit.»
Die Nutzung von Smartphones oder Tablets kurz vor dem Schlafengehen beeinflusst den Schlaf ungünstig.
So wie beim 16-jährigen Marco: Er feiert mit seinen Freunden gern bis spät in die Nacht Partys, an denen es neben Alkohol auch Energydrinks gibt. Unter der Woche spielt er bis spätabends Computerspiele. Häufig kann er bis in die frühen Morgenstunden nicht einschlafen, ist tagsüber sehr müde und kommt morgens teilweise gar nicht mehr aus dem Bett. Die Vorstellung, die Schule ohne Abschluss zu beenden, macht ihm grosse Sorgen.
Oft spielen bei den Ein- und Durchschlafproblemen auch psychische Belastungen eine Rolle, die mit Problemen in der Schule, mit Konflikten mit den Eltern oder mit Gleichaltrigen zusammenhängen: etwa Ängste, Leistungsdruck, Traurigkeit oder Ärger. Manchmal stehen die Schlafprobleme auch mit einer Depression in Verbindung. «Laut Studien haben bis zu 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen mit Depressionen einen gestörten Schlaf», berichtet Hug. «Sie können abends schwer einschlafen, sind nachts öfters wach und wachen häufig morgens zu früh auf.» Umgekehrt kann aber auch Schlafmangel zu depressiven Symptomen wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit oder Stimmungsschwankungen beitragen.
Schliesslich kann sich die Nutzung von Smartphones oder Tablets kurz vor dem Schlafengehen ungünstig auf den Schlaf auswirken. «Das blaue Licht der Bildschirme, aber auch die erhöhte Erregung durch die Nutzung sozialer Medien hemmen die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin, das für einen geregelten Schlaf-Wach-Rhythmus wichtig ist», erläutert Datta. Wichtig ist daher, zunächst die Ursachen der Schlafprobleme herauszufinden. «In unserer Schlafsprechstunde fragen wir sorgfältig nach den Faktoren, die zu Schlafproblemen führen können», sagt Hug. «Ausserdem sollen die Jugendlichen 14 Tage lang ein Schlaftagebuch führen, mit dem wir ihren tatsächlichen Schlafbedarf und Besonderheiten des Schlafes erfassen können.»
Anschliessend werden die Eltern und auch das Kind beziehungsweise der Jugendliche beraten, was sie tun können, um die Schlafprobleme in den Griff zu bekommen. «Dabei erhalten sie zunächst wichtige Informationen über den Schlaf, etwa, wie viel Schlaf ein Kind in welchem Alter braucht und worauf es für einen guten Schlaf ankommt», berichtet Hug.
Mit Selbstvertrauen gegen Schlafstörungen
Wichtig sind zum einen Massnahmen der Schlafhygiene. Sie sollen dazu beitragen, das Schlafverhalten und den Schlaf zu verbessern. «Für eine erfolgreiche Behandlung ist die Mitarbeit des Kindes beziehungsweise Jugendlichen grundlegend», sagt Hug. «Wir betonen daher besonders bei den Jugendlichen, dass sie direkten Einfluss auf ihr eigenes Leben nehmen können und sich durch die Veränderungen tagsüber wieder fitter fühlen und bessere Schulleistungen erzielen können.»
Hängen die Schlafprobleme mit psychischen Belastungen zusammen, ist es wichtig, das Selbstvertrauen des Kindes zu stärken und ihm Ängste zu nehmen. «Bei stärkeren psychischen Problemen oder einer psychischen Erkrankung, etwa einer Depression, ist neben den schlafhygienischen Massnahmen unbedingt eine Begleitung und Therapie durch einen Kinder- und Jugendpsychiater notwendig», sagt Hug.
Fällt den Eltern auf, dass ihr Kind auch ohne einen Infekt häufig schnarcht oder im Schlaf kurzzeitig aufhört zu atmen, sollten sie dies mit dem Kinderarzt besprechen.
Ist der Schlaf-Wach-Rhythmus gestört, können neben Massnahmen der Schlafhygiene auch das Schlafhormon Melatonin oder eine Lichttherapie eingesetzt werden, um die innere Uhr günstig zu beeinflussen. In manchen Fällen steckt hinter der Schläfrigkeit am Tag jedoch auch eine körperliche Ursache. «Dazu gehören Atmungsstörungen und Bewegungsstörungen im Schlaf, die in jedem Alter auftreten können», erläutert Datta. «Sie sollten auf jeden Fall von einem Facharzt und wenn notwendig durch eine Untersuchung im Schlaflabor abgeklärt werden.»
Fällt den Eltern auf, dass ihr Kind auch ohne einen Infekt häufig schnarcht oder im Schlaf kurzzeitig aufhört zu atmen, sollten sie dies rasch mit dem Kinderarzt besprechen. Denn durch die Atemprobleme, die man auch als Schlafapnoe bezeichnet, nimmt kurzfristig der Sauerstoffgehalt im Blut ab. Ausserdem führen sie immer wieder zu kurzzeitigem Erwachen. Die Folge: Die Kids sind tagsüber müde und weniger leistungsfähig.
Unangenehmes Kribbeln in den Beinen
«Die häufigste Ursache bei Kindern sind vergrösserte Mandeln oder andere anatomische Besonderheiten», sagt Datta. «Dies sollte von einem HNO-Arzt und wenn notwendig im Schlaflabor sorgfältig abgeklärt werden.» In gewissen Fällen ist dann bereits in einem sehr jungen Alter eine Operation notwendig. «Diese führt oft zu deutlichen Verbesserungen», erläutert der Schlafmediziner. «Die Kinder können besser atmen, schlafen besser, sind tagsüber fitter und haben oft auch mehr Appetit.»
Auch periodische Beinbewegungen im Schlaf und das Restless-Legs-Syndrom, bei dem die Betroffenen in Ruhe ein unangenehmes Kribbeln in den Beinen spüren, können den Schlaf deutlich stören und zu Müdigkeit oder auch Hyperaktivität am Tag führen. «Eine häufige Ursache bei Kindern ist ein Eisenmangel, der gut behandelt werden kann», sagt Datta.
Schläfrig am Tag: Narkolepsie
Schliesslich kommt es vor, dass ein Kind oder Jugendlicher tagsüber nicht nur müde ist, sondern sich schläfrig fühlt und immer wieder einschläft – und das, obwohl kein Schlafmangel besteht. In diesem Fall spricht man von einer Hypersomnie. «Hier muss man nach den genauen Ursachen suchen, was meist durch eine Untersuchung im Schlaflabor geschieht», sagt Datta.
Die bekannteste Form der Hypersomnie – die aber nur etwa 40 von 100’000 Menschen betrifft – ist die Narkolepsie. Die Betroffenen schlafen bei alltäglichen Aktivitäten, etwa beim Essen oder Sprechen, plötzlich ein. Starke Gefühle, etwa beim Lachen oder bei Aufregung, führen zu sogenannten Kataplexien – einem vorübergehenden Erschlaffen der Muskeln. Beim Einschlafen und Aufwachen können zudem visuelle Halluzination und Schlaflähmungen auftreten – das heisst, die Betroffenen sind in diesem Moment unfähig, sich zu bewegen. «Meist sind die Symptome erst in der Jugend voll ausgeprägt», erläutert Datta. «Bei Kindern sind sie dagegen oft noch untypisch: Sie sind häufig nicht schläfrig, sondern eher unruhig und hyperaktiv. Dadurch wird die Erkrankung in diesem Alter oft noch nicht erkannt.»
- Ein- und Durchschlafstörungen (Insomnien): Die Kinder und Jugendlichen können abends schwer einschlafen und wachen nachts öfters auf. Insomnien betreffen häufig Kleinkinder bis 3 Jahre und Jugendliche ab 11 bis 12 Jahren.
- Hypersomnien: Die Betroffenen haben ein erhöhtes Schlafbedürfnis, das zu Müdigkeit und Schläfrigkeit am Tag führt. Dieses ist nicht auf eine andere Schlafstörung oder ein Schlafdefizit zurückzuführen. Die häufigste Hypersomnie ist die Narkolepsie.
- Parasomnien: Hier treten Verhaltensauffälligkeiten aus dem Tiefschlaf heraus auf. Die häufigste Parasomnie bei Kleinkindern ist der Nachtschreck. Dieser wird später, ab etwa 6 Jahren, oft durch Schlafwandeln abgelöst. Alpträume sind Parasomnien, die aus dem Traumschlaf heraus auftreten und in jedem Alter vorkommen können. Seltener treten Bewegungen im Schlaf auf, die von einer Epilepsie abgegrenzt werden müssen.
- Zirkadiane Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen (Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus): Hier ist der normale Schlaf-Wach-Rhythmus ungenügend vorhanden oder verschoben. Dies ist häufig bei Babys und Kleinkindern der Fall, bei denen sich der Schlafrhythmus erst ausbilden muss, zum andern bei Jugendlichen ab 11 bis 12 Jahren, bei denen sich der Tag-Nacht-Rhythmus nach hinten verschiebt.
- Schlafbezogene Atmungsstörungen: Dazu gehört die obstruktive Schlafapnoe mit Atemaussetzern im Schlaf. Atmungsstörungen können in jedem Alter auftreten. Bei Kindern sind oft vergrösserte Mandeln die Ursache.
- Schlafbezogene Bewegungsstörungen: Dazu gehören periodische Beinbewegungen im Schlaf und das Restless-Legs-Syndrom (RLS), bei dem in Ruhe ein Kribbeln in den Beinen auftritt. Auch diese Störungen können in jedem Alter auftreten. Bei Kindern ist Eisenmangel die häufigste Ursache.
Nach der International Classification of Sleep Disorders, ICSD
Wurde eine Narkolepsie festgestellt, können stimulierende Medikamente und Massnahmen der Schlafhygiene dazu beitragen, die Symptome zu verringern. «Ausserdem können die Betroffenen regelmässige, kurze Schläfchen in den Tagesablauf einbauen, um ihre Schläfrigkeit zu verringern», sagt Datta. «Darüber hinaus lernen sie Bewältigungsstrategien, etwa, um Situationen zu vermeiden, die Kataplexien auslösen.»
In manchen Fällen ist die Lösung für die Schlafprobleme – sobald die Ursache erkannt ist – auch ganz einfach. So wie bei der 7-jährigen Marlene: Sie wird abends zu einer kleinen «Tyrannin», verlangt ständig nach etwas anderem und will einfach nicht einschlafen. In der Schlafberatung stellt sich heraus, dass Marlene für ihr Alter eher wenig Schlaf braucht. Nachdem sie abends regelmässig später ins Bett geht, bessert sich die Situation rasch. Und die Eltern sind froh, zu wissen, dass weniger Schlaf ihrer Tochter nicht schadet.
- Regelmässige Zubettgeh- und Aufstehzeiten und ein geregelter Tagesablauf mit regelmässigen Essenszeiten fördern einen erholsamen Schlaf.
- Die Phase vor dem Schlafengehen ruhig gestalten. Ein Schlafritual kann das Einschlafen erleichtern. Dies kann eine 15 bis 30 Minuten lange, ruhige Aktivität sein – etwa Vorlesen oder Vorsingen bei jüngeren oder ein Buch lesen bei älteren Kindern.
- Auch Entspannungsübungen, die Kinder vorher einüben, können das Einschlafen erleichtern.
- Eine angenehme Schlafumgebung schaffen: So sollte das Schlafzimmer ruhig und nicht zu hell sein und eine angenehme Temperatur haben.
- Das Bett nur zum Schlafen nutzen. Smartphones, Tablets oder Fernseher eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen nicht mehr benutzen.
- Kinder sollten tagsüber ausreichend Bewegung haben und drei bis vier Stunden vor dem Schlafengehen keine koffeinhaltigen Getränke mehr trinken. Auf Alkohol und Nikotin möglichst ganz verzichten, weil sie das Durchschlafen verschlechtern.