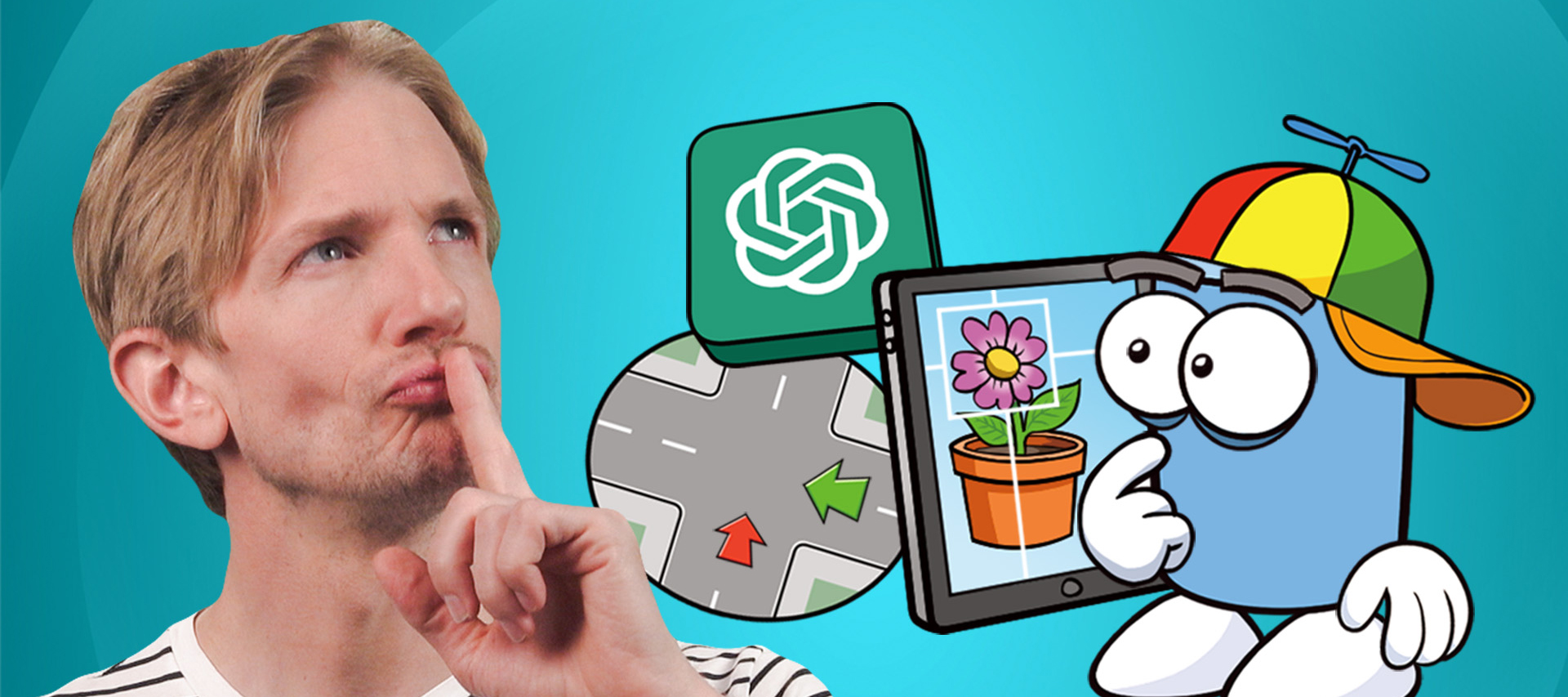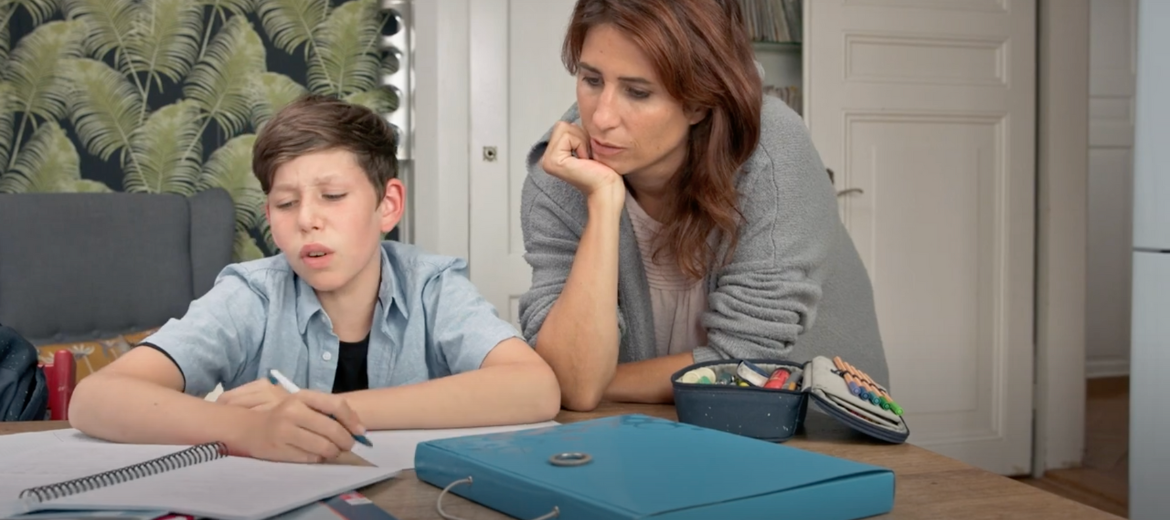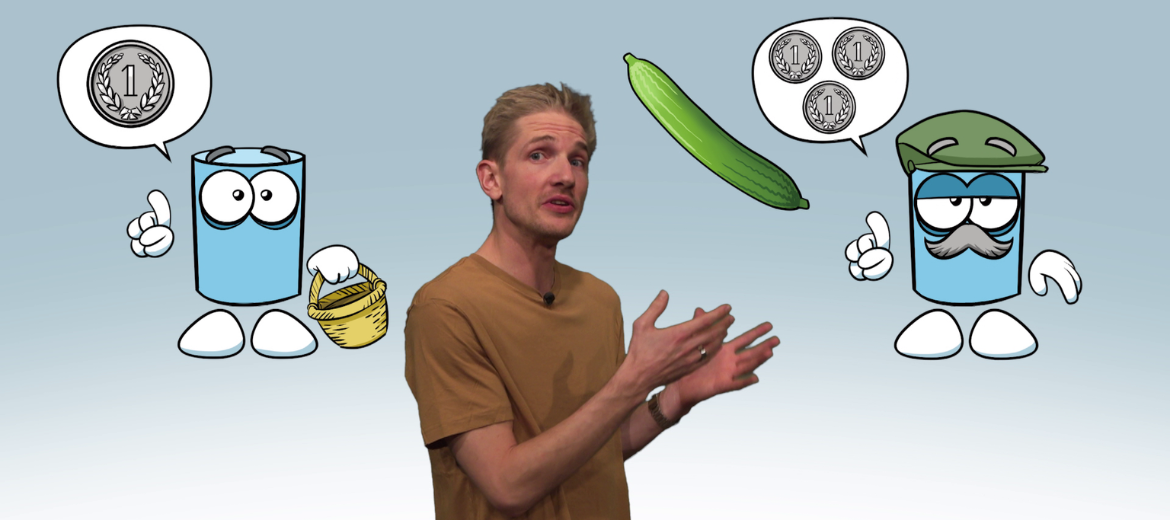Vertrauen in das Potenzial unserer Kinder

Die Interessen und Stärken der Kinder sollten in der Volksschule stärker im Zentrum stehen, findet unser Kolumnist, und zeigt auf, wie wir Erwachsene den Lernerfolg der Kinder beeinflussen können.
Ist Ihnen dieses bestärkende Gefühl bekannt, wenn jemand an Sie und Ihr Projekt glaubt? Täglich setzen sich viele hoch motivierte Lehrkräfte und Schulleitende dafür ein, Heranwachsende in eine glückliche, chancenreiche Zukunft zu begleiten. Zentral dafür ist, deren Vertrauen in die eigenen, individuellen Fähigkeiten zu fördern und zu stärken. Leider gelingt das nicht immer.
Oliver Wymann, ein international tätiges Institut für Strategieberatung, bringt es im kürzlich veröffentlichten Report «Bildungsgerechtigkeit – eine ungenutzte Chance für die Schweizer Wirtschaft» auf den Punkt: 17 Prozent der Jugendlichen fallen durch die Maschen.
Politische Ziele werden verfehlt
Das ist nicht nur ganz persönlich für die Betroffenen eine traurige Katastrophe, sondern auch für die Schweiz in Zeiten von Fachkräftemangel und unbesetzten Lehrstellen. Der volkswirtschaftliche Schaden beträgt laut Berechnungen des Instituts jährlich bis zu 29 Milliarden Franken. Dabei ist für die Unternehmen die Verfügbarkeit von Talenten der wichtigste Trumpf des Schweizer Wirtschaftsplatzes. Unternehmenssteuer, Rechtssicherheit und politische Stabilität landen auf den hinteren Rängen.
Die Schweizer Bildungspolitik blieb nicht untätig und forderte, dass 95 von 100 jungen Erwachsenen eine Berufslehre oder Mittelschule abschliessen. Der Bildungsbericht 2023 zeigt: Das Ziel wird verfehlt. Die Quote liegt bei 91,4 Prozent. Die Gründe liegen sowohl bei den jungen Erwachsenen als auch bei unserem Bildungssystem selbst.
Wenn Kinder und Jugendliche ihre Talente entfalten sollen, braucht es keine äusserliche Trennung nach Schultypen.
Was ist zu tun? Politik und Berufsverbände müssen vereint eine der unnötigsten Hürden abbauen und die Selektion Ende der 6. Klasse ans Ende der Volksschule verschieben. Warum? Die Selektion fällt in die Zeit der Pubertät; Kinder sind massiven Veränderungsprozessen ausgesetzt. Dieser geistige und körperliche Stress führt oft dazu, dass sie nicht bereit sind für den druckreichen Selektionsprozess. Dieser basiert denn auch nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern auf Traditionen und verstärkt die Chancenungerechtigkeit. (Lesen Sie dazu die Kolumne «Schluss mit der Selektion» von Thomas Minder.)
Wenn Kinder und Jugendliche ihre Talente entfalten sollen, braucht es mehr Durchlässigkeit und keine äusserliche Trennung nach Schultypen. Stattdessen muss ein vielfältiges Lernangebot mit herausfordernden Aufgaben und Projekten vorhanden sein, welches für die Kinder und Jugendlichen relevant ist. Das lässt ihnen den dringend benötigten Spielraum zur Entfaltung ihres Potenzials.
Neben den strukturellen Veränderungen sollten auch wir Erwachsenen uns der positiven Einflussnahme bewusst sein. Kennen Sie den Pygmalion-Effekt? Pygmalion ist in der griechischen Mythologie ein Bildhauer, der auf der Suche nach der perfekten Frau eine weibliche Statue als Projektion seiner Erwartung erschafft – und sich in sie verliebt. Das Happy End: Die Göttin Venus hat Erbarmen mit ihm und erweckt die Statue für Pygmalion zum Leben.
Positive Erwartung fördert positive Entwicklung der Kinder
In der Realität ist der Pygmalion-Effekt etwas unromantischer, aber ähnlich wirkungsvoll. Robert Rosenthal und Lenore Jacobson haben den Zusammenhang zwischen vorhandener Erwartung und entstehendem Ergebnis in den 1960er-Jahren erforscht. Die beiden US-Psychologen wollten mithilfe eines Experiments beweisen, dass Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Erwartungen die Leistungen von Schülern unbewusst beeinflussen und damit auch steigern können.
Dafür wurde den Lehrpersonen vorgetäuscht, dass durch einen wissenschaftlichen Test diejenigen Schüler einer Schulklasse identifiziert werden könnten, die vor einem Leistungssprung stehen. Nach dem Erfassen des Leistungspotenzials könne der Anteil bei rund 20 Prozent der Schüler liegen, so das Versprechen.
Tatsächlich wurden die betreffenden Schülerinnen und Schüler aber nicht aktiv per Testverfahren ermittelt, sondern von den Forschern willkürlich per Losverfahren ausgesucht. Der Test selbst erfasste nicht das Potenzial für eine Leistungssteigerung, sondern den Intelligenzquotienten. Acht Monate nach diesem ersten IQ-Test wurde der Test mit allen Schülern wiederholt. Das Ergebnis: Die zuvor willkürlich ausgewählten Schüler hatten gegenüber den anderen Schülern eine deutliche Steigerung ihres Intelligenzquotienten.
Da niemand ausser den beteiligten Lehrpersonen die Information über das vermeintlich wissenschaftlich ermittelte Potenzial für eine mögliche Leistungssteigerung bei den ausgewählten Schülern hatte, gab es nur eine mögliche Erklärung: Die Lehrerinnen und Lehrer selber hatten mit ihren Erwartungen und ihrem Verhalten gegenüber den Schülern mit dem angeblichen Talent für die Leistungssteigerung gesorgt – so wie Pygmalion sich seine gewünschte Frauenfigur erschaffen hat.
Werden Schülerinnen und Schüler befähigt, ihren eigenen Lernweg zu gestalten, werden sie dies als persönliche Leistung anerkennen.
Was diesen Lehrpersonen widerfuhr, stellten Forscherinnen unlängst auch bei Schulleitenden fest. Während der Corona-Pandemie wurden österreichische Schulen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass besonders Schülerinnen und Schüler an sozialräumlich benachteiligten Standorten Gefahr laufen, gerade in solchen Krisensituationen wie der Covid-19-Pandemie doppelt benachteiligt zu werden.
Im Kontext des Distanzunterrichts hat dies dazu geführt, dass Schulleitungen an benachteiligten Standorten dazu tendierten, die Anforderungen an die Schülerschaft zu reduzieren. Die Befunde weisen zudem auf eine geringere Leistungserwartung an die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Herkunft hin, die vonseiten der Leitenden und Lehrenden verstärkt werden kann. Ein negativer Pygmalion-Effekt sozusagen.
Unsere Einstellung macht den Unterschied
Kinder und Jugendliche mit ihren Interessen und Stärken müssen im Zentrum des Bildungssystems stehen. Das Lernen, die Ziele und die Schule selbst sind darauf auszurichten. Potenzialentfaltung entsteht in einer Kultur des Vertrauens und des Ermöglichens. Lernfreude und Lernerfolg hängen eng zusammen.
Werden Schülerinnen und Schüler befähigt, ihren eigenen Lernweg zu gestalten und über ihr eigenes Lernen nachzudenken, werden sie dies als persönliche Leistung anerkennen. Ihre Talente werden sie von selbst in gemeinsamen Projekten, die einen direkten Zusammenhang mit den grossen Herausforderungen unserer Zeit haben, einsetzen und weiterentwickeln.
Genau wie bei uns Erwachsenen, wenn andere an uns und an unser Projekt glauben.