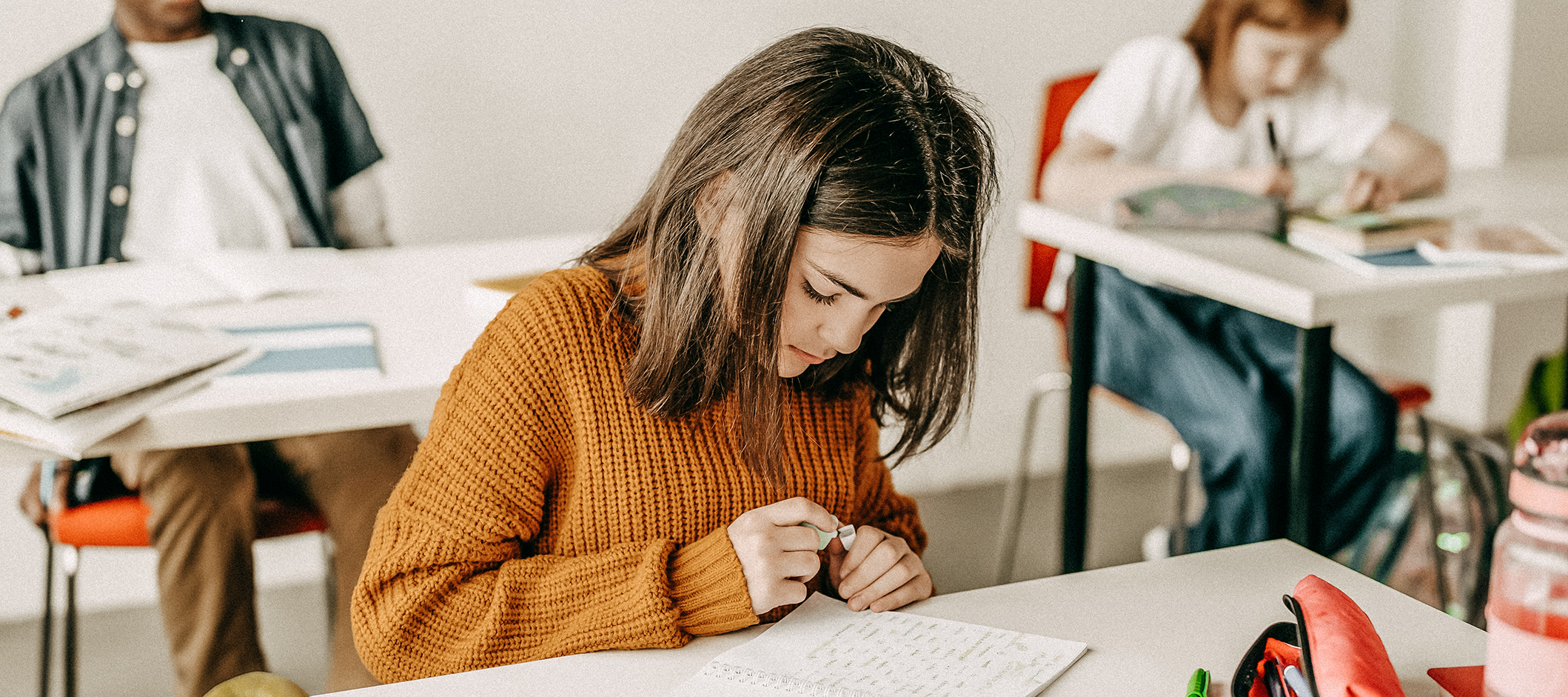Welche Schule will die Schweiz?

Die Mercator-Stiftung wollte von Eltern hierzulande wissen, wie sie sich die ideale Schule für ihr Kind vorstellen. Projektleiter Daniel Auf der Maur ordnet die Resultate ein.
Herr Auf der Maur, welche Schule wünschen sich Eltern für ihr Kind?
Vereinfacht gesagt, lassen sich unsere Resultate auf drei Hauptanliegen herunterbrechen, bei denen Eltern auch den grössten Handlungsbedarf sehen. Erstens ist es für sie zentral, dass ihr Kind Freude am Lernen hat. Zweitens möchten sie, dass es gerne zur Schule geht, sich dort wohlfühlt. Drittens sollen Kinder individuell gefördert werden, also in ihrem eigenen Tempo lernen dürfen und weder unter- noch überfordert sein.
Im Lehrplan 21 wird Individualisierung grossgeschrieben. Wenn Sie auf Ihre Erfahrung als Lehrer und Schulleiter zurückblicken: Wie realistisch ist die Forderung angesichts der Vielfalt im Klassenzimmer?
Es ist doch genau diese Vielfalt, die keine Alternative zulässt. Kinder sind im Hinblick auf ihren Entwicklungsstand extrem unterschiedlich, selbst bei Gleichaltrigen ist das Spektrum individueller Voraussetzungen riesig. Das ist eine Tatsache, die uns eigentlich keine andere Wahl lässt, als diese Unterschiede so gut wie möglich zu berücksichtigen.
Was bedeutet Individualisierung denn aus Ihrer Sicht?
Kindern persönliche Lernwege zu ermöglichen. Gute Varianten sind offene Fragestellungen, die automatisch zu unterschiedlichen Wegen führen. Die Schule kann den Fokus auch stärker auf Angebote mit mehr Wahlmöglichkeiten legen. Ich denke da etwa an Lernlandschaften, wo eine Vielfalt an unterschiedlichen Inhalten und Materialien zur Auswahl steht.

Sicher aber müssen wir uns lösen von der klassischen Lektion, die Schritt für Schritt alles vorgibt. Es gibt Kinder, die rechnen in der zweiten Klasse bereits im Tausenderraum – dann ist es nicht sinnvoll, wenn sie sich erst an Hundertern abarbeiten müssen, weil die Lehrperson es so vorsieht. Genauso sollten jene, die länger brauchen, nicht hetzen müssen, weil für alle die gleichen Lernziele gelten.
Das klingt attraktiv, wirft aber die Frage nach der Umsetzbarkeit auf, gerade im Hinblick auf Ressourcen.
Ich habe oft mit Schulen zu tun, die Alternativen erproben. Was mir auffällt: Das funktioniert nur als Team. Wenn die Lehrerinnen und Lehrer Material etwa so vorbereiten, dass Inhalte gemeinsam koordiniert, genutzt und ausgetauscht werden, profitieren letztlich alle von Entlastung und Inspiration.
Auch, wenn die Schule bestehende Ressourcen wie Teamteaching-Stunden und das Pensum für schulische Heilpädagogik effizient einsetzt, eröffnet sich viel Potenzial. Das darf dann aber nicht so enden, dass Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sich ausschliesslich «ihrer» Kinder annehmen, und dies auch noch ausserhalb der Klasse.
Ein weiteres Resultat Ihrer Studie: Eltern wollen mehr Projektunterricht.
Ja, vermutlich deshalb, weil Kinder dort Gelegenheit haben, individueller und an Themen zu arbeiten, die sie interessieren. Lehrpersonen sind diesbezüglich oft zurückhaltend. Ich glaube, viele sind unsicher, ob Kinder bei Lernformen, die viel Freiraum lassen, auch das Richtige lernen. Manche befürchten vielleicht, Schülerinnen und Schüler könnten dann anderweitig ins Hintertreffen geraten. Da müssen wir lernen, loszulassen. In der Corona-Pandemie blieb uns nichts anderes übrig.
Neun von zehn Befragten wünschen sich, dass Schulen mehr gegen Mobbing tun.
Die Pandemie zeigte aber auch, dass Kinder mit selbstorganisiertem Lernen teilweise überfordert sind.
Das stimmt. Projektunterricht zum Beispiel bedeutet aber nicht, auf Struktur und Orientierung zu verzichten – manche Kinder sind dann umso mehr darauf angewiesen. Eine andere Erkenntnis aus der Pandemie lautet auch: Es gibt Kinder, die mit mehr Freiraum und weniger Anleitung regelrecht aufblühen. Wir wollen, dass junge Menschen Verantwortung für ihr Lernen übernehmen, wenn sie aus der Schule kommen. Dann muss ihnen diese auch Gelegenheit bieten, sich darin zu üben.
Eltern, so Ihre Studie, wünschen ihren Kindern denn auch mehr Freiraum beim Lernen. Wie gut lässt sich dies mit dem Lehrplan 21 vereinbaren?
Im Prinzip böte der Lehrplan 21 tatsächlich mehr Freiraum. Sichtbar wird dies etwa daran, dass Lernziele sich an mehrjährigen Zyklen ausrichten. Kinder hätten also eigentlich viel mehr Zeit, um sich bestimmte Fähigkeiten anzueignen. Die Realität sieht leider häufig anders aus: Den Alltag diktieren Prüfungen, bei denen unterschiedliche Kinder zum selben Zeitpunkt das Gleiche können müssen. Der Lehrplan 21 denkt in Zyklen, die Schule nicht.
Woran liegt das?
Der Lehrplan 21 ist vermutlich etwas dick geraten, was die Anzahl Kompetenzen betrifft, die Kinder erwerben sollen. Das setzt Lehrpersonen unter Druck, alles durchbringen zu müssen. Und: Man kann mit Schülerinnen und Schülern noch so individuell arbeiten – am Semesterende müssen Noten ins Zeugnis. Individualisiertes Lernen ist im Grunde nur möglich, wenn wir die Beurteilung neu denken. Wir müssen von unserer Bewertungskultur wegkommen.
Ihre Analyse zeigt aber auch: Die Mehrheit der Befragten stellt weder Hausaufgaben noch Noten infrage.
Wenn man das Resultat über alle Befragten hinweg betrachtet, ja. Allerdings zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen: Frauen sprechen sich insgesamt deutlicher gegen Noten aus, nämlich zu 50 Prozent, während bei den Männern nur knapp ein Drittel für eine Abschaffung plädiert.
Zwei Drittel der Eltern würden eine Privatschule in Betracht ziehen. Das überrascht mich.
Mehrheitsfähig ist diese ausserdem bei den meisten Eltern mit Kindern im Kindergarten und in der Primarschule. Was die Hausaufgaben angeht, wollen sie etwas mehr als die Hälfte der Befragten auf der Primarstufe beibehalten.
Erstaunt Sie das?
Bedingt. Die meisten Erwachsenen kennen Schule ja nur aus ihren Erinnerungen – meist mit Hausaufgaben, Prüfungen und Noten. Man hat höchstens vage Vorstellungen von Alternativen. Ideale, die viele teilen – dass Kinder ohne Druck lernen können –, stossen auf Unsicherheit, die aufkommt, wenn herkömmliche Strukturen aufgebrochen werden: Wird mein Kind genügend lernen? Ich habe ausserdem Verständnis, wenn Eltern sagen, Noten und Hausaufgaben seien als Rückmeldung hilfreich, um im Bild zu bleiben, wo das Kind schulisch steht.
Welcher Befund hat Sie am meisten überrascht?
Zwar besuchen nur rund fünf Prozent der Kinder in der Schweiz eine Privatschule, aber zwei Drittel der Eltern würden eine solche grundsätzlich in Erwägung ziehen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Der Wunsch nach individueller Förderung ist laut unserer Studie der meistgenannte Grund, warum Eltern ihre Kinder aus der Volksschule nehmen.
Wie sieht eine zeitgemässe Schule aus? Was bedeutet gutes Lernen? Gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Sotomo realisierte die Stiftung Mercator Ende 2022 eine landesweite Meinungsumfrage zum Schweizer Schul- und Bildungswesen. Teilgenommen haben 7700 Erwachsene, ein Drittel davon Eltern von schulpflichtigen Kindern.
www.stiftung-mercator.ch/journal/welche-schule-will-schweiz
Viele argumentierten auch mit dem Wohlbefinden des Kindes. Diesem Aspekt, dies zeigen unsere Gesamtresultate, gilt es mehr Beachtung zu schenken: Neun von zehn Befragten wünschen sich, dass sich Schulen stärker gegen Mobbing und für die Förderung der psychischen Gesundheit engagieren. Was ich sehr erfreulich finde: Die Wichtigkeit der Volksschule bleibt im Empfinden der befragten Eltern und Erwachsenen hoch, die Lehrpersonen bedeutsam.
Inwiefern?
Die Umfrageteilnehmenden finden allesamt, dass Lehrpersonen einen anspruchsvollen Beruf ausüben. Sie sind auch nicht der Meinung, dass diese zu viel Ferien hätten oder zu viel verdienten. Zudem werden Quer- und Neueinsteigende als Chance für die Schule betrachtet.