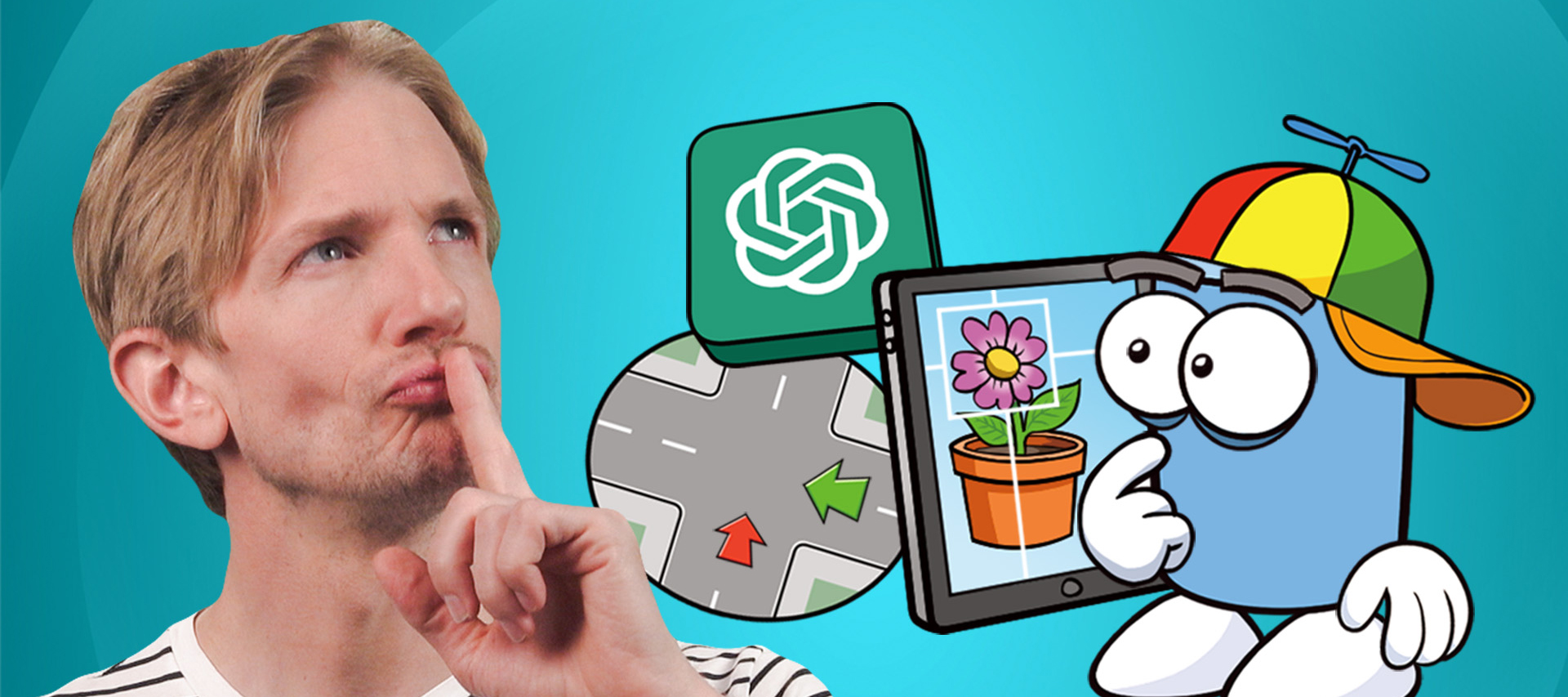Aufschieben: Was wirklich hilft

Wenn wir eine Aufgabe vor uns herschieben, wollen wir die unangenehmen Gefühle nicht wahrnehmen, die sie in uns auslöst. Wer daran etwas ändern will, muss sich mit seinen Emotionen auseinandersetzen, sagt unsere Kolumnistin.
Menschen, die prokrastinieren, also Aufgaben immer wieder aufschieben, gelten rasch als faul. Viel häufiger kämpfen sie jedoch innerlich, und das Aufschieben ist lediglich das Ventil, um ein wenig übermässigen psychischen Druck abzulassen.
Carla ergeht es so. Für die Schule soll die 14-Jährige eine schriftliche Arbeit verfassen, doch obwohl sie eigentlich fleissig und ehrgeizig ist, schiebt sie diese seit Wochen vor sich her. Jeden Tag wachsen das schlechte Gewissen und der Druck. Immer wieder notiert sie sich «Arbeit schreiben!!!» in ihrer Agenda.
Doch wann immer sie den Laptop startet und auf die noch leere Seite starrt, schwappt die Unsicherheit und Angst wie eine Welle über sie hinweg: «Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll!», «Wie schreibt man so eine Arbeit überhaupt?», «Ich schaffe das nicht!», «Die anderen sind bestimmt fast fertig!», «Frau Binz wird so enttäuscht von mir sein!».
Wenn sie sich doch aufraffen kann, ein oder zwei Absätze zu schreiben, empfindet sie ihren Versuch als «Müll» und löscht ihn wieder. Alles in Carlas Körper schreit: «Nur weg hier!» Also sagt sie sich, dass es «sowieso nichts bringt», und schwört sich, dafür am Wochenende «richtig loszulegen», wenn sie mehr Zeit hat. Dann klappt sie den Laptop zu und ist erleichtert: Angst und Druck haben ein wenig nachgelassen.
In einem unserer Workshops zum Thema «Aufschieben» lernt Carla, dass sie sich der Angst stellen, sie aushalten und sich damit auseinandersetzen muss. Dazu öffnet sie den Laptop und achtet darauf, welche Gedanken sie überfallen. Anstatt ihre unangenehmen Empfindungen zu vermeiden, notiert sie alles, was ihr durch den Kopf geht. Bald merkt sie, dass sie ein wenig ruhiger wird.
Wo genau liegt das Problem?
In der Gruppe überlegt sie mit anderen Schülerinnen und Schülern sowie der Kursleiterin, welche Sichtweisen ihr helfen könnten, in den Schreibprozess hineinzufinden. Auf den Gedanken «Ich weiss gar nicht, wie man so eine Arbeit schreibt!» antwortet ein anderer Schüler: «Das ist ja klar, du machst das zum ersten Mal!»
So hat Carla das noch nie betrachtet. «Was genau weisst du nicht? Und wie kannst du das herausfinden?», fragt die Kursleiterin. Carla merkt, dass sie ihr Thema zwar kennt, aber unsicher ist, wie sie ihre schriftliche Arbeit strukturieren soll.
Endlich kann sich Carla entspannen. Ihre neue Aufgabe lautet: «Schreibe eine richtig lausige Erstversion!»
Rasch fällt ihr ein, dass in der Mediathek ihrer Schule viele Beispiele anderer Schülerinnen und Schüler aus den letzten Jahren stehen und sie sich deren Inhaltsverzeichnisse kopieren könnte, um zu schauen, wie das andere vor ihr gemacht haben. Auch konkretere Fragen wie «Wie schreibt man eine Einleitung?» lassen sich so beantworten: Sie liest drei, vier fremde Beispiele und überlegt dann, welche Form sie besonders anspricht und zu ihrer eigenen Arbeit passen würde.
Carla lernt, dass ihr ihre hohen Ansprüche im Weg stehen. Solange sie ihre Texte gleich als «Müll» abtut, lähmt sie sich selbst. Natürlich darf sie ein gutes Endresultat anstreben. Wichtig ist aber, sich bewusst zu machen, dass nicht alles von Anfang an perfekt sein muss. Im Gruppenkurs erfährt sie, dass viele berühmte Schriftstellerinnen und Schriftsteller ihre Manuskripte mehrfach überarbeiten und sogar Ernest Hemingway einst sagte: «The first draft of everything is shit!» Endlich kann sie sich entspannen. Ihre neue Aufgabe lautet: «Schreibe eine richtig lausige Erstversion!» Diese wird ihr helfen, eine bessere Variante zu Papier zu bringen.
Wie man sich selbst überlistet
Insbesondere Menschen mit ADHS oder ADS gehen anstrengenden und langweiligen Aufgaben oftmals aus dem Weg. «Mach ich später», sagen sie zu häufig oder «Ich brauche halt den Druck». Irgendwann wird dieses Muster zum Problem: Spätestens, wenn die Aufgaben so umfangreich werden, dass der «nötige Druck» zu spät kommt, und keine Eltern mehr beim Strukturieren mithelfen oder mehr oder weniger liebevoll auf die Einhaltung bestimmter Deadlines drängen.
Julian, 19, will eigentlich einen möglichst guten Lehrabschluss hinlegen. Wenn er sich doch nur aufraffen könnte! Im Workshop notiert er sich Gedanken wie «Ich habe überhaupt keinen Bock!», «Es reicht auch, wenn ich morgen anfange», «Das ist so langweilig!», «Ich würde jetzt viel lieber gamen».
Erst wenn Julian die 45 Minuten Lernzeit sinnvoll nutzen kann, darf er mehr Zeit einsetzen.
Die erste Aufgabe der Kursleiterin überrascht ihn: Er soll sich Zeitblöcke für die Freizeit reservieren. Sogar, wenn er am Tag zuvor nicht gelernt hat, soll er diese Pausen einhalten und irgendetwas tun, das ihm wirklich Spass macht. Seine Lernzeit wird auf maximal 45 Minuten pro Tag beschränkt. Er darf sie verkürzen, aber nicht verlängern.
«Was?! Aber das ist viel zu wenig!», ereifert er sich, obwohl er die letzten Wochen kaum 20 Minuten pro Tag für die Vorbereitung seiner Lehrabschlussprüfung investiert hat. Die Trainerin bleibt hart: Erst wenn er diese 45 Minuten sinnvoll nutzen kann, darf er mehr Zeit einsetzen. «Und wenn ich an einem Tag gar nichts gemacht habe? Kann ich dann am nächsten Tag 90 Minuten?», will Julian wissen. Nein, darf er nicht. Aber er darf sich einen Plan aufstellen, damit er die 45 Minuten wirklich gut nutzen kann.
Und wenn er einmal gar keine Lust hat, solle er den 10-Minuten-Trick ausprobieren. Dabei sagt er sich: «Ich lerne jetzt 10 Minuten. Wenn ich reinkomme, mache ich weiter. Und wenn es mir immer noch stinkt, breche ich ab – dann habe ich wenigstens 10 Minuten gelernt!»
Julian ist erstaunt: Jetzt, wo er nur 45 Minuten «darf», will er auch. Dass die Trainerin ihm verboten hat, mehr zu tun, ärgert ihn ein wenig.
Eingeständnis als erster Schritt
Von allen im Workshop fällt es dem 24-jährigen Louis am schwersten, sich seinen Gefühlen und Gedanken zu stellen. Seit drei Jahren studiert er Wirtschaft, der Bachelor ist trotzdem noch in weiter Ferne. Zu viele Tests hat er noch nicht geschafft, die Seminar- und Bachelorarbeiten stehen noch aus. Immer wieder spricht er davon, was er alles müsste und sollte – um dann doch etwas anderes zu tun.
Was genau? Das weiss er gar nicht. Die Tage gehen irgendwie vorbei, er surft am Handy, kauft ein, «verquatscht» sich mit den Mitbewohnern. Zuerst reisst er Witze darüber, bezeichnet sich als faul. Aber eigentlich fühlt er sich als Versager. «Interessierst du dich für das Fach?», fragt die Kursleiterin. «Nein.» «Kannst du dir vorstellen, später in diesem Bereich zu arbeiten?» «Nein.» «Warum studierst du weiter?» Weil er doch irgendetwas machen müsse, schon so viel investiert habe und nicht blöd dastehen wolle. Und überhaupt, wenn man etwas angefangen habe, dann mache man es doch fertig!
Louis sitzt in der Klemme. Zurück will er nicht. Vorwärts geht es nicht. Seine Gründe fürs Weiterstudieren haben keine motivierende Zugkraft. Sie werden nicht reichen, um die ausstehenden Tests und Arbeiten abzuschliessen. Bis zum Ende des Workshops weiss Louis nicht, was er tun soll. Zwei Monate später schreibt er der Kursleiterin eine Mail: Er habe sein Studium abgebrochen, fühle sich endlich frei, habe wieder Energie. An der Fachhochschule gefalle es ihm besser. Sozialarbeit sei zwar nicht die erste Wahl seiner Eltern gewesen, aber schliesslich müsse es ihm gefallen.