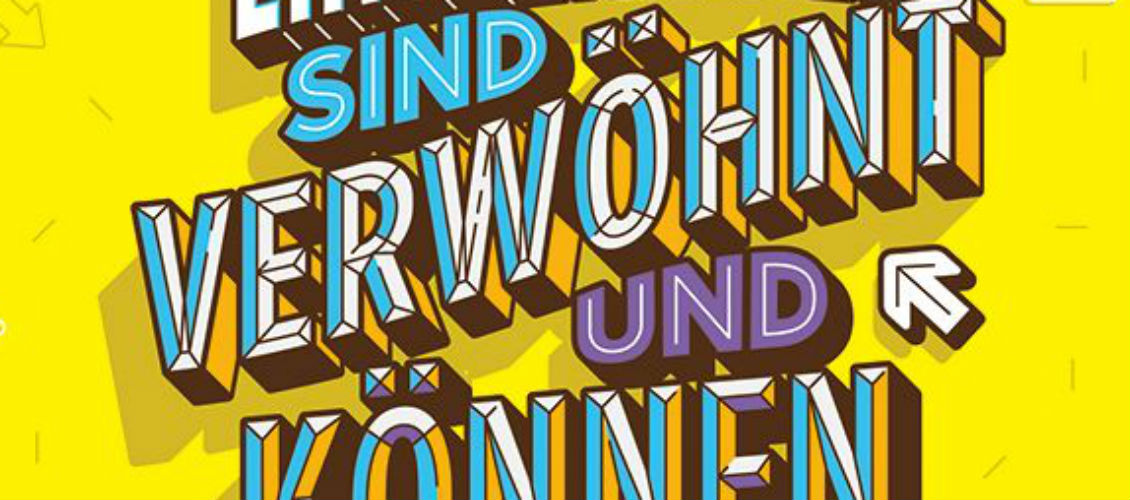Geschwister – Die längste Beziehung des Lebens

Geschwister bleiben ein Leben lang miteinander verbunden. Auch, wenn sie nicht gut miteinander auskommen. Wie Eltern die Beziehung ihrer Kinder untereinander stärken können. Teil 5 unserer Serie «Wie Familie gelingt».
Wie die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern stellen auch Geschwisterbeziehungen einen lebenslangen Bund dar. Geschwister sucht man sich nicht aus. Sie sind und bleiben ein Teil der eigenen Geschichte und jener der Familie. Geschwister sind somit besondere Personen im Leben eines Menschen. Die Beziehung zwischen Geschwistern ist geprägt durch grosse Gefühle: Sie lieben und sie hassen sich. Sie vertrauen einander und im nächsten Moment sind sie die grössten Rivalen. Sie vergleichen sich und sind eifersüchtig.
Geschwister können einem ein Gefühl der Zusammengehörigkeit geben, sie sind Spiel- aber auch Streitkameraden. Auch wenn Geschwister untereinander Schwierigkeiten haben: Nach Aussen stehen sie trotzdem füreinander ein.
Prägende Beziehung mit Spielraum
Brüder und Schwestern prägen einander mindestens so stark, wie sie von den Eltern geprägt werden. Im Vergleich zur Beziehung zwischen Eltern und Kinder ist jene unter Geschwistern jedoch freier und weniger reglementiert. Das bietet Spielraum – im Positiven wie im Negativen. Während Eltern auf eine Nachfrage, ein Bitten oder eine Forderung oftmals nachgeben und versuchen, dem Kind das zu geben, was es braucht, können Geschwister sehr hartnäckig und gleichberechtigt reagieren. Insbesondere, wenn der Altersabstand nicht allzu gross ist.
In diesen alltäglichen Auseinandersetzungen können Geschwister viel voneinander lernen: klar zu kommunizieren, zu verhandeln und Konflikte zu lösen. Sie üben im Umgang miteinander das Wechselspiel zwischen Nachgeben und Sich-Durchsetzen. Sie lernen auch, dass man sich mögen kann, auch wenn das Geschwister anderer Meinung ist, andere Vorlieben und Eigenschaften hat. Und dass diese Beziehungen trotzdem stabil bleiben.
Geschwister sind ein Resilienzfaktor, der über schwierige Zeiten hinweghelfen kann.
Untersuchungen verdeutlichen, dass insbesondere in kritischen Lebenssituationen Geschwister einander starken Halt geben können. Sie sind ein Resilienzfaktor, der über schwierige Zeiten hinweghelfen kann.
Schwierige Geschwisterbeziehungen können aber auch Schaden an der Seele anrichten. Artet der Geschwisterstreit permanent und über einen längeren Zeitraum hinweg aus, kann das ernste gesundheitliche Folgen haben.
Regelmässig von den Geschwistern geplagt zu werden, zu erleben, dass man ignoriert wird, dass Lügen erzählt, hässliche Dinge über einen gesagt werden, dass man nicht geschützt wurde, führt zu einem erhöhten Risiko, an psychischen Auffälligkeiten zu leiden, etwa an Depressionen, Angststörungen oder selbstverletzendem Verhalten. Es lohnt sich daher für Eltern, dieser ganz speziellen Beziehungskonstellation Sorge zu tragen und sie zu fördern.
Positionskämpfe in der Familie
Jedes Kind ist anders und hat seine persönlichen Stärken und Schwächen. Darum unterscheiden sich Geschwister auch voneinander. Und nicht immer finden sich Geschwister gegenseitig toll, auch wenn wir erwarten, dass sie sich eigentlich lieb haben müssen.
Wenn die Persönlichkeiten der Kinder sehr unterschiedlich sind, ist Streit auch ein Ausdruck davon, dass die Kinder noch lernen müssen, mit der Art des anderen umzugehen. Nicht selten geht es bei Streitigkeiten zwischen Kindern um die Position in der Familie und um Rivalität, Rechthaben und Gerechtigkeit. Dahinter liegt das Grundbedürfnis, wahrgenommen, geliebt und anerkannt zu werden, seinen Platz zu haben und in Sicherheit zu sein. Jeder Mensch, ob gross oder klein, möchte gesehen und wahrgenommen werden. Ein Geschwister kann diesen Platz unter Umständen in der Wahrnehmung des Kindes gefährden.
Je nach Alter, Temperament und auch Verfassung brauchen Kinder unterschiedliche elterliche Zuwendung und Erziehung.
Die Eltern spielen oft eine entscheidende Rolle im Geschwisterstreit: Es geht um ihre Zustimmung, ihre Unterstützung, ihr Wohlwollen. Jedes Kind möchte das Gefühl haben, wichtig zu sein und so, wie es ist, in seiner Art akzeptiert zu werden. Kinder können unzufrieden und quengelig werden, wenn sie das Gefühl haben, von den Eltern weniger Aufmerksamkeit zu erhalten, als sie brauchen oder das Geschwisterkind bekommt. Haben Kinder das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden und zu kurz zu kommen, kann es zu offenen oder verdeckten Aggressionen gegenüber dem Geschwisterkind kommen.
Probleme können auch entstehen, wenn die Eltern dem Kind nur Aufmerksamkeit schenken, wenn es laut, störend und aggressiv ist. Es besteht die Gefahr, dass das Kind lernt, dass es einfach laut sein und quengeln muss, um wahrgenommen zu werden. Die folgenden vier Tipps können helfen, die Geschwisterbeziehung zu stärken.
4 Tipps, Eltern helfen, die Geschwisterbeziehung zu stärken
1. Tipp: Gerechtigkeit ausüben
Für viele Eltern ist es eine grosse Herausforderung, mehreren Kindern gleichzeitig gerecht zu werden. Gleichberechtigung heisst jedoch nicht unbedingt, dass jedes Kind dasselbe erhält. Gerecht heisst in diesem Sinn, dass auf jedes Kind individuell eingegangen wird, mit Rücksicht darauf, wie es ihm geht, was es kann oder noch lernen muss. Je nach Alter, Temperament und auch Verfassung brauchen Kinder unterschiedliche elterliche Zuwendung und Erziehung.
Wenn den Kindern erklärt wird, warum man mit einem Kind vielleicht in gewissen Situationen anders umgeht als mit dem anderen, können dies Kinder meist gut verstehen. Wird eines der Kinder generell bevorzugt, ist Eifersucht bei dem Geschwisterkind zwangsläufig und verständlich.
2. Tipp: Den Grund für Streit verstehen
Wenn ständig gestritten wird, lohnt es sich, genau hinzuschauen, in welchen Situationen die Kinder streiten, worüber sie streiten und wie der Streit endet. Nicht alles, was Kinder tun, geschieht aus Eifersucht. Vielleicht ist das Kind auch nur gelangweilt. Was bietet sich hier besser an, als das Geschwister zu plagen und zu ärgern?

Vielleicht aber fehlen den Kindern in der Tat Strategien, wie sie miteinander auskommen und einen Weg finden können. Streit ist ein Ausdruck von Unwohlsein, von etwas ändern wollen und nicht wissen, wie. Mitunter sind Kinder in Konfliktsituationen regelrecht verzweifelt und überfordert. Hier brauchen die Kinder die Unterstützung der Erwachsenen.
3. Tipp: Was braucht das Kind?
Versuchen Sie zu verstehen, worüber die Kinder streiten und womit sie nicht umgehen können. Unterstützen Sie die Kinder, einander zuzuhören, um ein gewisses Verständnis füreinander zu entwickeln. Bei jüngeren Kindern müssen die Eltern erklären, warum das Kleinkind beispielsweise schreit. Vielleicht aus Hunger, Angst, Müdigkeit oder Ärger? Was braucht es, was können wir tun, damit es aufhört? Damit kann das ältere Geschwister das Verhalten des jüngeren einordnen und erhält Strategien, wie es mit seinem jüngeren Geschwisterchen umgehen und es vielleicht sogar unterstützen kann.
Unterstützung ist dort notwendig, wo die Kinder selber nicht weiter kommen.
Bei älteren Kindern, die sich immer wieder in die Haare kriegen, sollte jedes Kind die Gelegenheit erhalten, zu sagen, wie es ihm geht und was ihm helfen würde, friedlich mit dem anderen weiterzuspielen. Statt frühzeitig den Schiedsrichter zu spielen und zum Zentrum des Streits zu werden, sollten Eltern die Gelegenheit nutzen, um den Kindern zu vermitteln, wie sie den Streit gemeinsam beenden können. Wenn verstanden wird, warum der andere wütend wurde und was dieser eigentlich möchte, können Kompromisse gefunden werden – insofern die Bedürfnisse beider Parteien Platz haben.
Jeder sollte daher die Möglichkeit erhalten, zu sagen, wie er sich fühlt. Was ist passiert? Was hat das mit dir gemacht? Und was können wir jetzt tun, um friedlich weiterzumachen? Unterstützung ist dort notwendig, wo die Kinder selber nicht weiter kommen.
4. Tipp: Grenzen setzen
Klare Regeln, wie man in der Familie miteinander umgeht, können das Familienleben zusätzlich entlasten. Klare Regeln helfen, dass jedem verständlich ist, was verlangt wird und wie man sich verhalten muss. Verhaltensweisen, die im Streit nicht toleriert werden, wie Schlagen, Treten, Beissen, das Zerstören von Dingen, müssen unterbunden werden, damit das unterlegene Kind nicht immer wieder die Erfahrung machen muss, dass es seinem stärkeren Geschwister ausgeliefert ist.
Aber auch diese Verhaltensweisen machen eigentlich deutlich, dass die Kinder nicht wissen, wie sie auf eine andere Art und Weise zu dem kommen können, was sie brauchen und möchten. Was wiederum bedeutet, dass sie lernen und hierbei unterstützt werden müssen, wie sie Streit mit anderen Mitteln als mit Gewalt und Abwertung regeln können.
Manchmal reicht schon etwas Verständnis, um die Situation zu entspannen.
Unsere Reaktion auf die Streitigkeiten zwischen den Geschwistern beeinflusst massgeblich die Entwicklung ihrer Konfliktlösungsfähigkeit. Seien wir uns bewusst: Wenn Streit herrscht, sind eigentlich alle Beteiligten in Not. Daher brauchen auch alle etwas Trost und Verständnis. Manchmal reicht schon dieses Verständnis, um die Situation zu entspannen und die Kinder anzuregen, selbst einen Weg vorzuschlagen, wie sie miteinander Frieden schliessen können.
- Geschwisterbeziehungen sind ganz besondere Beziehungen, die lebenslang bestehen bleiben und uns prägen.
- Eltern haben einen Einfluss darauf, wie sich die Beziehung zwischen den Kindern entwickelt.
- Jedes Kind hat seinen Platz in der Familie und soll sich entfalten dürfen.
- Häufiger Streit ist ein Ausdruck von Not.
- Um Konflikte auflösen zu können, muss verstanden werden, was die Bedürfnisse der Kinder sind, was ihnen schwer fällt und wo sie Unterstützung brauchen.
Wenn Kinder es schaffen, mit einander auszukommen und trotz all der Unterschiede eine tiefe Geschwisterbeziehung aufzubauen, werden sie soziale Kompetenzen erlernen, die ihnen auch im späteren Leben hilfreich sein werden. Und sie werden ihr Leben lang diese besondere Beziehung zwischen Geschwistern erleben können: das Gefühl von Zusammengehörigkeit, nicht alleine zu sein und jemanden an seiner Seite zu wissen, wenn es drauf ankommt.