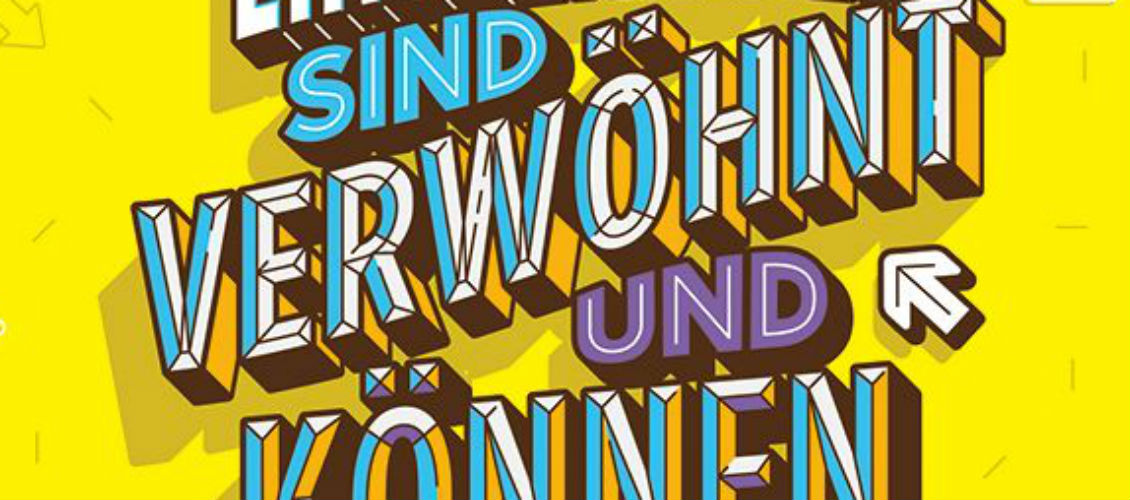«Herr Frick, gibt es das typische Lieblingskind?»

Das eine Kind den anderen vorzuziehen, ist für Mütter und Väter ein Tabu. Trotzdem kommt es sehr oft vor, sagt Jürg Frick. Der Psychologe über Lieblingskinder, zu hohe Ansprüche an die Elternschaft und ungeklärte Konflikte aus der eigenen Kindheit.
Ein kalter Wintertag in Uerikon ZH. «Es ist gleich da vorne», sagt Jürg Frick und zeigt auf einen weissen Neubau. Dort angekommen, schliesst der Psychologe seine Haustür auf, führt Redaktorin und Fotografen die Treppe hinauf und durch die grosse Stube in sein Behandlungszimmer, wo er normalerweise seine Patienten empfängt. Heute erzählt er uns hier über seine Erkenntnisse aus der Geschwisterforschung.
Herr Frick, Eltern haben ihre Kinder alle gleich lieb, oder?
Das ist der Anspruch aller Eltern – die Realität sieht oft anders aus.
Eine überraschende These.
Die von Studien belegt wird. Ein Kind steht Mutter oder Vater meist – oder zumindest vorübergehend – näher als das andere. Kinder sind individuelle Persönlichkeiten mit einer breiten Palette von Eigenschaften, Verhaltensweisen, Neigungen und einem charakteristischen, unverwechselbaren Aussehen. Und all das trifft auf die unbewussten Erwartungen, Vorlieben, Abneigungen und Erfahrungen der Eltern. Die Tochter zum Beispiel verhält sich ähnlich wie die geliebte Mutter, während der Sohn dem verhassten Vater ähnelt. Durch solche Assoziationen lösen Kinder unbewusst starke Projektionen, Gefühle und Wünsche auf die vorgeprägten Eltern aus.

Gibt es das typische Lieblingskind?
Eltern bringen in der Regel für diejenigen Kinder am meisten Sympathie auf, die ihnen am ähnlichsten sind. Aber nicht nur! Familienkonstellationen sind immer ein komplexes Konstrukt, und es gilt genau hinzuschauen, wie die mütterliche und die väterliche Seite dort hinein spielen.
Offen zuzugeben, dass man ein Kind lieber hat, gehört zu den Tabus des Elternseins.
Richtig. Und hängt mit der Vorstellung zusammen, dass Eltern immer gerecht und fair sein sollen, sonst ist man keine gute Mutter beziehungsweise kein guter Vater. Aber sich immer in dieser Weise zu verhalten, ist schlicht unmöglich. Wenn man sich dennoch an diesem Anspruch misst, bekommt man schnell einmal Schuldgefühle.
In früheren Zeiten hat es doch viele Vernachlässigungen gegeben, beispielsweise weil man sich anstatt eines Mädchens einen Jungen als Stammhalter gewünscht hatte.
Und dorthin will keiner zurück. Mir geht es vielmehr um die Überhöhung der Elternschaft, die zu hohen Perfektionsansprüche. Heutzutage muss ich meine Kinder permanent lieben, alle gleich behandeln, Zeit haben für sie und sie optimal fördern, und das alles 24 Stunden am Tag.
Eltern, die mehrere Kinder haben, wissen, wie schwer es ist, auf alle immer gleich stark einzugehen.
Ja, aber es ist gar nicht nötig und auch nicht möglich, diesen Anspruch zu erfüllen! Wenn man das machen würde, würde man dem Kind beibringen: alle meine Wünsche und Bedürfnisse werden immer sofort erfüllt! Das ist nicht sinnvoll. Natürlich, je jünger ein Kind ist, desto eher muss man zeitnah seine Bedürfnisse befriedigen. Eine 2-Jährige kann sich morgens ihr Konfibrot nicht selbst schmieren, eine 6-Jährige schon.
Bevorzugungs- und Ablehnungsprozesse geschehen unbewusst.
Jürg Frick, Psychologe.
Wie sehr schaden Eltern ihrem Kind, wenn sie das Geschwister vorziehen?
Erst einmal: bewusste Benachteiligungen sind sehr selten. Bevorzugungs- und Ablehnungsprozesse laufen in der Regel unbewusst ab. Nun kommt es darauf an, wie intensiv meine Gefühle als Mutter beziehungsweise Vater sind, wie sehr sie mehr Probleme und dann wieder mit dem anderen – oder nur in bestimmten Situationen. Das ist ganz normal und erst einmal kein Grund zur Beunruhigung.
Und wenn Eltern ein Kind lieber haben oder eines gar ablehnen?
Dann ist das natürlich ein Problem. Das Kind bekommt nicht das, was es braucht, dass man es akzeptiert und gern hat. Die grosse Aufgabe für Eltern ist in dem Fall, sich dies bewusst zu machen und ihre Gefühle nicht zu verdrängen – und sich vielmehr zu fragen, warum man sich einem Kind weniger nah fühlt als dem anderen und was das mit einem selbst zu tun hat. Und sie sollten unbedingt versuchen, auch einen Zugang zu diesem Kind zu finden. Entscheidend ist weniger die Frage, ob man diese Gefühle hat, sondern wie man mit ihnen umgeht und daran arbeitet.
Und wenn diese Gefühle anhaltend sind? Soll ich mit meinen Kindern darüber sprechen?
Ich halte es für sinnvoll, erst einmal selbst über die Bücher zu gehen und sich gegebenenfalls professionelle Hilfe zu holen. Das Kind versteht ja nicht, wenn ich sage: «Ich ärgere mich über dich, weil du mich an deine Grossmutter erinnerst, die hatte auch nie die nötige Geduld, etwas zu Ende zu bringen.» Besser wäre: «Ich merke, ich habe mich gestern nicht fair verhalten, aber das hat nichts mit dir zu tun.»
Eine Freundin hat mir einmal erzählt, dass sie ihre beiden Kinder liebe, sich aber ihrer älteren Tochter etwas näher fühle als der jüngeren. Die Grosse sei ihr vom Wesen ähnlicher. Um nicht ungerecht zu werden, führe sie deshalb eine Art innere Buchhaltung: Hat gestern die Grosse die Kerze vor dem Abendessen anzünden dürfen, ist heute die Kleine dran.
Ich finde es sehr gut, dass Ihre Freundin so bewusst mit dem Thema umgeht.
Aber Kinder haben feine Antennen für Vorlieben und Ungerechtigkeiten, spüren sie diese Gefühle nicht trotzdem?
Mitunter schon, ja. Kinder «lesen» auf einer intuitiv-vorbewussten Ebene die Gefühle der Eltern, die Mimik und Gestik der Elternteile jedem einzelnen Kind gegenüber – und sie ziehen daraus ihre persönlichen Schlüsse. Für die Auswirkungen auf das kindliche Fühlen, Denken und Handeln spielt es eine geringere Rolle, ob die Mutter oder der Vater das Geschwister tatsächlich vorgezogen hat. Entscheidend ist, wie das Kind das Ganze wahrnimmt. Mit anderen Worten: manchmal haben Kinder das Gefühl, etwas zu spüren, was dann gar nicht so ist.
Kinder beklagen sich häufig: «Du hast mich nicht lieb, sonst dürfte ich dieses oder jenes … der andere durfte es auch.»
Kinder schliessen aus der Erziehungshaltung der Eltern, dass man sie nicht gern hat. Aber natürlich sind klare Bevorzugungen beziehungsweise Benachteiligungen ein Problem.
Wie reagiert man auf solche kindlichen Vorwürfe?
Das hängt vom Alter des Kindes und vom Kontext ab. Und natürlich von den eigenen Gefühlen. Man könnte zum Beispiel fragen: «Wie kommst du darauf ?» Dann antwortet das Kind wahrscheinlich so etwas wie: «Weil ich das nicht bekomme.» Oder: «Weil ich jetzt schon ins Bett muss und der/die andere nicht.» Dann würde ich entgegnen: «Ja natürlich, du bist auch jünger. Als deine Geschwister so alt waren, mussten sie auch früher ins Bett. Und ich habe dich lieb.»
Gesetzt den Fall, das Kind irrt sich nicht. Kann der andere Elternteil dies auffangen?
Ja, das geht ein Stück weit. Wenn derjenige sich nicht vom Kind ausspielen lässt, sondern versucht, ihm den Standpunkt des anderen Elternteils verständlich zu machen: «Ja weisst du, Mama hat dich lieb, aber sie hatte es gerade eilig …» Wichtig ist auch, dieses Kind zu bestärken, ihm das Gefühl zu vermitteln, dass man es mag, stolz auf es ist.
Besonders tragisch wird es, wenn beide Elternteile das Kind ablehnen, es zum Sündenbock abstempeln, dann wird es nicht selten zu dem, was in es hineinprojiziert worden ist: Es wird schliesslich launisch, aggressiv, frech und überempfindlich.

Ist es eher der Erstgeborene, der von den Eltern bevorzugt wird, oder doch das Nesthäkchen? Und was ist mit dem Sandwichkind?
In unseren Breitengraden spielt diesbezüglich die Geschwisterfolge oder das Geschlecht keine entscheidende Rolle mehr. Anders ist das in patriarchalisch geprägten Gesellschaften. Dort geniesst der männliche Stammhalter in der Familie noch immer einen Sonderstatus. Ebenso wenig kann man sagen, ob es eher Mütter oder Väter sind, die ein Kind dem anderen vorziehen. Präferenzen hängen vielmehr von den biografischen Erfahrungen ab, die Eltern im Laufe ihres Lebens machen.
Welches sind die Folgen für das benachteiligte Kind?
Das ist sehr unterschiedlich. Haben Kinder dauerhaft das Gefühl, nicht gemocht zu werden, kann das zu persönlichen Problemen führen, zu Minderwertigkeitskomplexen, in schweren Fällen zu Depression, Rückzug, psychosomatischen Beschwerden und Aggressivität. Andererseits haben Kinder Verständnis für Ungleichbehandlungen, solange diese sachlich erklärt werden und für sie verständlich sind, beispielsweise mit dem Altersunterschied oder einer Krankheit, unter welcher das Geschwister leidet.
So gibt es Menschen, die als Kinder benachteiligt worden sind und damit umgehen können. Oder sie nehmen im Erwachsenenalter eine psychologische Beratung in Anspruch und klären das für sich. Oftmals können sie dann verstehen, warum die Eltern so gehandelt haben, und ihnen auch ein Stück weit verzeihen.
Das wäre der Optimalfall.
Das stimmt. Es gibt aber auch Menschen, die ihr ganzes Leben unter dieser Benachteiligung leiden. Im Extremfall kämpfen sie gegen die ganze Welt, indem sie die Ablehnung, die sie erlebt haben, auf alle anderen übertragen. Manche Betroffene sind nur am Jammern, sehen sich ständig als Opfer oder ziehen sich zurück. Sie tragen eine Art Brille mit einer starken Trübung – diese weicht massiv von der Realität ab.
Was macht das mit dem Geschwisterverhältnis?
Eine andauernde Vorzugsbehandlung eines Kindes kann die Geschwisterbeziehung massgeblich und schwerwiegend beeinträchtigen: Von spitzen Bemerkungen über permanente Konkurrenz und Eifersucht bis zu jahrelangem oder lebenslänglichem Kontaktabbruch zwischen Geschwistern finden sich unzählige Varianten und Entwicklungen.
Manche Betroffene, Bevorzugte und Benachteiligte, können das Erlebte aber auch später mit ihren Geschwistern thematisieren, sich darüber austauschen und hinterher besser verstehen, warum die Eltern so reagiert haben.
Ab einem gewissen Alter kann man seinen Geschwistern aus dem Weg gehen.
Das können Sie schon, aber Ihren Geschwisterkonflikt nehmen Sie mit. Solange Sie nichts dagegen unternehmen, beschäftigt Sie das weiterhin unterbewusst. Und spätestens wenn die Eltern Hilfe brauchen oder sterben, müssen sich die Geschwister wieder zusammensetzen und dann werden die alten, ungelösten Konflikte wie auf Knopfdruck wieder aktualisiert.
Wer als Kind bevorzugt wurde, denkt, die ganze Welt richtet sich nur nach ihm.
Jürg Frick, Psychologe.
Gibt es auch Nachteile für das bevorzugte Kind?
Oh ja. Derjenige, der immer bevorzugt wird, lernt: Er ist der Privilegierte. Er erwartet diese Vorzugsbehandlung später auch in Beziehungen, Partnerschaft, im Beruf usw. im Sinne von: Die Welt richtet sich nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Das schafft für ihn Probleme, er wird korrumpiert. Das ist später ein Nachteil, denn in der Regel tanzt eben nicht die ganze Welt nach meinen Vorstellungen. Oft haben diese Menschen eine grosse Unempfindlichkeit gegenüber Ungerechtigkeiten. Es geht bis zu narzisstischen Selbstüberhöhungen mit egomanen Vorstellungen.
Und im Kindesalter?
Es kommt darauf an. Es gibt Kinder, die diese Vorzugsbehandlung als unangenehm empfinden, weil sie dadurch auch Nachteile haben: Die Geschwister bilden Koalitionen gegen Mamis oder Papis Liebling. Jeder Fall ist individuell gelagert, aber in der Regel zahlt das ständig bevorzugte Kind später einen hohen Preis.
Sie machen einen grossen Unterschied zwischen gleicher und fairer Behandlung von Kindern. Was heisst das?
Nach der Vorstellung vieler Eltern und auch Lehrpersonen behandelt man Kinder gerecht, wenn man alle gleich behandelt. Aber dem ist nicht so. Man muss Kinder nicht gleich behandeln, sondern ihnen das geben, was sie brauchen. So behandelt man seine Kinder altersgerecht und fair.
Wie meinen Sie das?
Nehmen wir das engste Beispiel: Zwillinge. Der eine sagt beim Mittagessen: «Ich möchte nichts mehr essen.» Der andere hat noch Hunger. Dann isst der Hungrige eben weiter und sein satter Bruder leistet ihm Gesellschaft oder geht spielen. Aber ich koche als Vater oder Mutter für denjenigen, der meint, er sei satt, nicht 15 Minuten später ein neues Menü. Eltern sollen mehr von dem ausgehen, was ihre Kinder brauchen. Sie sollten primär von ihren Bedürfnissen ausgehen, nicht einfach nur von ihren Wünschen.
Was beim Nachwuchs oft Wut auslöst.
Eine natürliche Reaktion: «Du bist gemein», «du blödes Mami», «du hast mich nicht gern, sonst dürfte ich auch» … Jetzt ist die Frage: Wie stabil bin ich als Mutter oder als Vater, komme ich innerlich in Aufruhr? Oder halte ich das aus und kann ruhig sagen: «Wie kommst du darauf ? Das ist gar nicht möglich, dass ich dich nicht gern habe. Ich habe dich gern.» Oder reagiere ich verunsichert und frage mich, ob ich überhaupt eine gute Mutter, ein guter Vater bin? Eltern müssen so etwas aushalten können. Dies ist für beide Seiten ein Konfliktlösungstraining!
Ergänzen Sie für uns doch bitte folgenden Satz: Kinder brauchen Eltern, die …
… Zeit haben und die ihre Kinder ermutigen, ihnen etwas zutrauen, sie unterstützen, und zwar nicht nur finanziell. Sie brauchen Eltern, die zuhören, mit ihnen etwas unternehmen und sich auch für ihre Probleme Zeit nehmen. Wissen Sie, es ist mir sehr wichtig, dass wir das Thema «Lieblingskind» moralfrei und ohne Schuldzuweisungen anschauen und nach einer pragmatischen Lösung suchen. Eltern sollten sich viel mehr anderen Eltern gegenüber öffnen und sich über ihre Probleme und Unsicherheiten austauschen. Dann wäre vielen geholfen.