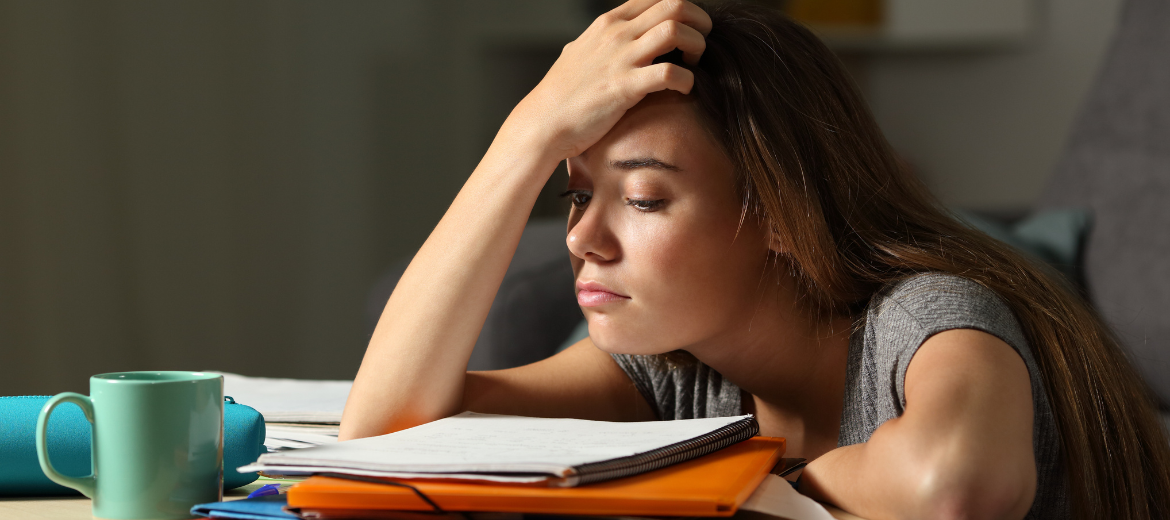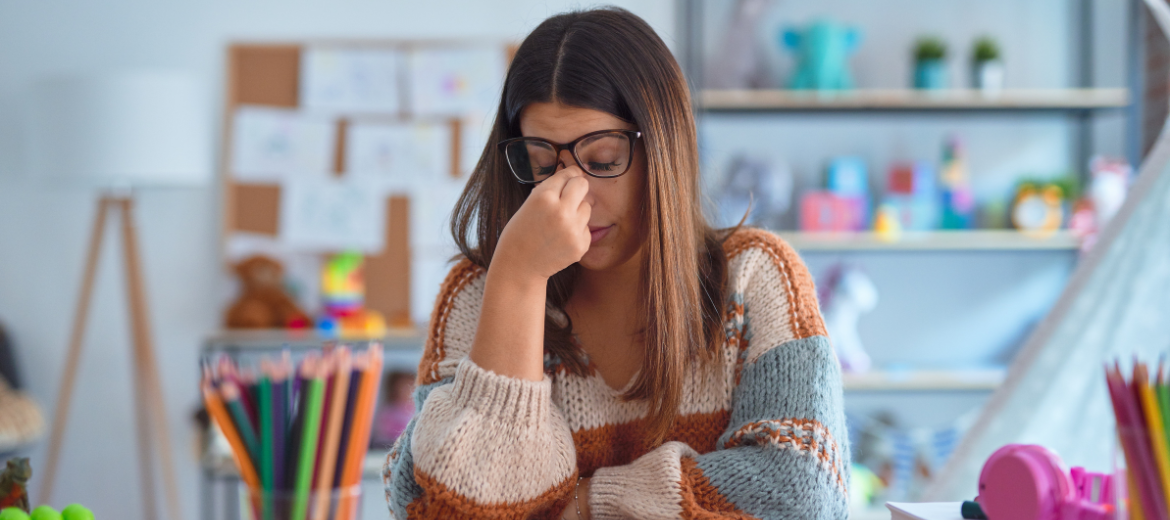Welcher Aufschiebetyp sind Sie?

Morgen ist auch noch ein Tag: Hinter dem Verhalten, anstehende Aufgaben wider besseren Wissens ständig hinauszuzögern, können verschiedene Gründe stecken.
Die meisten von uns kennen den Kampf gegen den inneren Schweinehund. Die einen schieben die Steuererklärung bis zum letzten Augenblick vor sich her, andere nehmen sich fest vor, endlich Sport zu treiben, nur um ihren Entschluss immer wieder zu vertagen. Und wieder andere vermeiden unangenehme Gespräche. Unsere Kinder erledigen ihre Hausaufgaben auf den letzten Drücker oder warten mit der Prüfungsvorbereitung so lange, bis es (fast) zu spät ist.
Doch warum schieben wir auf? Schliesslich sorgen wir damit für jede Menge Stress, ein schlechtes Gewissen und manchmal auch handfeste negative Konsequenzen.
Hinter dem Aufschieben steckt ein einfacher, aber sehr wirkmächtiger Mechanismus. Eine Aufgabe löst unangenehme Gefühle aus: Druck, Unsicherheit, Langeweile, Ärger, Scham. Sobald wir sie vertagen, können wir uns diesen Empfindungen für einen Moment entziehen und fühlen uns erleichtert. Je öfter wir das tun, desto stärker trainieren wir die entsprechenden Muster in unserem Gehirn. Mit der Zeit haben wir verinnerlicht: Wenn du deinen Stress reduzieren möchtest, schieb auf!
Damit Aufschieber sich selbst helfen können, müssen sie verstehen, weshalb sie genau dieser Aufgabe aus dem Weg gehen.
Rational wissen wir, dass uns das langfristig schadet. Das Problem: Unser Gehirn gewichtet kurzfristige Konsequenzen viel stärker. Bei Kindern und Jugendlichen ist dies noch ausgeprägter der Fall. Erst mit der Zeit reifen die Gehirnbereiche aus, die es uns erlauben, Belohnungen aufzuschieben, die Zukunft stärker mit einzubeziehen und langfristige Folgen abzuschätzen.
Aber auch dann gelingt es den allerwenigsten Erwachsenen, über längere Zeit etwas Unliebsames zu tun. Wer regelmässig joggen geht, Geld investiert anstatt ausgibt, sich gesund ernährt oder sehr organisiert ist, hat höchstwahrscheinlich irgendwann gelernt, diese Dinge gerne zu tun.
Wenn das Aufschieben zum Problem wird
Uns alle kann es belasten, wenn wir am Abend nicht alles geschafft haben oder einige Punkte auf der To-do-Liste einfach nicht verschwinden wollen. Das ist normal und ein Zeichen dafür, dass wir aufgrund unserer begrenzten Zeit gezwungen sind, Prioritäten zu setzen. Problematisches Aufschieben beginnt dort, wo man nicht irgendwelche Aufgaben vor sich herschiebt, sondern die wichtigste – und mit der Zeit massiv darunter leidet.
Betroffene schaffen es nicht, rechtzeitig mit der Prüfungsvorbereitung oder ihrer Abschlussarbeit zu beginnen und können ihre Ausbildung deswegen nicht beenden. Sie verlieren ihren Job oder Aufträge, weil sie nicht rechtzeitig fertig werden. Sie belasten ihre Beziehungen, weil man sich nie auf ihr Wort verlassen kann.
Mit der Zeit nagt der Eindruck, nichts auf die Reihe zu kriegen und den Anforderungen nicht entsprechen zu können, am Selbstwertgefühl. Bei Workshops an der Universität Freiburg konnten Stefanie Rietzler und ich oft beobachten, wie sich Studierende mit chronischen Aufschiebeproblemen aus ihren Beziehungen zurückzogen.
Sie gingen nicht mehr in die Vorlesung, reagierten nicht auf E-Mails ihrer Betreuenden, die auf ihre Arbeit warteten, und besuchten ihre Familien kaum mehr, um unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen. So oft hatten sie versprochen, sich zu bessern, dass sie anderen kaum mehr unter die Augen treten konnten. Aus dieser Spirale entstehen nicht selten Depressionen, Angststörungen und Suchterkrankungen.
Was nicht hilft: Druck und Planen
Chronisches Aufschieben stösst im Umfeld der Betroffenen oft auf massives Unverständnis. «Du musst einfach besser planen!», «Ich weiss gar nicht, wo das Problem ist. Klar hat man nicht auf alles Lust, aber dann setzt man sich halt einfach hin und machts», «Jetzt teilst du es in kleine Portionen ein und schreibst es dir in die Agenda» oder «Der muss einfach mal auf die Nase fallen, dann lernt er es schon» sind typische Aussagen von Eltern, Lehrkräften und manchmal sogar Therapeuten.
Je impulsiver eine Person ist, desto eher neigt sie zu Prokrastination.
Prokrastinierende haben aber meist kein reines Planungsproblem: In der Regel wissen sie, wie man sich eine Aufgabe in den Kalender schreibt, und haben dies schon tausendmal getan. Nur machen sie in den verplanten Zeitfenstern trotzdem etwas anderes. Appelle von aussen, Druck und Enttäuschung vonseiten der Lebenspartner oder Eltern sorgen meist nicht für mehr Motivation, sondern lassen die entsprechende Aufgabe noch grösser, belastender und lähmender erscheinen und verstärken den Drang, dieser noch einmal zu entkommen.
Damit Aufschieber sich selbst helfen können, müssen sie verstehen, weshalb sie genau dieser Aufgabe aus dem Weg gehen. Erst dann können sie aufhören, sich dafür zu verurteilen, und Lösungen suchen, die zu ihnen passen.
Obwohl es bei jeder Form von Aufschieben letztlich darum geht, unangenehme Gefühle zu vermeiden, gibt es drei zentrale Gründe dafür:
1. Mangelnde Bedeutsamkeit
«Warum muss ich das lernen? Das braucht doch kein Mensch!», «Das können die doch nicht von mir verlangen!», «Wenn ich nur schon daran denke, dass ich dann auch noch in diesem Beruf weiterarbeiten muss …». Manchmal prokrastinieren wir, weil wir eine Aufgabe schlicht nicht wertvoll finden: Wir müssen Erwartungen erfüllen und Aufträge abarbeiten, die wir als unsinnige Zeitverschwendung ansehen. Solange ihnen das Endziel wichtig ist, gelingt es aber vielen Aufschiebern, sich mithilfe geeigneter Methoden doch noch zu überwinden: «Ich hasse dieses Fach zwar aus tiefstem Herzen, aber ich will den Abschluss und deswegen mache ich, was nötig ist!» Schwieriger wird es, wenn sowohl die Aufgabe als auch das Fernziel nur mit Widerwillen verbunden sind. Immer wieder hatten wir in unseren Workshops beispielsweise junge Menschen, die sich den Eltern zuliebe für ein Studium entschieden hatten, das sie gar nicht interessierte.
2. Unsicherheit
Mangelnde intrinsische Motivation ist aber nicht der einzige Grund für Prokrastination. Gerade Menschen, die ihren Träumen folgen, schieben besonders häufig auf, darunter berühmte Komponisten, Schriftstellerinnen, Maler und Selbständige aller Art. Oft weichen sie der Aufgabe nicht aus, weil sie ihnen nicht wichtig ist – sondern weil sie sich ihr nicht gewachsen fühlen. Dann werden mit dem Aufschieben vor allem Unsicherheit, Hilflosigkeit und Ängste bis hin zu Panik vermieden. Typische Gedanken lauten «Ich schaff das nicht!», «Schreiben konnte ich noch nie!», «Das ist so ein riesiger Berg!» oder «So kann ich das noch nicht abgeben!».
3. Impulsivität
Zu guter Letzt zeigt die Forschung, dass ein Persönlichkeitsmerkmal sehr stark zu Prokrastination beiträgt: Je impulsiver eine Person ist, desto schlechter gelingt es ihr, kurzfristige Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, um ein langfristiges Ziel zu erreichen. Impulsive Menschen möchten vor allem langweiligen Aufgaben entfliehen: «Ich habe jetzt keine Lust …», «Das ist so ätzend», «Ich mache noch kurz etwas anderes, vielleicht geht es danach besser».
Wie ist das bei Ihnen? In den nächsten Kolumnen lesen Sie, was den verschiedenen Aufschiebetypen hilft.