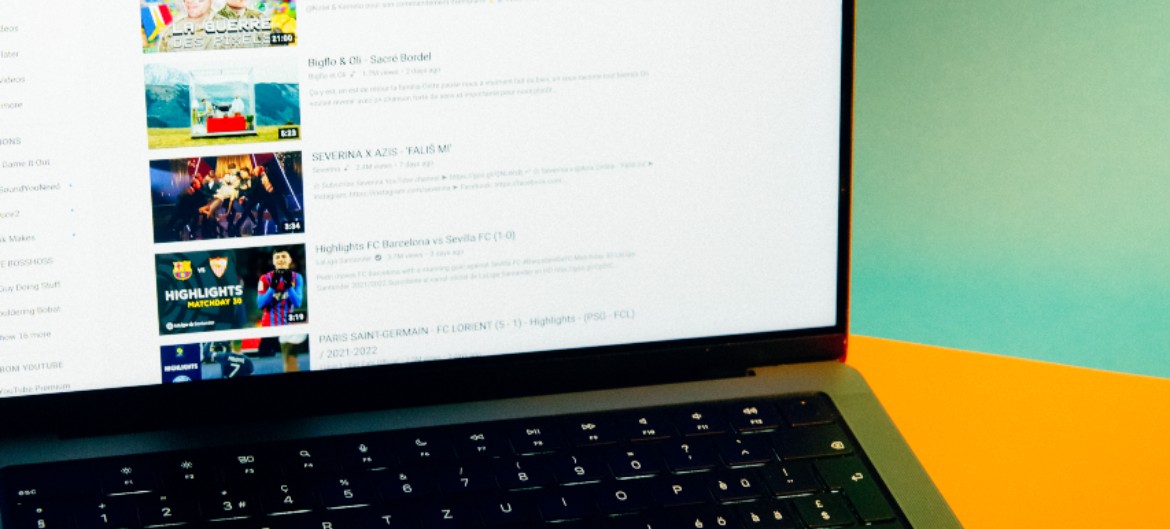Gamen: Wie gehen Eltern am besten damit um?

Gamen übt eine grosse Faszination auf Kinder und Jugendliche aus. Viele von ihnen tauchen in ihrer Freizeit komplett in virtuelle Welten ab. Was fesselt sie so daran? Wo liegen die Gefahren? Lernen sie etwas dabei? Und wie schaffen es Eltern, dass die Game-Zeit nicht vollends ausufert?
Noch fünf Minuten, dann ist Schluss! «Jahaa, gleich …», ruft das Kind. Und taucht schon wieder ein in seine virtuelle Welt. Baut mit klötzchenartigen Elementen an einem Palast weiter. Schleicht sich mit gezückter Waffe an Feinde heran. Oder tüftelt an seiner Wunsch-Fussballmannschaft herum.
Es ist eine Szene, wie sie wohl viele Eltern kennen. Denn Gamen gehört zum Alltag der meisten Schulkinder und Teenager: Vier von fünf Jugendlichen gamen zumindest ab und zu. Betrachtet man nur die Jungs, sind es gar 93 Prozent, bei den Mädchen 65 Prozent. Dies zeigt die James-Studie 2022 der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), die das Mediennutzungsverhalten von 12- bis 19-Jährigen in der Schweiz untersuchte. Doch schon Primarschulkinder zocken gern: Das Gamen ist bei ihnen von allen digitalen Medientätigkeiten die beliebteste, wie aus einer anderen Studie der ZHAW – der Mike-Studie aus dem Jahr 2021 – hervorgeht.
Beim Gamen geht es um Gefühle von Macht und Kontrolle. Aber auch darum, sich kompetent zu fühlen.
Marc Bodmer, Game Consultant
Was aber macht das digitale Spielen für Kinder und Jugendliche so attraktiv? Worin genau liegt dessen Reiz? «Gamen vermittelt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, das ist ganz zentral», sagt Marc Bodmer. Er ist Game Consultant, Journalist mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Videogames und selbst passionierter Spieler. Als solcher weiss er: «Dass sich meine Figur auf dem Bildschirm nach rechts bewegt, wenn ich den Joystick nach rechts drücke: Allein dieser Fakt funktioniert tief drin.» Es gehe um Gefühle von Macht und Kontrolle. Aber auch darum, sich kompetent zu fühlen: «Ich merke beim Gamen: Ich kann das, ich schaff das, ich bin gut.»
Ähnlich beschreibt es Medienwissenschaftler Florian Lippuner: «Im Game bin ich die handelnde Person.» Bei Filmen oder Büchern sei das anders, diese konsumiere man passiv. Dagegen schreibe man im Game die Geschichte selbst: «Ich kann entscheiden, was ich als Nächstes tue.» Dass ein Spiel dabei in erster Linie Spass machen und unterhalten müsse, sei aber eine Vorbedingung. Darüber hinaus hänge es von dessen Art ab, welchen Reiz es ausübe und welche Bedürfnisse es stille. «Bei Shooter-Games geht es um Action, Wettkampf und Nervenkitzel.» Bei sogenannten Open-World-Games wie Minecraft, einer Art digitales Lego, stehe eher kreatives Austoben im Vordergrund.
Man kann Fortnite spielen und sich aufs Bauen konzentrieren. Oder darauf, mit Freunden zu chatten.
Florian Lippuner, Medienwissenschaftler
Games bedienen viele Bedürfnisse
Viele Games lassen es aber auch zu, unterschiedlichen Neigungen nachzugehen. «Als Teenager spielte ich oft Ego-Shooters auf tropischen Inseln – weil ich es liebte, durchs Unterholz zu schleichen und nach Tieren Ausschau zu halten», so Lippuner. Und Fortnite, ein klassisches Shooter-Game, sei unter anderem deshalb so erfolgreich, weil es auch Konstruktionsmöglichkeiten biete, ähnlich wie Minecraft. «Man kann Fortnite spielen und sich aufs Bauen konzentrieren. Oder darauf, mit Freunden zu chatten. Die Kampfhandlungen werden dann vielleicht nebensächlich.»

Den sozialen Aspekt betont auch Bodmer. «Videospiele sind wie soziale Netzwerke mit gemeinsamem Nenner, dem Spiel.» So sprechen Gamer und Gamerinnen laut Bodmer über alles Mögliche, während sie Juwelen suchen oder gegen Zombies kämpfen. «Reden sie über ihr Spiel, können Aussenstehende zudem oft nicht folgen.» Oder hielten sie für verrückt, wenn sie über scheinbare Absurditäten wie blutsaugende Skelette diskutierten. Doch: «Wer gamt, tritt in einen magischen Kreis mit eigenen Regeln ein. Auch das macht den Reiz aus.»
So vermitteln Games soziale Verbundenheit – gerade Multiplayer-Games, die einen mit anderen oder gegeneinander spielen lassen. Games erzeugen zudem ein Gefühl von Kompetenz, wenn man es aufs nächste Level schafft. Und indem Spielende sich als Handelnde erleben, die mit ihrem Avatar Welten erkunden, fühlen sie sich selbstbestimmt.
Bewusste Anreize, um beim Gamen dranzubleiben
Verbundenheit, Kompetenz und Autonomie: Das sind menschliche Grundbedürfnisse, die gemäss der psychologischen Theorie der Selbstbestimmung für Motivation und Wohlbefinden zentral sind. Je besser ein Game dem Spieler oder der Spielerin entspricht, vermuten Forschende, desto motivierender funktioniert es. Spieleentwickler machen sich das psychologische Fachwissen zunutze und kreieren oft Spiele, die auf entsprechende Bedürfnisse eingehen.
So passen sich viele Games etwa dem individuellen Spielniveau an, sind also weder über- noch unterfordernd, sondern bieten genau das richtige Mass an Herausforderung. Manche Spiele lassen Neulinge gegen Bots, also KI-gesteuerte Gegner, antreten und gewinnen – um sie nicht schon zu Beginn zu frustrieren.
Viele Eltern meinen, sie seien die einzigen, die es nicht im Griff hätten. Doch alle kämpfen.
Fabienne Marbach, Projektleiterin Akzent Luzern
Laufend erteilen Games zudem zeitnahes Feedback über den eigenen Fortschritt sowie Erfolge und Belohnungen. Mechanismen wie diese verstärken die Bindung von Gamenden ans Spiel und begünstigen das Einsetzen eines Flows. Ausschalten kann dann umso schwieriger werden, gerade für Kinder und Jugendliche, deren Selbstkontrolle noch nicht voll ausgebildet ist.
Allerdings: Die Zeit, die Jugendliche mit Gamen verbringen, ist in den letzten zehn Jahren so gut wie konstant geblieben. An Wochentagen sind es der James-Studie zufolge – gemäss Selbsteinschätzung – im Schnitt 1 Stunde und 41 Minuten, am Wochenende oder in den Ferien 2 Stunden und 40 Minuten. Doch so konstant wie die Zahlen zur Gaming-Dauer, so konstant sind wohl auch die Diskussionen in den Familien: Wann kippt es von «viel» zu «zu viel»? Und an welchem Punkt ist die Reissleine zu ziehen?
Wenn der Game-Streit eskaliert
Matthias Gysel, Berater beim Elternnotruf, kennt diese Sorgen: Gamen sei neben Bildschirmzeit ein häufiger Grund, weshalb Eltern sich meldeten. «Viele berichten, ihr Kind mache nichts anderes mehr. Sie hätten dauernd Streit deswegen, befürchteten, den Zugang zu verlieren, wüssten nicht mehr, was tun.» So spüre er oft Hilf- und Machtlosigkeit dem Thema gegenüber. «Und manchmal laufen Kontakte zum Kind nur noch über diese Auseinandersetzung. Das ist zermürbend und erhöht das Stressniveau in der Familie enorm.»
Und dann stampfen Eltern halt doch ausser sich ins Teenagerzimmer – kurz davor, die Konsole aus dem Fenster zu schmeissen, weil wieder mal stundenlang nur gegamt wird. «Eltern spüren nicht selten heftige Gefühle, kommen in Rage und Verzweiflung, weil sie sich der Situation ausgeliefert fühlen», sagt Matthias Gysel, Berater beim Elternnotruf. Kochen die Gefühle beidseitig hoch, ist die Eskalation zum Greifen nah. «Eine sofortige Lösung zu finden, ist dann gar nicht möglich.»
Gysel rät aufgebrachten Eltern stattdessen, bei einer drohenden Eskalation zuerst Distanz zu schaffen und zeitverzögert zu reagieren. Sie könnten mit dem Kind also in einer ruhigen Minute vereinbaren: «Wenn es zu so einer Situation kommt, verlasse ich den Raum und wir beruhigen uns erst mal. Zu einem späteren Zeitpunkt setzen wir uns in Ruhe zusammen und kommen auf das Thema zurück.» So sei es viel eher möglich, eine gemeinsame Lösung zu finden.
Einmal besprochen, läuft es mit dem Gamen problemlos? Das würde man sich wünschen, aber: «Man muss das Thema immer wieder anschauen. Es braucht Beharrlichkeit, um aus diesem Muster auszubrechen», so Gysel. Helfen könne, sich Dinge zu vergegenwärtigen, die in der Familie gut laufen. «Dies löst das Problem nicht, ist aber stärkend für die Beziehung und lässt einen künftigen Streit besser aushalten.»
Weil viele Eltern nach einer Eskalation anrufen, muss Gysel sie oft erst beruhigen. Nicht wenige äusserten die Sorge, ihr Kind sei süchtig. Gysel fragt sie dann, was es neben dem Zocken sonst noch macht. «Treibt es Sport? Trifft es Freunde offline? Geht es zur Schule und macht Hausaufgaben? Oder zieht es sich komplett zurück?» Nach genauem Nachfragen merke er meist, dass noch eine Balance vorhanden sei. «Dass ich das Gamen weniger bedrohlich finde, solange es nur einen Teil der Freizeitgestaltung ausmacht, ist für Eltern oft beruhigend», sagt der Berater.
Auch Fabienne Marbach stellt immer wieder fest, wie sehr das Thema Eltern beschäftigt. Als Projektleiterin bei Akzent Prävention und Suchttherapie Luzern führt sie regelmässig Elternveranstaltungen zum Umgang mit digitalen Medien an Primarschulen durch. «Viele Eltern meinen, sie seien die einzigen, die es nicht im Griff hätten. Kommen sie an unsere Anlässe, sehen sie, dass alle kämpfen.»

Altersempfehlung als Richtwert
Nicht nur die Gaming-Dauer treibt Eltern von Primarschulkindern um, sondern auch Sorgen zur Altersangemessenheit von Spielen. Fortnite etwa sei ab zwölf Jahren zugelassen. Dennoch spielten es oft schon Zehnjährige. «Ich rate in diesem Fall, das Kind wirklich gut zu begleiten», so Marbach. «Nur so lässt sich beurteilen, wie es damit umgehen kann.»
Als sakrosankt einstufen möchte sie Altersempfehlungen nicht. «Sie sind ein Richtwert, doch jedes Kind ist individuell.» Es sei daher wichtig, sich über Spiele zu informieren und abzuwägen, ob das eigene Kind dazu bereit sei. Doch warnt sie auch vor der Idee eines hundertprozentigen Schutzes. «Man kann alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen und -einstellungen vornehmen. Und dann kommt das Kind vielleicht doch über andere Wege in Kontakt mit unangemessenem Inhalt, etwa bei Freunden.» Wichtig sei es für Eltern, gleichzeitig Offenheit zu zeigen – damit ein Kind sich getraue, belastende Dinge zu erzählen – und trotzdem klar Haltung zu beziehen.
Natürlich macht Gamen aggressiv. Doch auch beim Fussballspielen kann man hässig werden.
Florian Lippuner, Medienwissenschaftler
Fifa macht aggressiver als alle Shooter-Games zusammen
Noch eine Frage steht beim digitalen Spielen oft im Raum. Etwa, wenn vor Wut fast die Playstation kaputtgeht: Macht Gamen aggressiv? «Natürlich», sagt Medienwissenschaftler Florian Lippuner. «Man muss nur eine halbe Stunde gamen, dann merkt man es selbst.» Dabei mache die Fussballsimulation Fifa übrigens aggressiver als alle Shooter zusammen. «Doch Kinder müssen lernen, auch mit negativen Gefühlen umzugehen.» Damit trainierten sie ihre Frustrationstoleranz.
«Auf dem Fussballplatz wird man auch hässig, wenn man verliert. Trotzdem sagen Eltern nie: Hör auf mit Fussballspielen.» Und stets sei zu betonen: «Aggressive Gefühle sind nicht gleichzusetzen mit physischer Gewalt.» Die Gleichung, wer game, laufe Amok, sei schlicht falsch.

Ob und wie sich virtuelles Blutvergiessen in Ego-Shooter-Games auf Spielerinnen und Spieler auswirkt, ist seit Langem Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Spätestens seit dem Amoklauf an der Columbine High School vor 25 Jahren wird die Frage immer wieder auch öffentlich debattiert – denn die Täter hatten exzessiv Ego-Shooters gespielt.
«Inzwischen haben zahlreiche Studien den Kausalzusammenhang zwischen Gewalt im Spiel und in der Realität widerlegt oder einen marginalen Zusammenhang aufgezeigt», sagt Game Consultant Marc Bodmer.
Gewaltspiele allein führen nicht zu gewalttätigem Verhalten
So fand vor wenigen Jahren auch eine Meta-Analyse von Forschenden der neuseeländischen Massey University keinen Zusammenhang zwischen Shooter-Games und Aggression. In die Analyse eingeflossen waren 28 frühere Studien und Daten von über 21 000 Jugendlichen.
Auf einen kleinen Zusammenhang zwischen Gewaltspielen und aggressiven Handlungen wie Schubsen oder Schreien weist die American Psychological Association hin. Doch für jenen zwischen Gewaltspielen und gewalttätigem Verhalten fand auch sie keine ausreichenden wissenschaftlichen Beweise. Gewalt sei vielmehr ein komplexes soziales Problem, das auf viele Faktoren zurückzuführen sei.
«Man muss Spiele, die Gewalt beinhalten, deshalb nicht gut finden», sagt Bodmer. Doch sei dies eine Wertediskussion. «Kinder können unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Und sie lernen schnell, dass im Spiel andere Regeln gelten.» Dass Eltern sie dabei unterstützen sollten, sei klar. «Genau wie man Kindern auch zeigt, dass man nicht auf einen Regenwurm steht.»
Marc Bodmer gibt nicht nur Workshops im Umgang mit Games für Eltern, Lehrpersonen und Ärzte. Als Game Consultant berät er auch Familien – und ist überzeugt: Bei vielem gehe es schlicht um Erziehung. Auch was In-App-Käufe betrifft: «Es sind die Eltern, die verhindern sollten, dass ihr Kind auf dem Familientablet Einkäufe über ihre Kreditkarte tätigen kann.»
Von In-App-Kauf bis Lootbox
Mit In-App- oder In-Game-Käufen lassen sich vor allem in Gratisspielen Spielvorteile erkaufen. Diese Free-2-Play-Games erwirtschaften damit laut Schätzungen rund 80 Prozent des Umsatzes der digital vertriebenen Spiele. Manchmal lässt sich ein Game nur durch einen entsprechenden Kauf weiterspielen.
Oft geht es auch um Äusserlichkeiten. So lassen sich sogenannte Skins erwerben, mit denen man Charaktere personalisieren kann. Bei Fortnite beispielsweise gibt es fast 1800 Skins. Allein im ersten Jahr soll Hersteller Epic Games mit In-App-Käufen eine Milliarde Dollar eingenommen haben. «Natürlich schütteln Eltern den Kopf und fragen, was das soll», sagt Bodmer. «Es ist aber wie bei Markenkleidern: Es geht um Status, auch im Game.» Und um die Frage, die sich Eltern immer wieder stellen müssen: Was lasse ich zu? Und was nicht?
Anders verhalte es sich mit manipulativen Mechanismen – sogenannten Dark Patterns. Ein Beispiel sind die Lootboxen, eine Art digitale Schatztruhen, die freigeschaltet, gefunden oder gekauft werden können. Sie versprechen die Chance auf seltene Gegenstände, Waffen oder andere Dinge, die beim Spielen Vorteile bringen. Ob man Unbrauchbares oder Wertvolles erhält, ist aber gesteuerter Zufall – und teilweise dem Glücksspiel ähnlich. Das eigene Glück wird dabei meist überschätzt.
Belgien und die Niederlande haben Lootboxen in bestimmten Spielen verboten. In der Schweiz gibt es keine spezifischen Vorgaben. Nur in den wenigsten Fällen fallen sie unter das Geldspielgesetz. «Solche Mechanismen haben in Games nichts verloren», so Bodmer. «Denn sie widersprechen dem Grundprinzip, dass Videospiele kompetenzbasiert sind. Auch können Lootboxen zu problematischem Spielverhalten führen.» Dennoch sei er kein Freund von Verboten, «aber von Medienkompetenz».
Beim Gamen eignet man sich zweifelsohne Fähigkeiten an.
Florian Lippuner, Medienwissenschaftler
Chatfunktion im Auge behalten
Ein weiterer Aspekt, der Medienkompetenz und vorab elterliche Aufmerksamkeit nötig macht, sind die Chatmöglichkeiten vieler Games. Zum einen können Kinder über sie mit unangemessenen Äusserungen, Beleidigungen oder Cybermobbing konfrontiert werden. Zum anderen ermöglichen sie den Kontakt mit Fremden.
Wie soziale Netzwerke bergen Onlinespiele dadurch ein Risiko für Cybergrooming – für den Versuch Erwachsener, im Internet sexuelle Kontakte zu Kindern anzubahnen. Teilweise lassen sich Chatfunktionen deaktivieren oder einschränken. So oder so tun Eltern gut daran, wachsam zu bleiben und dem Kind die Risiken altersgerecht zu vermitteln.
Der Lerneffekt beim Gamen
Games funktionieren also teilweise manipulativ, können ins Geld gehen, aggressiv machen und ein für Cybergrooming riskanter Ort sein. Doch sie haben auch positive Seiten, und dies über Spass und Unterhaltung hinaus: «Es steht ausser Zweifel, dass man sich beim Gamen Fähigkeiten aneignet», sagt Medienwissenschaftler Lippuner.
Für seine Doktorarbeit untersuchte er Biografien von Gamerinnen und Gamern. «Manche erzählten mir, dass das in Strategiespielen nötige logische Denken ihnen in der Schule half. Andere hatten das Gefühl, ihre Hand-Augen-Koordination sei besser geworden.» Auch er selbst sei unglaublich schnell mit der Computermaus. «Das hilft mir auch bei der Arbeit.»

Untersuchungen bestätigen positive Effekte bestimmter Games. Eine oft zitierte Studie des Max-Planck-Instituts liess Erwachsene während zwei Monaten täglich dreissig Minuten das Rennspiel Super Mario 64 spielen. Danach zeigten sie – verglichen mit der nicht gamenden Kontrollgruppe – eine Vergrösserung grauer Substanz in Hirnarealen, die unter anderem für räumliche Orientierung, strategisches Denken und Feinmotorik der Hände zentral sind.
Ein Genfer Forschungsteam wiederum stellte bei Spielerinnen und Spielern von Shooter-Games eine längere Aufmerksamkeitsspanne fest. Auch gibt es Studien, die Actionspiele mit einer verbesserten Reaktions- und Entscheidungsfähigkeit in Verbindung bringen oder Minecraft mit erhöhter Kreativität.
Medienkompetenz von klein auf üben
Florian Lippuner kennt gar Firmen, die gezielt E-Sport-Cracks anwerben – professionelle Gamende, die an Turnieren teilnehmen. Weil sie überzeugt seien, dass E-Sportlerinnen und -Sportler blitzschnell koordinieren oder bestechend logisch denken können. «Wer E-Sport betreibt, gamt aber extrem viel», so der Medienwissenschaftler. Es sei somit auch eine Frage des Aufwands. «Zumal sich viele Fähigkeiten auch mit anderen Tätigkeiten trainieren lassen.»
Eltern müssen Regeln aushandeln, Risiken aufzeigen und neugierig sein.
Matthias Gysel, Berater beim Elternnotruf
Dass Kinder beim Gamen etwas lernen, mag für Eltern tröstlich klingen. Daran, dass der Nachwuchs nicht ganztags vor Konsole, Computer oder Smartphone sitzen sollte, ändert es kaum etwas. Dass eine gute Balance besteht, dass Kinder sich also genug bewegen, Freunde treffen und die Schule nicht vernachlässigen, liegt in der Verantwortung der Eltern: «Sie sollten mit ihren Kindern von klein auf Medienkompetenz üben», sagt Fabienne Marbach von Akzent Luzern.
Dazu gehöre, das Gamen zu begleiten und gemeinsam Strategien zu entwickeln, die das Ausschalten erleichterten. Sie rät aber auch, nicht gleich panisch zu reagieren, wenn das Kind vorübergehend exzessiver gamt: «Kommt es aus der Schule und berichtet freudig von einem neuen Spiel, das alle spielen, ist das anders zu bewerten, als wenn es nur noch in seinem Zimmer für sich gamt und kein Austausch mehr da ist.»
Verantwortung übertragen
Wirkt das Gamen wie eine Alltagsflucht, liegt die Angst nah, das Kind könnte süchtig werden. Drei Prozent der gamenden 11- bis 15-Jährigen zeigen laut einer Studie von Sucht Schweiz ein problematisches Spielverhalten. Manchmal hört Matthias Gysel vom Elternnotruf denn auch von Kindern, die sich komplett zurückziehen, elf Stunden am Tag oder auch nachts an der Playstation sitzen, Sport und Hobbys abgebrochen haben, gar tageweise in der Schule fehlen.
Ihren Eltern rät er, eine Fachstelle aufzusuchen und dem Kind zu vermitteln: «Wir sorgen uns um dich und nehmen unsere Verantwortung wahr. Weil wir dich gernhaben, möchten wir eine Veränderung.» Bei den meisten Anrufen aber kann Gysel entwarnen.
Wo finden Eltern pädagogische Einschätzungen zum Lieblingsspiel ihres Kindes? Was genau bedeuten die Angaben von USK und PEGI? Und welche weiterführenden Informationen unterstützen Mütter und Väter dabei, Kinder beim Gamen gut zu begleiten? Folgende Websites geben Antworten.
- In der Themenreihe «Welt der Games» von Pro Juventute werden Aspekte wie Chancen, Risiken und Faszination von digitalen Spielen beleuchtet. Auch gibt es Onlineveranstaltungen zum Thema.
- Auch «Jugend und Medien», die nationale Plattform des Bundes zur Förderung der Medienkompetenz, wartet mit vielen Informationen zum Gamen und hilfreichen Tipps auf.
- Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ist eine freiwillige Einrichtung der Games-Branche. Sie vergibt Altersbeschränkungen ab 0, 6, 12, 16 und 18 Jahren, wobei die Einstufung auf festgelegten Kriterien basiert. Darunter: Verständlichkeit des Spielverlaufs, Gewalt oder Realismus der Darstellungen.
- PEGI ist das europäische Gegenstück zur deutschen USK. Es steht für «Pan European Game Information» und informiert über ein vorgeschlagenes Mindestalter für ein Game sowie darüber, ob Inhalte mit Sex, Gewalt oder vulgärer Sprache enthalten sind. Die Altersstufen sind ab 3, 7, 12, 16 und 18 Jahren.
- Akzent Prävention und Suchttherapie Luzern stellt Checklisten zur Verfügung, die Eltern helfen, übermässigen Mediengebrauch ihres Kindes zu erkennen und mit ihm darüber zu reden. Mit dem Projekt «Flimmerpause» zielt Akzent zudem auf eine «flimmerfreie» Woche jährlich für die ganze Familie.
- Der Spieleratgeber NRW beurteilt Games nach pädagogischen Kriterien und gibt dazu leicht verständliche und breit gefasste Beurteilungen ab.
Medienerziehung sei etwas vom Herausforderndsten in der Erziehung überhaupt. «Und manchmal eine komplette Überforderung.» Man müsse Regeln aushandeln und Risiken aufzeigen. Daneben sei aber immer auch Neugier zentral. «Ich frage Eltern oft, ob sie wissen, was ihr Kind da macht. Viele haben keine Ahnung und sagen: Es gamt halt einfach.» Anteil nehmen, zuschauen, sich das Spiel erklären lassen sei wichtig. Es wirke dann oft weniger bedrohlich und man sehe positive Aspekte. Und sei es, dass das Kind Englisch lerne.
Nicht selten sagt Gysel Eltern auch, sie dürften ihrem Kind zutrauen, dass es einen Weg finde – auch wenn sie die Verantwortung tragen würden. «Ein Gleichgewicht finden zwischen Grenzen setzen und Game-Zeit regulieren sowie dem Kind etwas zutrauen: Das ist eine Gratwanderung, manchmal ein Wagnis, aber letztlich ein generelles Erziehungsthema. Das Gamen macht es einfach noch herausfordernder.»