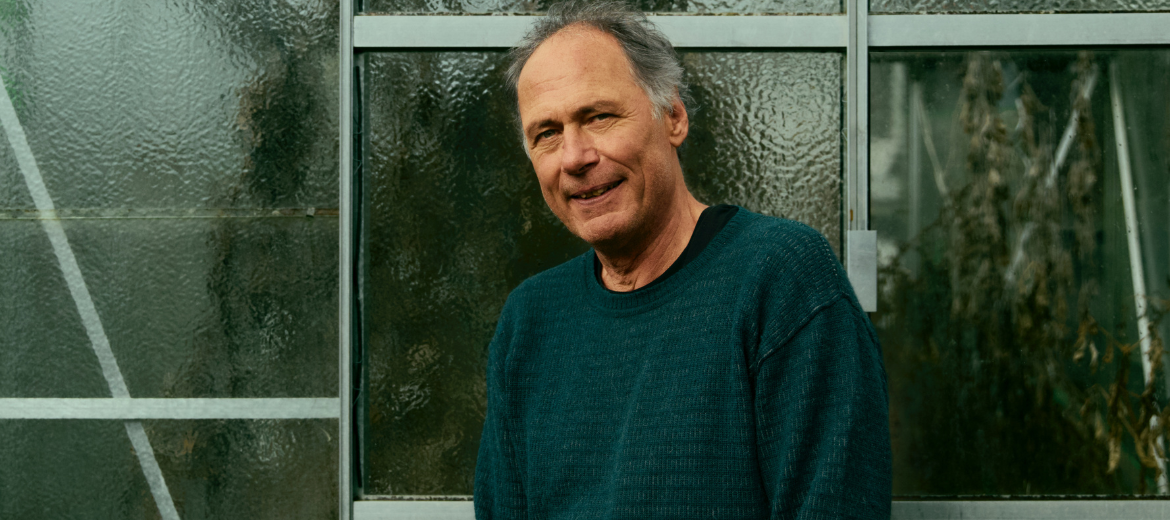«Kinder müssen sich draussen frei bewegen dürfen»

Wie entwickelt sich der Orientierungssinn von Kindern? Wann sind sie bereit, den Weg in den Kindergarten alleine zurückzulegen? Pädagogin und Orientierungsläuferin Kerstin Ullmann über die Ausweitung der kindlichen Lebenswelt.
Frau Ullmann, welche Strecke kann ein fünfjähriges Kind unbegleitet meistern?
Das könnte der kurze Weg zum Spielplatz oder zum Kindergarten sein – einfach dort, wo das Kind sich gut auskennt, weil es schon oft dort war und alles ein bisschen vertraut ist. Aber das ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob das Mädchen oder der Bub auch sonst viel unterwegs ist, ob sie oder er gerne neue Orte auf eigene Faust erkundet und was die Eltern dem Kind zutrauen. Und nicht zu vergessen: Ob die Familie an einer belebten Strasse oder am Waldrand wohnt, spielt ebenso eine entscheidende Rolle.
Kinder bauen ihre räumlichen Fähigkeiten kontinuierlich und in kleinen Schritten auf.
Wie entwickelt sich denn das räumliche Vorstellungsvermögen bei Kindern?
Der Orientierungssinn von Kindern ist ein faszinierender Reifungs- und Lernprozess. Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget ging ursprünglich davon aus, dass diese Entwicklung in klar abgegrenzten Stufen verläuft und Kinder im Alter von ungefähr zwölf Jahren das räumliche Vorstellungsvermögen eines Erwachsenen haben.

Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass Kinder ihre räumlichen Fähigkeiten kontinuierlich und in kleinen Schritten aufbauen. Schon im frühen Alter beginnen sie, ihre Umgebung zu erkunden, und verbessern durch Erfahrung und Interaktion die Fähigkeit, sich im Raum zu orientieren.
Welche Schritte durchlaufen bereits die Kleinsten, um sich zunehmend besser und zielgerichteter zu bewegen?
Zunächst erkennen Kinder einzelne, vertraute Orte, können jedoch noch keine richtige Beziehung zwischen ihnen herstellen. Sie kennen ihre Wohnung, den Park und den Einkaufsladen, wissen aber nicht, wie man von einem Ort zum anderen gelangt. Mit der Zeit beginnen sie, sich die räumliche Anordnung der jeweiligen Orte einzuprägen und sich den Weg zu merken. Die erlebten Orte erscheinen nun als Verbindungen im Raum, zum Beispiel vom Wohnort zum Spielplatz oder weiter zum Einkaufsladen. Dann entwickelt sich nach und nach die figurale Ordnung.
Was versteht man darunter?
Diese bezieht sich auf die Fähigkeit, Objekte in einem bestimmten Raum zu erkennen und deren Position zueinander zu verstehen. So entsteht ein Überblick über den Weg und Kinder können verschiedene Orte in Beziehung setzen. Es entwickeln sich sozusagen mentale Karten, die es den Kindern ermöglichen, von Ort A nach Ort B zu gelangen. Mit zunehmenden räumlichen Erfahrungen vertieft sich das dreidimensionale Denken.
Inwiefern beeinflussen genetische Faktoren diesen Entwicklungsprozess?
Experten gehen davon aus, dass bestimmte kognitive Fähigkeiten, einschliesslich der räumlichen Wahrnehmung, genetisch veranlagt sind. Es ist jedoch äusserst schwierig, den genauen Umfang des genetischen Anteils zu bestimmen. Neuere Studien betonen viel stärker die Rolle der Umwelt, denn zentral sind die entsprechenden Erfahrungen, die Kinder in ihrer Umgebung sammeln können.
Wie können Eltern das räumliche Vorstellungsvermögen fördern?
Kinder sollten bereits frühzeitig die Gelegenheit haben, unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln. Dazu gehört zum Beispiel der Aufenthalt in der Natur, auf dem Spielplatz oder im Haushalt des Familien- und Freundeskreises. Das Entdecken beginnt im kleinen Rahmen, bereits durch das Erkunden einer Spielecke.
Danach erweitert sich der Fokus auf ein Zimmer, ein Stockwerk und schliesslich auf ein ganzes Haus. Neben geschlossenen Räumen ist es vor allem wichtig, dass die Mädchen und Jungen im Freien herumlaufen dürfen. Das kann anfangs der Garten sein, aber auch der Spielplatz oder ein sicherer Platz im Quartier oder im Wald.
Verstecken spielen kann dabei helfen, gemeinsam die Umgebung zu erkunden und sich darin zurechtzufinden.
Worauf sollten Eltern noch achten?
Je aktiver ein Kind ist, desto mehr Möglichkeiten hat es, verschiedene Räume zu erkunden und neue Orte zu entdecken. Indem die Eltern Anregungen schaffen und ihre Kinder zum Erkunden motivieren, erweitert sich der Radius nach und nach. Die Förderung von Bewegung spielt dabei eine entscheidende Rolle für das eigenständige Entdecken und die Entwicklung der räumlichen Vorstellung. Untersuchungen haben gezeigt, dass es nicht ausreicht, nur auf dem Rücksitz des Autos mitzufahren, um ein Gefühl für die Umgebung zu entwickeln.
Warum ist das so?
Kinder, die selbständig zur Schule gehen oder fahren, nehmen ihren Schulweg bewusster und in ihrem eigenen Tempo wahr. Sie können Fixpunkte zwischen ihrem Wohnort und der Schule benennen oder sogar einzeichnen. Im Gegensatz dazu haben Kinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht werden, oft Schwierigkeiten, den zurückgelegten Weg nachzuvollziehen und sich an die Orte auf dem Weg zu erinnern. Dies zeigt, dass eine aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt notwendig ist, um eine gute räumliche Orientierungskompetenz zu entwickeln.
Welche Rolle spielt die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen?
Das gemeinsame Erkunden und Spielen mit anderen Kindern fördert die Fähigkeit, sich zurechtzufinden. Kinder fühlen sich in der Gruppe oft sicherer und mutiger, unbekannte Wege zu erkunden oder neue Räume zu betreten. Sie sind eher bereit, ihre vertraute Umgebung zu verlassen und Unbekanntes zu wagen. Spiele wie zum Beispiel Verstecken können dabei helfen, gemeinsam die Umgebung zu erkunden und sich darin zurechtzufinden.
- Selbständige Erkundung: Lassen Sie Ihr Kind – seinem Entwicklungsstand entsprechend – seine Umgebung nach und nach selbständig erkunden und entdecken. Geben Sie ihm die Freiheit, neue Orte zu erforschen und dabei seine Sinne zu schärfen.
- Spielerisches Lernen: Ermöglichen Sie Ihrem Kind, seinen Orientierungssinn spielerisch zu erweitern mit Spielen wie Schatzsuche, Labyrinth, Geocaching, Foto-Orientierungslauf, Versteckspielen, Memory und Puzzles. Diese Aktivitäten machen nicht nur Spass, sondern fördern auch die räumliche Wahrnehmung.
- Gemeinsame Wege: Gehen Sie gemeinsam Wege zu Fuss oder mit dem Fahrrad. Nutzen Sie diese Gelegenheiten, um über die Umgebung zu sprechen und Orientierungspunkte zu benennen.
- Aktive Planung: Beziehen Sie Ihr Kind aktiv in die Planung und Navigation alltäglicher Wege ein. Erklären Sie Ihrem Kind, wohin Sie gehen und welchen Weg Sie wählen. Dies stärkt das Verständnis für Routen und Entfernungen.
- Vielfalt der Wege: Gehen Sie immer wieder andere und neue Wege, damit Ihr Kind die bekannten Orte miteinander in Beziehung setzen kann. Unterschiedliche Perspektiven helfen, das räumliche Denken zu fördern.
- Alltagsintegration: Integrieren Sie Orientierungselemente in den Alltag, indem Sie Ihr Kind beim Einkaufen oder beim Besuch von Freunden nach dem Weg fragen lassen. Lassen Sie es die Richtung angeben oder die Umgebung beschreiben.
- Kreative Bastelprojekte: Basteln Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einfache Karten von Ihrem Wohnumfeld oder von Orten, die Sie besucht haben. Dies fördert das räumliche Vorstellungsvermögen und macht das Lernen greifbar.
- Digitale Hilfsmittel: Nutzen Sie kindgerechte Apps oder Spiele, die das räumliche Denken und die Navigation fördern. Achten Sie darauf, dass diese Aktivitäten in einem ausgewogenen Verhältnis zu analogen Spielen stehen.
Warum lernen Kinder beim Verstecken und Suchen so viel?
Unter anderem deswegen, weil sie sich merken müssen, wo sie bereits gesucht haben und wo mögliche Verstecke liegen. Ausserdem spähen sie neue Verstecke aus, wenn sie immer sofort gefunden werden. Damit erweitert sich die räumliche Vorstellungskraft. Kinder schauen sich auch untereinander ab, welche Verstecke gewählt werden und welche erfolgversprechend sind.
Eltern machen sich oft Sorgen, wenn sie ihre Kinder draussen allein herumtoben lassen. Wie kann die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit am besten gelingen?
In den ersten Jahren ist es entscheidend, Kinder zu begleiten, damit sie Sicherheit und Vertrauen aufbauen können. Indem Wege gemeinsam zurückgelegt werden, können Eltern auf mögliche Gefahren hinweisen oder mit ihren Kindern besprechen, was sie tun können, wenn sie sich unsicher fühlen.
Aber wie können Eltern erkennen, wann ihr Kind bereit ist, grössere Strecken alleine zurückzulegen?
Manche Kinder benötigen eine längere Begleitung, sei es aufgrund eigener Unsicherheiten oder weil sie ihre Aufmerksamkeit anderen Dingen widmen. Eine Freundin erzählte mir neulich, dass sie ihre Tochter anfangs auf dem ein Kilometer langen Kindergartenweg begleitete. Nach und nach meisterte die Tochter einen grösseren Teil des Weges allein und teilte der Mutter jeweils mit, wann sie wieder für mehr bereit war.
Grundsätzlich erscheint es mir wichtig, dass Kinder beim selbständigen Spielen im Freien genau wissen, wo sich die betreuende Person aufhält. Aus Sicherheitsgründen ist es unerlässlich, mit dem Kind den Spielradius zu definieren. Will es den Radius verlassen, soll es mit der betreuenden Person Kontakt aufnehmen. Je älter die Buben und Mädchen werden, umso grösser wird auch ihr Spielradius.
Die häufige Nutzung digitaler Medien kann die Entwicklung des Orientierungssinns beeinträchtigen.
Welche Auswirkungen haben digitale Medien und Technologien auf den Orientierungssinn von Kindern im Kindergartenalter?
Digitale Medien und Technologien bieten zahlreiche Möglichkeiten, den Orientierungssinn von Kindern zu fördern. Es gibt viele Apps und digitale Spiele, die das räumliche Denken und die Navigationsfähigkeiten aktiv unterstützen. Tools wie Google Earth oder interaktive Karten ermöglichen es Kindern, virtuelle Reisen zu unternehmen, und erleichtern die Orientierung, da das Lesen einer analogen Karte nicht mehr zwingend erforderlich ist, um sich in neuen Umgebungen zurechtzufinden.
Und wie können Eltern sicherstellen, dass ihre Kinder vor allem die reale Welt erkunden?
Die häufige Nutzung digitaler Medien hat bekanntlich negative Auswirkungen. Kinder, die sich überwiegend in der digitalen Welt orientieren, verbringen tendenziell weniger Zeit mit körperlicher Bewegung und der Erkundung ihrer realen Umgebung. Dies kann die Entwicklung ihres Orientierungssinns beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, den Einsatz digitaler Medien und Technologien gezielt und massvoll zu gestalten. Digitale Medien sollten als wertvolle Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die Orientierung in der realen Welt betrachtet werden.