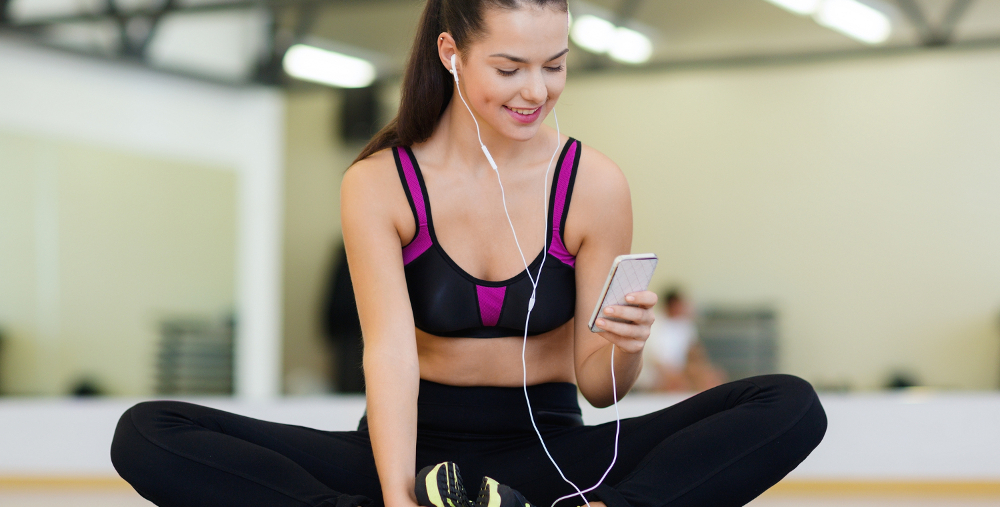Wenn das Kind einen Tic hat

Beginnen Kinder, Tics zu zeigen, machen sich Eltern oft grosse Sorgen. Woher diese Störung kommt, wie Eltern und Kinder mit Tics am besten umgehen und wie eine mögliche Behandlung aussieht.
Häufiges Räuspern, Grunzen, Augenzwinkern, Bellen oder Naserümpfen: Tic-Störungen gehören zu den chronischen neuropsychiatrischen Erkrankungen, beginnen in der Kindheit und kommen vergleichsweise häufig vor.
«Weltweit sind rund vier bis zwölf Prozent aller Kinder im Alter von etwa vier bis elf Jahren betroffen – Jungs drei- bis viereinhalbmal häufiger als Mädchen», sagt Friederike Tagwerker Gloor, Psychologin und Mitglied der Spezialsprechstunde für Tic- und Zwangsstörung an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.
Typisches Merkmal dieser Störung sind sogenannte Tics, die eine extreme Bandbreite haben und sich von Kind zu Kind, aber auch im Verlauf der Erkrankung stark unterscheiden beziehungsweise verändern können.
Die meisten Tics gehen von alleine wieder weg
«Unter einem Tic versteht man kurze, unwillkürlich ausgeführte, nicht rhythmische Muskelbewegungen oder Laute, die keinem erkennbaren Zweck dienen», so Tagwerker Gloor. Man unterscheidet zwischen motorischen Tics wie Blinzeln oder Kopfwerfen und vokalen Tics wie Husten, Bellen oder Räuspern. Motorische und vokale Tics können jeweils einzeln oder auch kombiniert auftreten, in der Ausprägung einfach und unauffällig oder auch komplex und störend sein sowie in der Häufigkeit des Auftretens stark variieren.
Doch die Expertin kann besorgte Eltern oft erst einmal beruhigen: «Die überwiegende Zahl der Tic-Störungen ist vorübergehend und geht nach wenigen Wochen bis Monaten von alleine wieder weg.» Bei drei bis vier Prozent der Kinder bleiben die Symptome jedoch länger als ein Jahr bestehen und gelten damit als chronisch. Etwa ein Prozent der Betroffenen zeigt Symptome des Tourette-Syndroms, der schwersten Form der Tic-Störungen, bei der motorische und vokale Tics dauerhaft zusammen auftreten, so Tagwerker Gloor.
Die genauen Ursachen von Tic-Störungen werden bis heute nicht vollständig verstanden.
Typischerweise verändern sich die Symptome der chronischen Tic-Störungen bis ins Erwachsenenalter. «Bei den meisten betroffenen Kindern nimmt der Schweregrad der Tic-Störung zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahr markant zu und nach dem zwölften Lebensjahr – unabhängig von der Behandlung – unterschiedlich schnell wieder ab», sagt die Psychologin.
«Somit bessern sich auch chronische Tic-Störungen in der Regel bis ins Erwachsenenalter von selbst oder bilden sich gar vollständig zurück.» Bleiben die Symptome im Erwachsenenalter jedoch bestehen, gilt eine Spontanheilung, sprich das Phänomen der Selbstheilung ohne Therapie von aussen, als eher unwahrscheinlich. Beim Tourette-Syndrom ist dies meist der Fall.
Neurobiologische Faktoren als Hauptursache vermutet
Die genauen Ursachen von Tic-Störungen werden bis heute nicht vollständig verstanden. «Neben verschiedenen Umweltfaktoren spielt vor allem die Genetik eine grosse Rolle», betont Facharzt Florian Kraemer, der auch im Leitungsteam für Tic- und Zwangsstörung an der Universitätsklinik Zürich arbeitet. Das heisst also, dass die Veranlagung, eine Tic-Störung zu entwickeln, zu einem grossen Teil vererbt ist und familiär gehäuft auftritt.
«Wir gehen davon aus, dass bei Betroffenen unterdrückende Systeme in bestimmten Regelkreisen des Gehirns gestört sind, insbesondere in den sogenannten Basalganglien, die unter anderem motorische Abläufe regulieren. Mithilfe bildgebender Verfahren konnten bei diesen Personen ausserdem charakteristische Veränderungen im Präfrontalhirn – einem Bereich des Gehirns, der vor allem für das Planen und Handeln sowie die Empathie und Impulskontrolle zuständig ist – nachgewiesen werden», so Kraemer. Dabei gebe es Hinweise darauf, dass eine Störung des Botenstoffsystems Dopamin und eine damit verbundene Überaktivität dieses Systems beteiligt seien.
Stress und starke Emotionen können Tics auslösen
Im Laufe der kindlichen Entwicklung und des Umbaus der Hirnstrukturen während der Pubertät scheint der Körper diese Dysbalancen allerdings oftmals wieder zu regulieren. «Das würde auch erklären, warum sich kindliche Tic-Störungen bis zum 22. Lebensjahr oft deutlich bessern oder gar komplett verschwinden», so der Oberarzt. «Ausserdem wird verständlich, warum Stress und starke Emotionen, egal ob negativ oder positiv, Tics auslösen beziehungsweise deutlich verstärken können.»
Typischerweise treten zusammen mit Tic-Störungen bestimmte psychiatrische Krankheitsbilder auf. «Über 50 Prozent der Betroffenen leiden zusätzlich an ADHS sowie Zwangsstörungen, häufig sehen wir auch Stottern, Depressionen, Impulskontroll- sowie Autismus-Spektrum-Störungen», sagt Friederike Tagwerker Gloor. Vielfach belasten die Symptome der zusätzlich auftretenden Erkrankungen die Kinder stärker als die Tic-Störung selbst. Denn einfache Tics stören die Betroffenen meist gar nicht so stark, wenn sie deswegen nicht gehänselt werden oder sich selbst verletzen.
Beunruhigt sind vor allem die Eltern
Anders ist das bei Zwängen, die oft grossen Leidensdruck erzeugen, oder auch bei ADHS, das vor allem in der Schule Probleme mit sich bringt. Je nach Leidensdruck werden die belastenderen Zusatzerkrankungen entsprechend vorrangig behandelt. Denn wenn sich die Zwänge beziehungsweise ADHS-Symptome bessern, sinkt dadurch meist auch der Stresslevel, was sich wiederum positiv auf die Symptome der Tic-Störung auswirkt.
Die Therapie der Tic-Störungen selbst richtet sich also vor allem nach dem Schweregrad der Symptome sowie dem Leidensdruck beim Kind. «Wenn betroffene Familien zu uns kommen, sind meist vor allem die Eltern beunruhigt, machen sich Sorgen wegen möglichen Mobbings oder auch Selbstvorwürfe, weil sie das Gefühl haben, etwas falsch gemacht zu haben», erklärt Tagwerker Gloor. «Die betroffenen Kinder selbst zeigen dagegen oft deutlich weniger Leidensdruck.»
Wird Druck aufgesetzt, können sich die Symptome verstärken
Im ersten Schritt ist es hier vor allem wichtig, umfassend über die Erkrankung aufzuklären. Eine ausführliche Psychoedukation, wie man die für Laien verständliche Aufklärung über die Erkrankung auch nennt, schafft Verständnis und hilft, den Druck aus der Situation zu nehmen.
«In leichteren Fällen, wenn die Tics Schule und Alltag des Kindes nur wenig beeinträchtigen, raten wir in der Regel dazu, erst mal aufmerksam abzuwarten», sagt Tagwerker Gloor. «Zusätzlich geben wir den Familien praktische Verhaltenstipps an die Hand, die ihnen helfen, im Alltag mit der Tic-Störung besser umzugehen.»
Entspannung, Ablenkung oder Konzentration auf eine bestimmte Tätigkeit dämpfen die Tic-Symptomatik.
Friederike Tagwerker Gloor, Psychologin
Ganz entscheidend bei Tic-Störungen ist es, möglichst wenig Druck auf das Kind auszuüben, denn Stress kann die Attacken auslösen und verstärkt ausserdem die Symptomatik. Zeigt ein Kind Tics, sollten Eltern ihr Kind also auf keinen Fall auffordern, damit aufzuhören, oder gar schimpfen. Besser sei es, das Verhalten entweder zu «übersehen» oder es liebevoll anzusprechen und gezielte Massnahmen zur Linderung anzubieten.
«Denn Entspannung, Konzentration auf eine bestimmte Tätigkeit oder auch Ablenkung wirken nachweislich dämpfend auf die Tic-Symptomatik», erklärt die Kinderpsychologin. «So treten während des Schlafs, in Ruhephasen, aber auch beim Sport und in der Schule meist deutlich weniger bis gar keine Tics auf.»
Schule und Umfeld frühzeitig informieren
Im Alltag können Eltern ihr Kind in einer konkreten Tic-Situation entlasten, indem sie ihm beispielsweise etwas zu trinken anbieten oder eine beruhigende Musik abspielen. Auch Hinlegen, Fernsehen oder eine Streicheleinheit können hilfreich sein. «Bei älteren Kindern haben sich Entspannungsverfahren wie Kinderyoga, progressive Muskelentspannung oder autogenes Training bewährt», weiss Tagwerker Gloor.
«Positiv wirken sich ausserdem Bewegung, Sport, Musizieren oder Singen aus.» Nicht zuletzt rät die Psychologin dazu, immer möglichst frühzeitig die Schule sowie das nahe Umfeld zu informieren, damit diese ebenfalls adäquat reagieren können.
Verhaltenstherapie senkt die Ausprägung der Symptome
Nicht immer reichen diese Massnahmen aus. «Wenn die Tics an Häufigkeit und Stärke zunehmen, Kinder leiden, weil sie gehänselt werden, schulische Beeinträchtigungen auftreten oder auch gesundheitliche Probleme wie etwa Verspannungen, raten wir zu einer gezielten Behandlung. Hierzu stehen vor allem Psychotherapie sowie Medikamente zur Verfügung», so die Expertin der Tic-Sprechstunde.
Bei den Psychotherapien hätten sich vor allem das Habit-Reversal-Training (HRT) und die Exposition mit Reaktionsverhinderung (ERP) bewährt. Diese beiden verhaltenstherapeutischen Verfahren können Tic-Störungen zwar nicht heilen. In Studien konnte aber nachgewiesen werden, dass sie dabei helfen, die Ausprägung der Symptome um über 30 Prozent zu senken.
«In der Umsetzung nutzen beide Verfahren die Tatsache, dass Betroffene vor dem Ausführen der Tics häufig ein unangenehmes Vorgefühl verspüren, das man sich ähnlich wie das innerliche Kribbeln vor dem Niesen vorstellen kann», beschreibt es die Kinderpsychologin. «Beim HRT lernen die Kinder, dieses Vorgefühl besser wahrzunehmen und dann gezielt gegensätzlich zum Tic gerichtete Bewegungen auszuführen, die nach aussen hin unauffällig wirken.»
Die ERP soll darüber hinaus den Automatismus unterbrechen, dass auf ein Vorgefühl zwangsläufig immer ein Tic folgen muss. «Insbesondere bei mittelgradigen Tic-Störungen können wir mit diesen Verfahren sehr gute und lang anhaltende Erfolge erzielen», so Tagwerker Gloor. «Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Kind eine hohe Eigenmotivation sowie ausreichend Geduld mitbringt, da die Umsetzung im Alltag viel Übung erfordert.»
Medikamente helfen besonders schnell
Fehlt die nötige Eigenmotivation oder sind die Tics so massiv, dass eine rasche Symptomlinderung nötig ist, können auch Medikamente eingesetzt werden. «Zur Behandlung von Tic- und Tourette-Störungen kommen sogenannte Antipsychotika zum Einsatz», sagt Kinderpsychiater Kraemer. «Das sind Medikamente, die den Dopaminüberschuss regulieren, wodurch sich die Tics oft schon nach wenigen Tagen um 50 bis 95 Prozent reduzieren.»
Viele Eltern haben jedoch Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen. «Moderne Antipsychotika, beispielsweise auf Basis von Aripiprazol, zeigen nur wenige Nebenwirkungen und werden insgesamt sehr gut vertragen», erklärt Kraemer. Das Medikament könne in Tropfenform verabreicht werden, sodass eine besonders niedrige und individuell angepasste Dosierung möglich sei. Ausserdem finden im Vorfeld der Behandlung sowie während der Therapie regelmässige Verlaufskontrollen statt.
Auch Medikamente wirken nur symptomatisch und heilen die Erkrankung nicht. «Sie helfen aber, die Zeit zu überbrücken, bis die Funktionen im Hirnstoffwechsel des Kindes im Laufe der Entwicklung entsprechend nachgereift sind», erklärt der Kinderarzt. «Häufig kann dann bereits nach einem Jahr die Dosierung stark reduziert beziehungsweise das Medikament ganz ausgeschlichen werden, ohne dass die Symptomatik wieder ansteigt.»
- Unter www.tourette.ch finden Betroffene und Interessierte auf der Internetseite der Tourette-Gesellschaft Schweiz (TGS) neben Hintergrundinformationen auch eine alphabetisch sortierte Ärzteliste mit Ansprechpartnern in der Schweiz, die auf das Tic- und Tourette-Syndrom spezialisiert sind.
- Die Tourette-Gesellschaft Deutschland (TGD) bietet unter www.tourette-gesellschaft.de umfassendes Informations- und Videomaterial zum Thema. Ausserdem gibt es einen Veranstaltungskalender sowie Informationsbroschüren zum kostenfreien Download.
- Die Selbsthilfegruppe Tourette-romandie bietet unter www.tourette-romandie.ch ebenfalls viele Hintergrundinformationen sowie Kontaktmöglichkeiten für Betroffene in der französischen Schweiz und in französischer Sprache.
- Der Interessenverband Tic & Tourette Syndrom e.V. (IVTS) vermittelt auf seiner Seite iv-ts.de sehr viele Hintergrundinformationen.