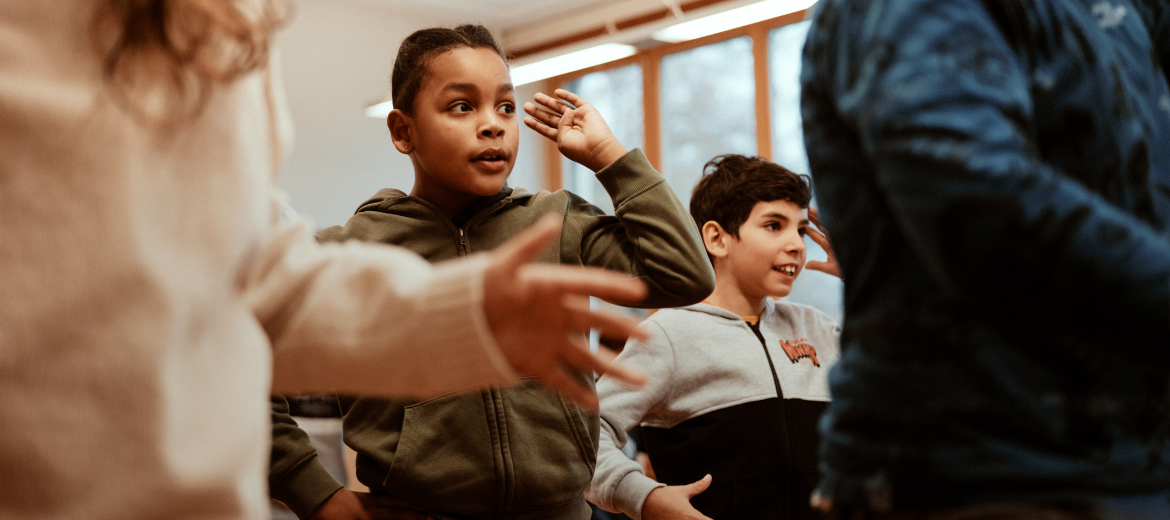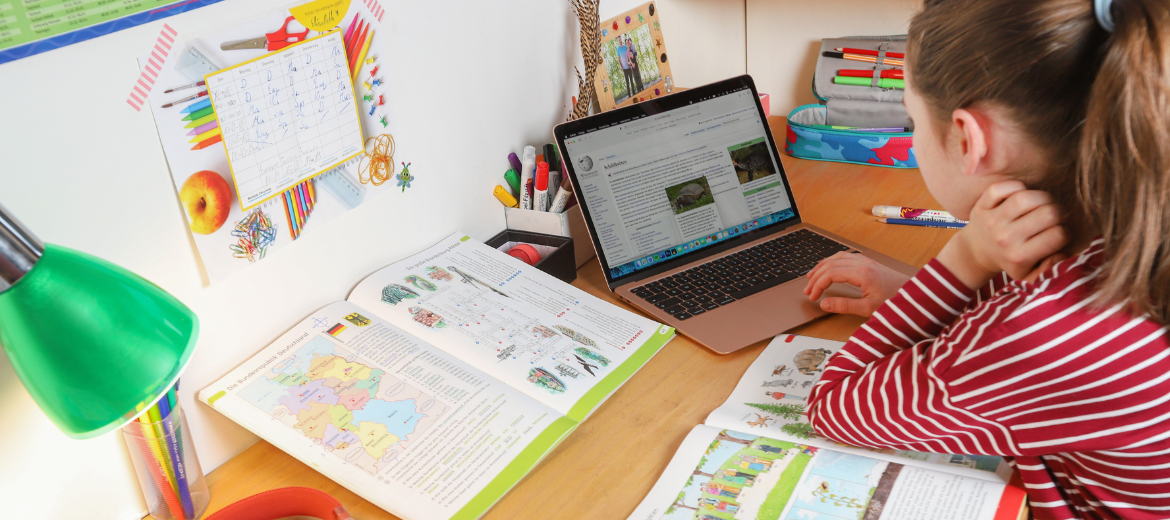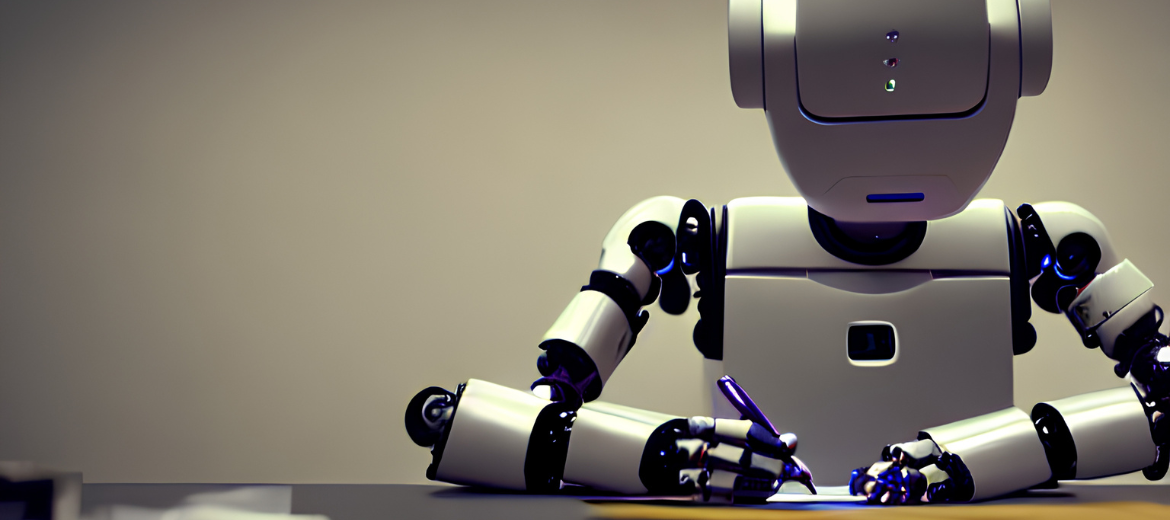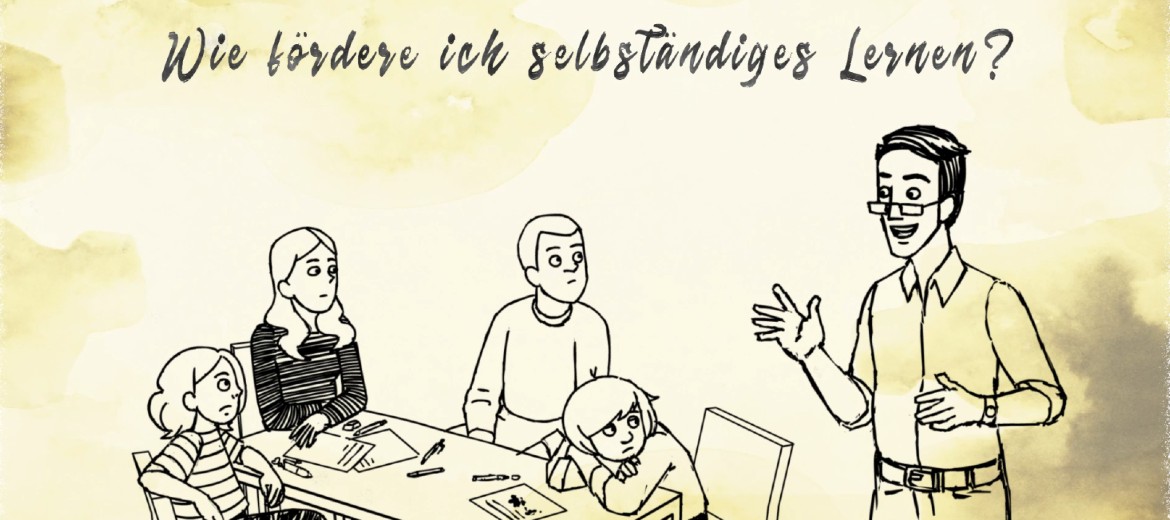Endlich eine passende Schule gefunden

Nach einer langen Odyssee findet unsere Autorin die perfekte Schule für ihre Töchter. Was ihr dort gefällt und worauf Eltern bei privaten Institutionen achten sollten.
An den ersten Schultag meiner ältesten Tochter erinnere ich mich noch gut: Die zwei blonden Zöpfchen, den dicken Schulrucksack und ihren neugierig-aufgeregten Blick, als sie die erste Klasse der Steinerschule betrat. Auch in meinem Bauch kribbelte es. Wie wird sie sich zurechtfinden? Haben wir die richtige Entscheidung für sie getroffen?
Was wir damals nicht ahnen: In dieser Institution wird sie ihre Schullaufbahn nicht beenden. Auch nicht in der folgenden. Insgesamt werden wir fünf sehr unterschiedliche Schulen kennenlernen, bevor wir in der für uns richtigen ankommen.
Warum keine Staatsschule?
Aber beginnen wir ganz am Anfang. Die Frage nach einer zeitgemässen Bildung bewegte mich lange vor diesem ersten Schultag. Damals empfand ich vieles an der Regelschule als unbefriedigend. Ich beobachtete das sogenannte Bulimie-Lernen: Kinder, die kurzfristig Stoff büffeln, um ihn auf Befehl wieder herauszuwürgen. Etwas, das ich auch heute noch als Zeitverschwendung betrachte.
Auch die Beurteilung der Kinder schien mir zu sehr auf Schwächen fokussiert. Ein Beispiel: Bei der Tochter eines Arbeitskollegen wurde im Kindergarten ein «Schneiddefizit» diagnostiziert – weil sie unsauber mit der Schere arbeitete.
Ich nahm zudem ein Notensystem wahr, das Willkür zulässt und kaum die Stärken eines Kindes widerspiegelt. In einem solchen Umfeld sah ich wenig Raum für individuelle Entwicklungsbedürfnisse. Lehrpersonen und auch Eltern schienen sich übermässig zu sorgen, dass ein Kind etwas verpassen und zurückfallen könnte. Das Seilziehen um Jokertage wirkte auf mich kleinlich.
Ich fragte mich: Ginge es nicht entspannter?
Bildung neu denken
In der Zeit sahen mein Mann und ich zwei Filme, die uns nachhaltig prägten: «Être et Devenir» (2014) erkundet das Thema «Unschooling»: ein Bildungsansatz, bei dem Kinder frei von traditionellen Lehrplänen und Strukturen durch ihre eigenen Interessen lernen. Sie können ihre Bildung selbst gestalten, ohne formale Grenzen.
Wir wünschten uns eine Institution, die die intrinsische Motivation und die Freude am Lernen fördert.
Der Film «Alphabet» (2013) wiederum kritisiert das konventionelle Bildungssystem und zeigt, wie Leistungsdruck und standardisierte Prüfungen Kreativität und individuelles Potenzial schwächen. Beide Filme laden dazu ein, Bildung neu zu denken und legen den Fokus darauf, intrinsische Motivation und die Freude am Lernen zu fördern.
Wir wünschten uns eine Bildungsinstitution, wo das möglich ist, und in welcher gelegentliche Abwesenheiten nicht so schwer ins Gewicht fallen, denn: Unsere älteste Tochter litt damals an starken Allergien und Asthma. Sie blieb gesundheitsbedingt oft zu Hause. Wir suchten eine Schule, die die Entwicklung von Kindern ins Zentrum stellt.
- Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen (2015)
- Berlin Rebel High School (2016)
- Die Kinder der Utopie (2019)
- Bratsch – Ein Dorf macht Schule (2023)
- SRF-Beitrag über Privatschulen
- ZDF Terra X Lesch & Co: Unser Schulsystem ist Mist!?
- Arte Kids: Schule und Lernen
Auch Privatschulen haben ihre Stolpersteine
Die Suche nach dem richtigen Schulmodell in der Schweiz begann für beide Töchter in der Steinerschule, gefolgt von einer demokratischen Schule. Als wir unsere Langzeitreise begannen, lernten sie weiter in unserer Wohnwagenschule. Später besuchten unsere Mädchen eine internationale Schule in Portugal.
Alle Schulen schmückten sich mit grossartigen Leitbildern. Bei deren Umsetzung haperte es in unserer Erfahrung jedoch oft. Es fehlte nicht an inspirierten Lehrpersonen. Vielmehr fehlte es an Ressourcen, Richtlinien, Fachwissen (z.B. Schulsozialarbeit) und Führung. Mit dem Resultat: Überforderung im Klassenzimmer, ständige Lehrerwechsel und bei der demokratischen Schule sogar ein Bankrott.
1. Finanzielle Situation
Viele Privatschulen kosten pro Kind über 20’000 Franken im Jahr. Einkommensabhängige Schulen sind erschwinglicher – Privatschulen erhalten jedoch meist keine zusätzlichen Mittel vom Staat für erhöhten pädagogischen Aufwand bei Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Das kann Auswirkungen auf das Klassenklima haben.
Fragen Sie: Wie geht die Schule damit um?
2. Pädagogisches Leitbild
Viele Privatschulen arbeiten nach ideologischen oder besonderen pädagogischen Grundsätzen, wie zum Beispiel die Steinerschule, die Montessori-Schule oder religiöse Schulen.
Fragen Sie sich: Wie stehen Sie dazu? Könnte dies zu Spannungen führen? Setzt die Schule das um, was sie sich auf die Fahne schreibt?
- Was sind die Schutzrichtlinien für Kinder?
- Wie wird mit Mobbing umgegangen?
- Wie reagieren Lehrpersonen und Schulleitung auf kritische Fragen?
3. Rolle der Eltern
Welche Rolle möchten Sie als Eltern bei der Bildung Ihres Kindes einnehmen? In manchen Schulen ist die Beteiligung der Eltern unerwünscht, in anderen können sie sich aktiv für die Schulgemeinschaft engagieren.
Tipp: Sprechen Sie mit Eltern jener Schulinstitutionen über deren Erfahrungen
4. Schulischer Erfolg
In einer Schule, die Kindern mehr Entwicklungsraum gibt, verläuft der Lernerfolg nicht unbedingt linear. Sind Sie bereit, darauf zu vertrauen, dass es trotzdem gut kommt? Haben Sie Zuversicht ins Konzept der Schule und dessen Umsetzung?
- An was wird Erfolg gemessen?
- Wie transparent wird damit umgegangen?
- Wer ist für was verantwortlich?
5. Wie geht es Ihrem Kind?
Das ist der allerwichtigste Punkt.
- Ist Ihr Kind glücklich an seiner Schule?
- Lernt es etwas?
- Schläft es gut?
- Isst es gut?
- Hat es ein paar Freunde?
Eine Schule, die mitreist
Wer die Reiseserie «Das Glück reist mit» verfolgt, weiss, dass unsere Wohnsituation nicht dem schweizerischen Durchschnitt entspricht. An der Durchschnittlichkeit unserer Familie ändert dies jedoch nicht viel. Wir leben einen normalen, routinierten Wochenrhythmus – bloss an verschiedenen Orten. Was ich damit sagen möchte: Das Bedürfnis nach einer guten Bildung für unsere Töchter blieb durch unsere Reiserei unverändert. Was wir mitunter suchten: Eine Schule, die mitreist.
Je älter das Kind, desto mehr Verantwortung übernimmt es.
Unsere letzte Bildungsstätte fanden wir vor etwa anderthalb Jahren. Sie ist eine 130 Jahre alte, gut etablierte, englische Fernschule. Klar: Schülerinnen und Schüler teilen sich dort kein Klassenzimmer – ein zentraler Teil des Schulalltags in den meisten Bildungsstätten. Dass wir uns dort so gut aufgehoben fühlen, hat damit jedoch wenig zu tun. Was sie gut macht, liesse sich auch an anderen Schulen umsetzen. Die folgenden fünf Punkte überzeugen uns:
1. Kommunikation
Die Kommunikation unserer Schule mit Lernenden und Eltern ist verlässlich, transparent und sachlich. Sie verspricht uns bis heute nichts, was sie nicht halten kann, und sie versucht nicht, uns von irgendwelchen Ideologien zu überzeugen.
2. Verantwortung
Es geht in dieser Schule darum, junge Menschen dabei zu fördern, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Schule, Lernende und Eltern tragen jeweils ihren Teil zum Lernerfolg bei. Die Rollen sind dabei ganz klar.
Je älter das Kind, desto grösser sein Verantwortungsbereich. Meine Töchter entscheiden selbst, wann und wie viel sie arbeiten. Somit lernen sie, ihre Zeit so einzuteilen, dass sie ihr Pensum gut schaffen. Was heute nicht erledigt wird, beisst sie möglicherweise morgen.
3. Lernprinzipien
Beim Lernen geht es darum, selbst zu denken und nicht das Kurzzeitgedächtnis zu trainieren. Lernkontrollen dürfen mit offenen Büchern gemacht werden. Neben der Note erhalten meine Töchter jeweils ein detailliertes Feedback von einem Fachlehrer – manchmal auch per Videobotschaft. Sie lernen mit Schulbüchern sowie mit einer Lernplattform, mit Videos und anderen Ressourcen.
Die Lernenden können an verschiedenen Clubs teilnehmen, um sich mit Gleichaltrigen aus über 130 Ländern zu verbinden.
Die Lernbegleitung ist von der Wissensvermittlung getrennt. Dies ermöglicht es, auf individuelle Entwicklungsbedürfnisse der Lernenden getrennt vom Stoff einzugehen. Eine Lernbegleiterin unterstützt die Mädchen dabei, ihre individuellen Lernziele zu erreichen. Die Lernziele sind klar – der Weg dorthin ist jedoch für jedes Kind ein anderer.
4. Beziehung
Unsere Schule hat verstanden, dass Beziehungskonsistenz zentral ist für die Lernmotivation. Lehrerinnen und Lernbegleiter scheinen gerne längerfristig für diese Schule zu arbeiten. Etwas, das es meinen Töchtern ermöglicht, eine persönliche Beziehung zu Lernbegleitern und Fachlehrern zu entwickeln.
Es gibt keine Jokertage. Alle nehmen sich eine Verschnaufpause, wenn sie sie brauchen – auch Lehrpersonen.
Da die Lernenden keine herkömmlichen Klassenkameraden haben, werden sie ermutigt, an verschiedenen Clubs teilzunehmen, um sich mit Gleichaltrigen zu verbinden. Dazu gehören ein Buchklub, ein Schachklub, ein Kochklub, ein Debattierklub und sogar ein Online-Chor. Ausserdem gibt es ein Forum, auf dem sie sich treffen können, um sich auszutauschen und Freundschaften zu schliessen.
All dies ersetzt keinen Schulhof, aber es eröffnet die Möglichkeit, junge Menschen aus über 130 verschiedenen Ländern kennenzulernen.
5. Individuelle Freiheit
Es braucht keine Jokertage oder Spezialbewilligungen, um ausserhalb der Ferienzeiten abwesend zu sein. Alle nehmen sich dann eine kleine oder grosse Schnaufpause, wenn sie sie brauchen, auch Lehrpersonen. Lerchen arbeiten am Morgen, Nachteulen eher am Abend. Dass dieses Modell selbst in Bildungsstätten mit Anwesenheitspflicht funktioniert, erlebten wir übrigens auch an anderen Schulen.
Gute Bildung darf kein Privileg sein
Auch wenn es in diesem Zusammenhang irritieren mag: Mein Herz schlägt nach wie vor für eine gute öffentliche Bildung. Nicht nur, weil sich in meinem engsten Umfeld mehrere Menschen in der Staatsschule engagieren.
Meine Erfahrungen in der Sozialpsychiatrie und im Kindes- und Jugendschutz lehrten mich: Für manche Kinder bedeutet die Schule der stabilste Ort im Leben. Die Zukunft vieler Lernender aus sozial benachteiligten Familien hängt von der Qualität der staatlichen Schule ab. Wir sind eine privilegierte Familie, die sich eine Schule aussuchen kann. Eine gute Bildung darf jedoch kein Privileg sein.
Ich wünschte mir ein Bildungssystem, das individuelle Entwicklungsbedürfnisse von Kindern besser respektiert.
Mehr Flexibilität in der Schweizer Schullandschaft
Viele der Eltern, die wir auf unserer Schulodyssee kennenlernten, fühlten sich von der Staatsschule im Stich gelassen und suchten nach alternativen Lösungen. Insbesondere Kinder, die langes Stillsitzen im Frontalunterricht quält, aber auch solche mit speziellen Begabungen: Sie wurden durch starre Lehrpläne und limitierte Personalressourcen in ihrem Potenzial ausgebremst.
Für die Schweiz wünschte ich mir deshalb mehr Flexibilität in der Schullandschaft. Ich wünschte mir ein Bildungssystem, das individuelle Entwicklungsbedürfnisse von Kindern besser respektiert. Dies würde erreicht durch flexiblere Lernformen innerhalb der Regelschule oder durch eine freie Schulwahl. Ich wünschte mir, dass jedes Kind gerne in seine Schule geht.
Denn, wie Nelson Mandela – der übrigens aus dem Gefängnis an unserer Fernschule studierte – sagte: «Bildung ist die mächtigste Waffe, die du nutzen kannst, um die Welt zu verändern.»