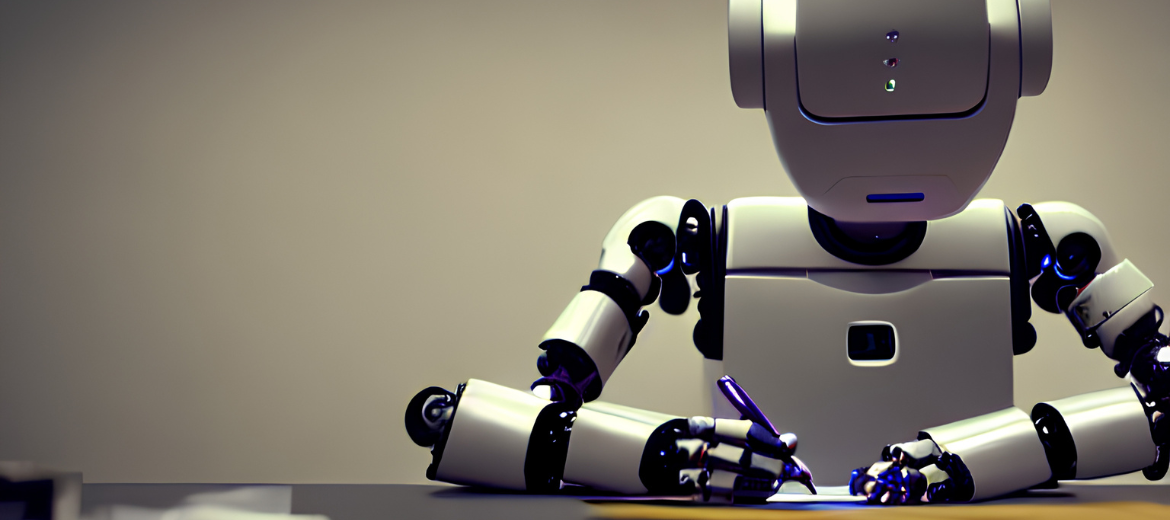Was ein Kind zum Lernen braucht

In den vergangenen Jahren wurde viel zum Thema Lernen geforscht und die Schulen versuchen, die Erkenntnisse umzusetzen. Das hat nicht mehr viel mit den Konzepten aus der Schulzeit von uns Eltern zu tun. Doch wie geht gutes Lernen? Und wie können Mütter und Väter ihre Kinder darin unterstützen?
Es passiert häufig absichtlich, noch häufiger ganz beiläufig, und es begleitet jede und jeden von uns ein Leben lang: das Lernen. Forscher haben in den vergangenen Jahrzehnten viel darüber herausgefunden, was genau beim Lernen in unserem Gehirn passiert und wie wir diesen Prozess unterstützen können. Jetzt machen sich viele Schulen in der Schweiz auf, mit diesem Wissen moderne Schullandschaften zu entwickeln, die nicht nur Lern-, sondern auch Lebensräume sind, in denen sich alle wohlfühlen sollen. Die zentrale Frage, die hinter all diesen Bemühungen steht, lautet: Wie können Schülerinnen und Schüler nachhaltig so unterstützt werden, dass sie selbst Verantwortung für ihre schulische Entwicklung übernehmen und ihr Lernen produktiv gestalten können?
Aber was genau heisst eigentlich gutes Lernen? Was können Lehrpersonen dazu beitragen, was Eltern? Und was ist dran an Lernmythen wie «Nur Übung macht den Meister» oder «Im Schlaf lernt es sich leichter»? Lernen, da sind sich Forschende einig, ist eine so gesunde Tätigkeit, dass sie uns ein Leben lang fit halten kann. Vorausgesetzt, wir machen es richtig und haben – nicht immer, aber oft – Freude daran.
Individuell lernen – aber wie?
Was die Wissenschaft weiss: Um gut lernen zu können, muss ich neue Informationen an das anknüpfen können, was ich bereits weiss. «Wenn es dieses bestehende Wissen zum Anbinden nicht gibt, geht alles Neue verloren, oder aber wir docken es ganz woanders und falsch an», sagt Elsbeth Stern. Die Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung leitet das Institut für Verhaltenswissenschaften an der ETH Zürich.
Woher weiss man, wo welches Kind gerade steht? Kein Lehrerurteil, keine Tests sind so präzise, um das einschätzen zu können.
Elsbeth Stern, Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung
Gleiche Lerngegebenheiten können also zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen, abhängig davon, was eine Schülerin oder ein Schüler schon weiss und was nicht. Die Lösung, so betonen viele Experten, ist das in den vergangenen Jahren immer populärer gewordene sogenannte individuelle Lernen. Dabei gestaltet die Lehrperson Aufgaben beispielsweise so, dass jedes Kind sie in dem Schwierigkeitsbereich lösen kann, der zu ihm passt.
Die Frage ist nur: Woher weiss man, wo welches Kind gerade steht? Kein Lehrerurteil, keine Tests seien so präzise, um das einschätzen zu können. «Klar können Lehrpersonen sehr schwache Schülerinnen und Schüler erkennen», sagt Elsbeth Stern, «aber Untersuchungen zeigen, dass sie hochbegabte Kinder oft übersehen.»
Wenn Gruppen gebildet würden, so Stern, bestehe die grosse Gefahr der Fehlklassifikation. Hinzu komme, dass ja nicht nur eine Momentaufnahme zähle, sondern der Stand des Kindes eigentlich permanent abgefragt werden müsste, um sicherzustellen, dass es weiter gut lernen kann.
Um gut zu lernen, muss ich neue Informationen an das anknüpfen können, was ich bereits weiss.
Elsbeth Stern, Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung
Als Lehrperson, sagt Stern, müsse einem bewusst sein, dass sich die Schülerinnen und Schüler einer Klasse im Vorwissen stark unterscheiden: «Viele Kinder haben Missverständnisse zu dem Thema, das gerade dran ist. Ich muss aber überhaupt nicht wissen, bei welchem Kind das so ist und bei welchem nicht, ich muss nur wissen, dass das so ist.»
Die Professorin empfiehlt, sich nicht nur mit unterschiedlichen Lernangeboten darauf einzustellen, sondern das auch in der Klasse zu thematisieren. So hätten die Schülerinnen und Schüler Verständnis dafür, wenn man einen Aspekt noch einmal wiederholen müsse. Mit dem sogenannten formativen Assessment lässt sich zudem leicht ermitteln, ob die Schülerinnen und Schüler verstanden haben, was die Lehrperson erklärt hat.
Lehrpersonen erkennen schwache Schüler, übersehen aber hochbegabte oft.
Elsbeth Stern, Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung
«Dafür könnte am Ende jeder Unterrichtsstunde ein kleiner anonymer Test gemacht werden», sagt Stern. «Wenn ich sehe, dass mindestens ein Viertel der Kinder ihn falsch machen, dann weiss ich, dass ich das in der nächsten Stunde noch einmal etwas genauer durchgehen muss.»

An Beispielen lernen
Mit anschaulichen Beispielen, das wissen Lernforscher schon lange, lassen sich mitunter selbst die komplexesten Themen gut vermitteln. Wobei es auch hier Grenzen gibt. «Wie man an einem Beispiel erklären könnte, dass minus mal minus plus ergibt, darüber haben sich schon einige Mathematikdidaktiker den Kopf zerbrochen.
Denn mehrfach Schulden ergeben ja im Produkt kein Vermögen», sagt Stern. Zahlen sind also, wie unregelmässige Verben auch, eine eigene Welt, in der man sich manchmal die Fakten mit viel Übung einprägen muss. Wobei es gerade in Mathe auch darauf ankommen kann, wie gefragt wird, erklärt Elsbeth Stern: «Wenn ich Vorschulkinder frage: ‹Fünf Vögel haben Hunger und finden drei Würmer – wie viele Vögel kriegen keinen Wurm?›, dann wissen das alle.
Würde ich formulieren: Wie viel mehr Vögel als Würmer gibt es?›, dann ist das für sie ungleich schwieriger zu beantworten.» Stern warnt allerdings davor, nur auf einfache Beispiele zurückzugreifen. So laufe man Gefahr, dass die Kinder zwar die Beispiele verstehen und anwenden, sie aber nicht in den Zusammenhang einordnen können.
Hier kann es helfen, zu einem Thema mehrere, bestenfalls kontrastierende Beispiele zu verwenden, die verschiedene Perspektiven aufzeigen. Beim Thema Wärmeleitung also nicht nur den Pfannkuchen, der auf dem Herd gebacken wird, sondern auch den Metallstab, der einen Eiswürfel schmelzen kann.

Auch sehr effektiv: Die Kinder mit Fragen neugierig machen, die sie – noch – nicht beantworten können. So könnte die Lehrperson in Physik fragen, warum ein schweres Schiff aus Stahl schwimmt, während ein kleines Stück Stahl im Wasser untergeht. Es muss nicht zwingend eine Frage sein, die die Kinder vom Hocker reisst, aber doch eine, die genug Anreiz schafft, dass sie die Antwort wissen wollen. «Es ist ja auch die Aufgabe der Schule, Kinder in Bereiche zu führen, die sie sich selbst nicht ausgesucht hätten», sagt Stern.
Viel Autonomie, wenig Führung
Statt von gutem spricht Jörg Berger lieber von zeitgemässem Lernen. Der Leiter der Schule Knonau ZH hat gemeinsam mit mehr als 50 Mitstreiterinnen und Mitstreitern eine Vision der Schule von morgen entwickelt, die im Buch «Schule 21 macht glücklich» nachzulesen ist. Sie bezieht sich auf den Lehrplan 21 und geht darüber hinaus.
Dieser beschreibt zwar den Bildungsauftrag an die Schulen als kompetenzorientiert, geht aber beispielsweise davon aus, dass soziale und personale Kompetenzen als Teilbereiche der überfachlichen Kompetenzen in erster Linie im familiären Umfeld erworben werden. Was aber, fragen die Autoren beispielsweise, wenn Kinder mehr Zeit in der Schule verbringen? Ergeht damit nicht automatisch ein erweiterter Auftrag an diese?
Schule sollte ein Lebensraum sein, in dem Kinder ihr Lernen selbst organisieren.
Schulleiter Jörg Berger
Die «Schule 21» wird nicht allein von professionell ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet, sondern von allen, die in und mit ihr lernen und leben. Dazu gehören Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehr- und Betreuungspersonen, aber auch lokale Kultureinrichtungen und Unternehmen. «Die Schule ist ein wichtiger Player in ihrem Viertel, sie interagiert mit anderen Institutionen, ist multikulturell und offen, kein in sich geschlossener Kosmos», so Berger.
Das Lernen müsse andersherum gedacht werden: weg vom Gedanken des Beschulens mit Hilfe des richtigen Unterrichtsmaterials, hin zu einem Lebensraum, in dem sich Schülerinnen und Schüler selber dafür verantwortlich fühlen, ihr Lernen zu organisieren. Kurz: sehr viel Autonomie, wenig Führung.
Können Schule und Eltern ein starkes emotionales Netz weben, ist das die Grundlage zum selbständigen Lernen.
«Entscheidend für den Erfolg solcher Konzepte ist immer, ob es damit auch denjenigen gut geht, die weniger gut aufnahmefähig sind und weniger Unterstützung von zu Hause bekommen», sagt Berger. Das sei bereits eine grosse Stärke der Volksschule: Alle werden gesehen und unterstützt, jeder kann partizipieren. Die Teilhabe ist auch für die zeitgemässe Schule essenziell. «Die Schule kann es sich aktuell gar nicht leisten, Personen zu verlieren, es ist eine Bedingung, dass wir alle mitnehmen können auf dieser Reise», sagt Berger.

Die «Schule 21» ermögliche gutes Lernen, indem sie drei Grundvoraussetzungen für die Schülerinnen und Schüler schaffe, erklärt Berger: Autonomie in Form von Freiräumen, die die jungen Menschen gestalten können, Kompetenz, um diese Freiräume nutzen zu können, und als Drittes die soziale Eingebundenheit.
«Das gilt nicht nur für Gruppen wie Freunde und Klassen, sondern auch für die Lehrperson, die sich für unser Vorankommen interessiert», sagt Berger. «Denn auch wenn wir nicht für die Lehrperson lernen, so wollen wir auch immer gern jemandem zeigen, wie und was wir lernen. Wird das wahrgenommen und unterstützt, wirkt sich das auf die Motivation aus.»
Die Kernfrage: Wo stehst du?
Lerntagebücher, Lernreflexion, Lernfeedback – wer gut lernen will, der sollte, nein, muss sogar darüber reden. Eben weil sich nicht alle Schülerinnen und Schüler einfach in drei Niveaus einteilen lassen, sondern Lernen eine höchst individuelle Sache ist, die immer wieder abgeglichen werden muss zwischen der, die lehrt, und der, die lernt.
Kernfragen für Lehrpersonen können dabei sein: Wo stehst du? Was hat dir geholfen? Was brauchst du als Nächstes? Und der Lernende sollte jederzeit signalisieren können, wo er gerade steht. «Zum Beispiel könnte ein Schüler mit Hilfe eines Farbsystems Feedback geben», sagt Schulleiter Jörg Berger. «Wenn er auf seinem Tisch einen Becher stehen hat und das grüne Symbol nach vorne dreht, heisst das: Alles okay, ich bin gut unterwegs.
Gelb heisst: Geht schon irgendwie, aber ich wanke etwas, Rückversicherung wäre gut. Rot heisst: Ich brauche dringend Hilfe!» Eine solche Möglichkeit, sich miteinander über das Lernen zu verständigen, sei nicht nur sinnvoll, sondern angesichts oft knapper Kapazitäten auch praktisch.

Doch es geht nicht nur um optimal gestaltete offene Lernaufgaben oder das ständige Hinterfragen des Lernfortschritts. Zu gutem Lernen gehört auch ein gutes Drumherum, eine gute Basis, die die Grundbedürfnisse des oder der Lernenden erfüllt. «Für Kinder ist es enorm wichtig, sich angenommen zu fühlen und Nähe zu erfahren, diese Sicherheit zu haben: Auch wenn mein Verhalten mal nicht okay ist, ich als Mensch bin in Ordnung», sagt Berger.
Gelinge es der Schule gemeinsam mit den Eltern, ein solch tragfähiges emotionales Netz zu weben, sei das eine solide Grundlage für selbständiges Lernen, das vor allem von den Interessen des Kindes geleitet sei. «Das trifft auch auf Sozialräume ausserhalb der Schule zu», sagt Berger, den es sehr erstaunt hat, als während der Pandemie Politiker so taten, als würden Kinder in acht Wochen ohne Schule nichts lernen. «Wir stimulieren, tragen an, helfen, unterstützen, begleiten – aber das Lernen an sich findet selbständig statt, es geht vom Kind aus, und das hört nicht auf, wenn es den Unterricht verlässt.»
Drei Mütter und die 11-jährige Aline über Lust und Frust beim Lernen und Tricks und Tipps, wie Eltern ihre Kinder motivieren können
Lernen in der Gemeinschaft
Das Lernen an sich, sagt Franziska Vogt, sei ein spannender, kreativer, engagierter Prozess. Die Leiterin des Instituts Lehr-Lernforschung an der Pädagogischen Hochschule St. allen beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie sich das Spiel – genauer Rollen- oder Regelspiele – auf Lernprozesse auswirkt und wie Dialoge zwischen Lehrperson und Lernenden förderlich gestaltet werden können.
«Es geht beim Lernen sehr viel um die intrinsische Motivation, doch dabei wird oft unterschätzt, wie wichtig gesellschaftliche Teilhabe und der Kontakt mit anderen sind», sagt Vogt. Auch der Wunsch, mit anderen gemeinsam etwas zu erleben, könne motivieren. Der soziale Austausch – der Lehrperson mit dem Kind und der Kinder untereinander – sei ein elementar wichtiger Bestandteil unserer Entwicklung und damit auch des Lernens.
Der soziale Austausch ist ein elementar wichtiger Teil unserer Entwicklung – und damit auch des Lernens.
Auch Vogt weist darauf hin, dass Lernen nicht in eine institutionelle Form gegossen ist, sondern neben dem formellen, schulischen Lernen das informelle Lernen unseren Alltag prägt. Wir lernen beiläufig auf Spaziergängen, beim Kochen, wenn uns der Opa von seiner Kindheit erzählt, beim Basteln von Geschenken, wenn wir berechnen, wie viele Wochen Sackgeld nötig sind, um uns den ersehnten Lego-Bausatz kaufen zu können.
Sehr wichtig sind nicht nur die fachlichen, also auf ein bestimmtes Fach ausgerichteten Kompetenzen, sondern auch die überfachlichen: Kann ich kommunizieren? Bin ich kreativ? Kann ich mit anderen zusammenarbeiten? Kann ich eine andere Perspektive einnehmen? «Solche Kompetenzen werden immer wichtiger, wir brauchen sie, um Dinge und Situationen richtig einzuschätzen, um zu lernen und um uns entwickeln zu können», sagt Vogt: «Sie sind das, was unser lebenslanges Lernen tragen wird.» Unerforscht sei allerdings noch, in welchem Verhältnis fachliche und überfachliche Kompetenzen wirksam fokussiert werden können.

Lernen muss nicht immer Spass machen
Schulisches Lernen spielt sich im Dreieck aus Lernenden, Lehrperson und Lerngegenstand ab. «Hier hat sich in den vergangenen 20 Jahren viel verändert», erklärt Vogt. «Die Lehrperson gibt nicht einfach Lernstoff vor, sondern macht ein Lernangebot für den Aufbau von Kompetenzen. Gefüllt wird dieser Raum dann vom Kind und der Lehrperson gemeinsam.»
Die Aufgabe von Lehrpersonen – und in gewissem Masse auch Eltern – ist es dabei, Aufgaben zu stellen und Lernangebote zu finden, mit denen eine Kompetenz erlernt werden kann. Nur einfach Spass machen, sagt Franziska Vogt, müsse Lernen nicht unbedingt. «Wenn ich etwas können möchte, ist der Weg dahin oft auch mit Effort verbunden, das ist eine Erfahrung, die zu machen durchaus sinnvoll ist», sagt Vogt.
«Man muss nicht alles als Spass deklarieren, wenn es das eigentlich nicht ist.» Im Englischen gibt es dafür die Bezeichnung «chocolate-covered broccoli», also mit Schokolade ummantelter Brokkoli, um zu zeigen, dass es abwegig ist, jede Übung als Spiel zu deklarieren. «Das Spiel kann sehr wirkungsvoll sein, um anspruchsvollere Inhalte zu transportieren und den Kompetenzaufbau zu unterstützen – dann ist es jedoch nicht Verpackung, sondern Lernerfahrung», sagt Vogt. Wirkungsvoll sei zudem, das Lernen in den konkreten Lebenszusammenhängen zu verankern: Fotos mit Sprachnachrichten kommentieren, Wunschzettel schreiben, einkaufen, kochen, Turniere veranstalten, für Aufführungen proben, Behausungen für Tiere bauen, einen Ausflug planen.
Abend für Abend stur die Vokabelliste rauf und runter pauken? Gemeinsam in der Gruppe üben oder besser allein? Braucht jedes Kind speziell auf es zugeschnittene Aufgaben? Lernen ist ein universelles und viel diskutiertes Thema. Denn es geht weit über den schulischen Unterricht hinaus. Kinder und Jugendliche lernen in der Schule, mit den Eltern bei Ausflügen, im Alltag beim Kochen oder Spielen mit Freunden. Lange Zeit lag selbstorganisiertes Lernen im Trend, doch damit waren viele auch überfordert. Inzwischen weiss die Wissenschaft recht genau, wie sich Lerner motivieren lassen und welche Faktoren im Lernumfeld dabei helfen. Wie also sieht gutes Lernen heute aus? Im kompletten Artikel lesen Sie die Antworten.