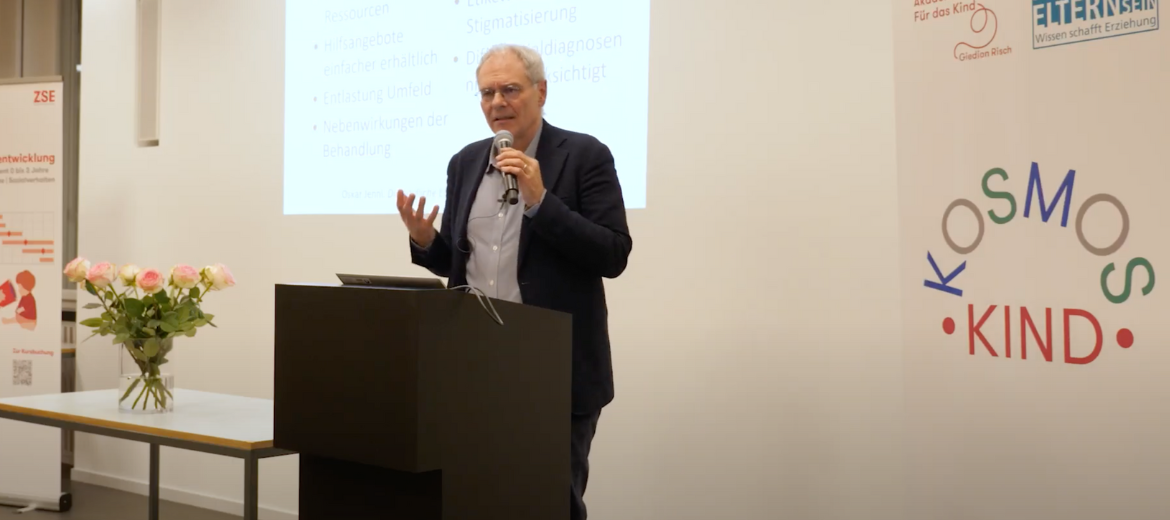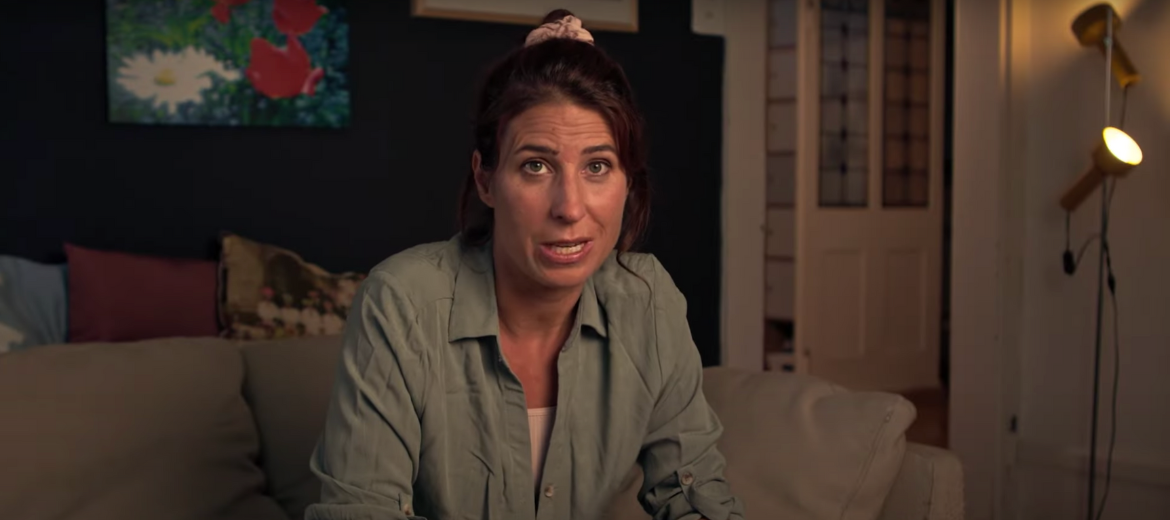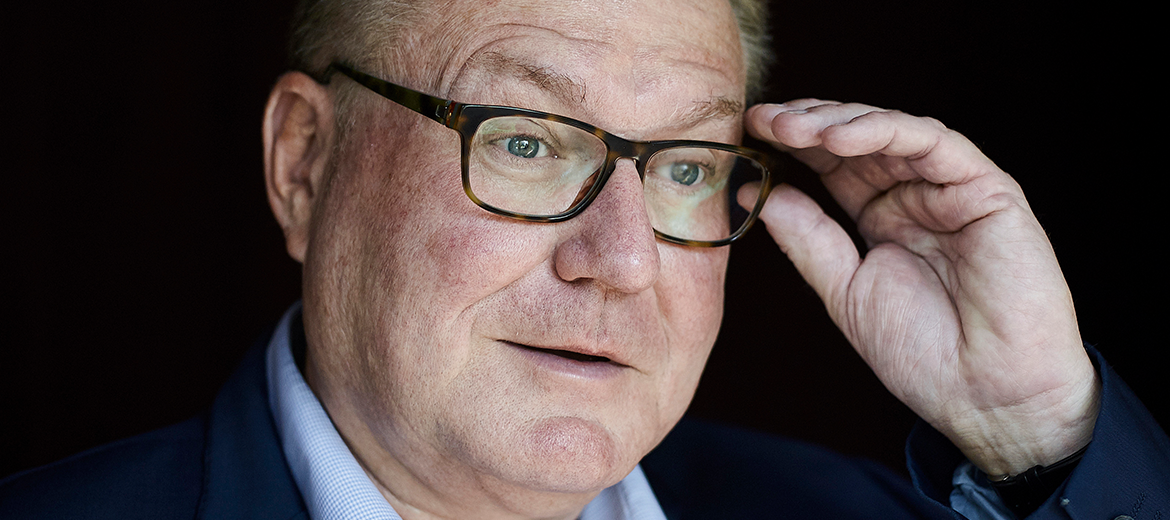ADHS und die ethischen Aspekte der Behandlung

Teil 9 der ADHS-Serie: ADHS gilt als die häufigste psychiatrische Krankheit bei Kindern. Eine ungenügende oder gar unterlassene Behandlung hat weitreichende Konsequenzen. Doch auch eine medikamentöse Behandlung ist nicht risikolos. Haben wir es also mit einem Dilemma, vielleicht gar einem moralischen, zu tun?
Aufmerksamkeitsdefizite und Formen der Hyperaktivität kommen bei Kindern überaus häufig vor, besonders bei Jungen. Beide Symptome – fehlende Fokussierung und übermässige, zuweilen ungeregelte und impulsive Tätigkeit – geben trotz weiterer Differenzierungen nur Hinweise auf die Krankheit, jedoch keinen sicheren Befund.
Daher ist eine präzise Diagnostik vonnöten, um jene Symptome einer eindeutigen Krankheit zuordnen zu können. Ist dies der Fall und handelt es sich demnach um ADHS, zeichnen sich unterschiedliche Stufen einer umfassenden Therapie ab.
Deren Spektrum reicht von der Umstellung der Ernährung sowie der Etablierung eines geregelten Tagesablaufs bis zu einer medikamentösen Behandlung. Zu Letzterer darf es dementsprechend erst kommen, sofern alle Möglichkeiten unterhalb der Verabreichung von Methylphenidat ausgeschöpft sind und zudem ein starker Grad von ADHS vorliegt.
Die medikamentöse Intervention kann trotz Nebenwirkungen nötig und förderlich sein, zumal man sich die Dringlichkeit verdeutlichen muss, die durch den lebensweltlichen Kontext dieser Krankheit bedingt ist: Sie kann einerseits das Sozialleben dieser Kinder stark behindern sowie sich nachteilig auf deren Ausbildung und damit deren Zukunft auswirken.
Eine medikamentöse Intervention kann trotz Nebenwirkungen nötig und förderlich sein.
Beide Aspekte können offensichtlich die weitere biografische Entwicklung verzögern, hindern oder gar schädigen. Hier gilt es, ganz besonders verantwortungsvoll abzuwägen.
Entscheidungsfindung
Im Folgenden soll nur der Fall genauer betrachtet werden, in welchem alle nichtmedikamentösen Therapien ausgeschöpft sind. Die Alternative lautet dann: entweder Methylphenidat (zumeist im Präparat Ritalin und unter weiteren Auflagen und Einschränkungen) verabreichen, dabei aber mögliche Nebenwirkungen in Kauf nehmen, oder diese umgehen mit dem Risiko, die Symptome nicht verringern zu können und negative Konsequenzen für das Lern- und Sozialverhalten der betroffenen Kinder zu akzeptieren.
Eine Entscheidung im Verbund von Ärzten, Eltern und den betroffenen Kindern, aber auch im Kontext einer umfassenden therapeutischen Strategie ist erforderlich. Dabei ist die Entscheidungsfindung in gewissem Rahmen bestimmt, da nicht alle Optionen zu jedem Zeitpunkt offenstehen. Wie angesprochen darf eine medikamentöse Intervention erst nach der Erprobung medizinisch zurückhaltenderer Alternativen und deren mangelhaftem oder ausbleibendem Erfolg begonnen werden.
Wie wir uns bei Dilemmata auch immer entscheiden, wir haben negative Resultate zu akzeptieren.
Entscheidungen setzen Alternativen voraus, und für jede dieser Alternativen müssen Gründe sprechen. Hätten wir es mit einer eindeutigen Situation zu tun, gäbe es nichts zu entscheiden. Und wären wir zwar mit unterschiedlichen Optionen konfrontiert, obgleich die Gründe unzweideutig für eine dieser Möglichkeiten sprechen, wäre das Nötige geklärt. Entscheidungen im engeren Sinne sind daher Abwägungen zwischen ähnlich guten (oder für ähnlich gut befundenen) Optionen.
Zudem handelt es sich um Situationen, in denen man sich entscheiden muss, weil die Vertagung ausgeschlossen ist; die Vertagung selbst wäre nichts anderes als eine Entscheidung. Diese Entscheidung erfolgt mit Blick auf angebbare Gründe, so dass eine zufällige oder spontane Wahl ausgeschlossen ist. In diesem engeren Sinn sind Entscheidungen rationale Abwägungen.
Und dennoch: Die wirklichen oder vermeintlichen Gründe zeigen nur eine Richtung auf und lassen immer noch Alternativen zu. Entscheidungen werden folglich mit Gründen getroffen, während man sich in einer Situation befindet, in der die «entscheidende» Person mit Gründen unterversorgt ist. Gründe zu haben, schliesst das Risiko nicht aus, falsch zu liegen, sondern minimiert es.
Forschende aus den Disziplinen Gesundheitswissenschaften, Psychologie, Pharmazie, Soziologie, Recht und Ethik hinterfragen in einem neuen Forschungsprojekt die Praxis der vermehrten Diagnose und medikamentösen Behandlung von Kindern mit Aufmerksamkeits-störungen. Im Forschungsprojekt werden schweizweit psychologische, medizinische und soziale Faktoren untersucht, die zur ADHS-Diagnose, zur Auswahl von Fördermassnahmen und zu einer Verschreibung von Medikamenten führen können. Dabei sollen auch präventive Massnahmen und alternative Behandlungswege beobachtet werden. Die Forschenden werden durch Expertinnen und Experten aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Medizin, Bildungsforschung und Schulentwicklung beraten. Unterstützt wird das interdisziplinäre Projekt durch die Stiftung Mercator Schweiz. Die Studie wird durchgeführt vom Institut für Familienforschung und -beratung (Universität Freiburg), vom Zentrum für Gesundheits-wissenschaften (ZHAW) und vom Collegium Helveticum (ETH/Universität Zürich). Gesucht werden Eltern von Kindern (6- bis 14-jährig), bei denen eine AD(H)S/POS-Diagnose oder der Verdacht auf ein Aufmerksamkeitsproblem vorliegt.
Kontakt: projektkinderfoerdern@unifr.ch.
Moralische Dilemmata
Sich in einem Dilemma zu befinden, ist der Extremfall der gerade geschilderten Situation. Auch hier stehen wir vor Alternativen, wobei sich Dilemmata dadurch auszeichnen, dass die Gründe, die jeweils für beide Optionen sprechen, gleich schwer wiegen.
Zwei Aspekte kommen hinzu: Zum einen erlauben auch dilemmatische Arrangements nicht, die Entscheidung aufzuschieben. Ein weiteres Abwarten bietet sich schon deshalb nicht an, weil es seinerseits eine Entscheidung darstellt – mit entsprechenden, gegebenenfalls negativen Folgen. Auch hier treffen wir auf die angesprochene Dringlichkeit der Entscheidung, deren Unterlassung uns nicht aus dem skizzierten Szenario entlässt, sondern weiter in dieses verstrickt.
Zum anderen haben es Dilemmata an sich, zweideutig zu sein: Wie wir uns auch entscheiden, wir haben negative Resultate zu akzeptieren. Anders gesagt: Dilemmata kennen keine «happy endings» ohne «bad ones». Beide der möglichen Optionen führen negative Effekte mit sich, und wie die positiven wiegen auch diese negativen gleich schwer. Ein Gleichgewicht negativer Konsequenzen bleibt unvermeidbar.
ADHS konfrontiert Betroffen, Eltern und Ärzte mit weitreichenden Entscheidungen.
Mit genuin moralischen Dilemmata haben wir es zu tun, wenn wir mit einer moralisch signifikanten Situation konfrontiert sind. Das heisst wiederum zweierlei: Nicht alle Dilemmata sind moralisch, da es selbstverständlich persönliche oder emotionale Dilemmata gibt; moralische Dilemmata hingegen betreffen die Integrität einer Person und/oder den sozialen Kontext, sodass durch eine Handlung das Leben von Mitmenschen fundamental betroffen ist.
Das im moralphilosophischen Diskurs schon klassische Beispiel ist das sogenannte Trolley-Szenario, bei dem n Personen getötet werden sollen, um n+x Personen zu retten. Gegenwärtig wird ein ganz ähnliches Szenario im Theaterstück «Terror» von Ferdinand von Schirach an mehreren Bühnen inszeniert.
In beiden Fällen stellt sich die Frage, ob es sich um Dilemmata handelt und wie wir selber entscheiden würden. Schirachs Stück etwa sieht vor, dass das Publikum zum Schöffen wird und das Urteil in einer Abstimmung selbst vornimmt, sodass – je nach Ergebnis – das Theaterstück zu Ende gespielt wird.
Teil 1: Leben mit ADHS
Teil 2: Mein Kind hat ADHS
Teil 3: Kranke Kinder oder kranke Gesellschaft?
Teil4: ADHS – welche Rechte haben Kinder?
Teil 5: ADHS und Schule
Teil 6: Ritalin gegen ADHS – Fluch oder Segen?
Teil 7: Diagnose ADHS
Teil 8: Mein Kind hat ADHS – und jetzt?
Teil 9: ADHS und die ethischen Aspekte der Behandlung
Teil 10: ADHS und Psychotherapie
Teil 11: ADHS-Therapie ohne Medikamente. Grosser Nutzen, kleines Risiko
Hier können Sie die 11-teilige Serie über ADHS als PDF herunterladen
ADHS und ihre Behandlung – ein moralisches Dilemma?
Kommen wir zum Ausgangspunkt zurück: ADHS konfrontiert uns – die Betroffenen, die Eltern und Ärzte – mit weitreichenden Entscheidungen. Diese Entscheidungen mit Blick auf die Therapie, auch hinsichtlich einer medikamentösen Therapie oder deren Ablehnung bzw. Aussetzung, sind nicht zu umgehen. Und für alle Optionen könnten gute Gründe sprechen – aber eben auch gewichtige dagegen.
ADHS kann beim Versagen aller konservativen Möglichkeiten mit einem Wirkstoff behandelt werden, um Aufmerksamkeit und Lernverhalten effektiv zu steigern, obgleich dieser Effekt nicht sicher ist und Risiken birgt. Diese wiederum kann man umgehen, indem man von der Verabreichung von Methylphenidat absieht, obgleich man dann akzeptiert, die Kinder in biografisch ganz entscheidender Hinsicht womöglich zu benachteiligen, da ihr Lernverhalten und eine fehlende Konzentration eine höhere Bildung stark erschweren könnten.
Entscheide können moralisch sein, da man die Verantwortung für einen Menschen übernimmt.
Fassen wir zusammen: Konfrontieren ADHS und ihre Behandlung tatsächlich mit einem moralischem Dilemma? Zumeist nicht – aber manchmal und im Grenzfall eben doch. Denn der oben beschriebene Fall einer grundlegend ambivalenten Entscheidungssituation, die moralisch zu nennen ist, kann durchaus eintreten, weil hier umsichtig und sensibel die Verantwortung für einen Menschen zu übernehmen ist.
Und die zweite Frage: Warum überhaupt sollten wir ADHS und ihre Behandlung vom dilemmatischen Grenzfall (der also die Ausnahme bleibt) aus betrachten? Ganz einfach: weil die Steigerung und Zuspitzung eines bestimmten Szenarios dessen interne Schwierigkeiten und Herausforderungen viel deutlicher hervortreten lassen.
ADHS und ihre Behandlung ist nicht per se ein Dilemma, kann aber zu einem werden. Und dieser moralisch signifikante Umstand klärt analytisch und begrifflich, wie vorsichtig alle Involvierten eine anstehende Entscheidung abzuwägen haben, aber zugleich auch, wie diese Abwägung überhaupt aussieht, welche Formen sie in der Praxis annehmen kann und welche Möglichkeiten offenstehen – oder gar notwendigerweise verschlossen bleiben.
Für manche ist es die Modediagnose unserer Zeit, für andere die häufigste psychische Störung im Kindes- und Jugendalter: ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) bzw. ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom). Betroffen sind rund 5 bis 6 Prozent aller Kinder. Jungen deutlich öfter als Mädchen. Diagnostiziert wird die Krankheit aber weitaus häufiger.
Diese zehnteilige Serie entsteht in Zusammenarbeit mit dem Institut für Familienforschung und -beratung der Universität Freiburg unter der Leitung von Dr. Sandra Hotz. Die Juristin leitet zusammen mit Amrei Wittwer vom Collegium Helveticum das Projekt «Kinder fördern. Eine interdisziplinäre Studie», an dem auch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW beteiligt ist. Das Projekt wird von der Mercator Stiftung Schweiz unterstützt.