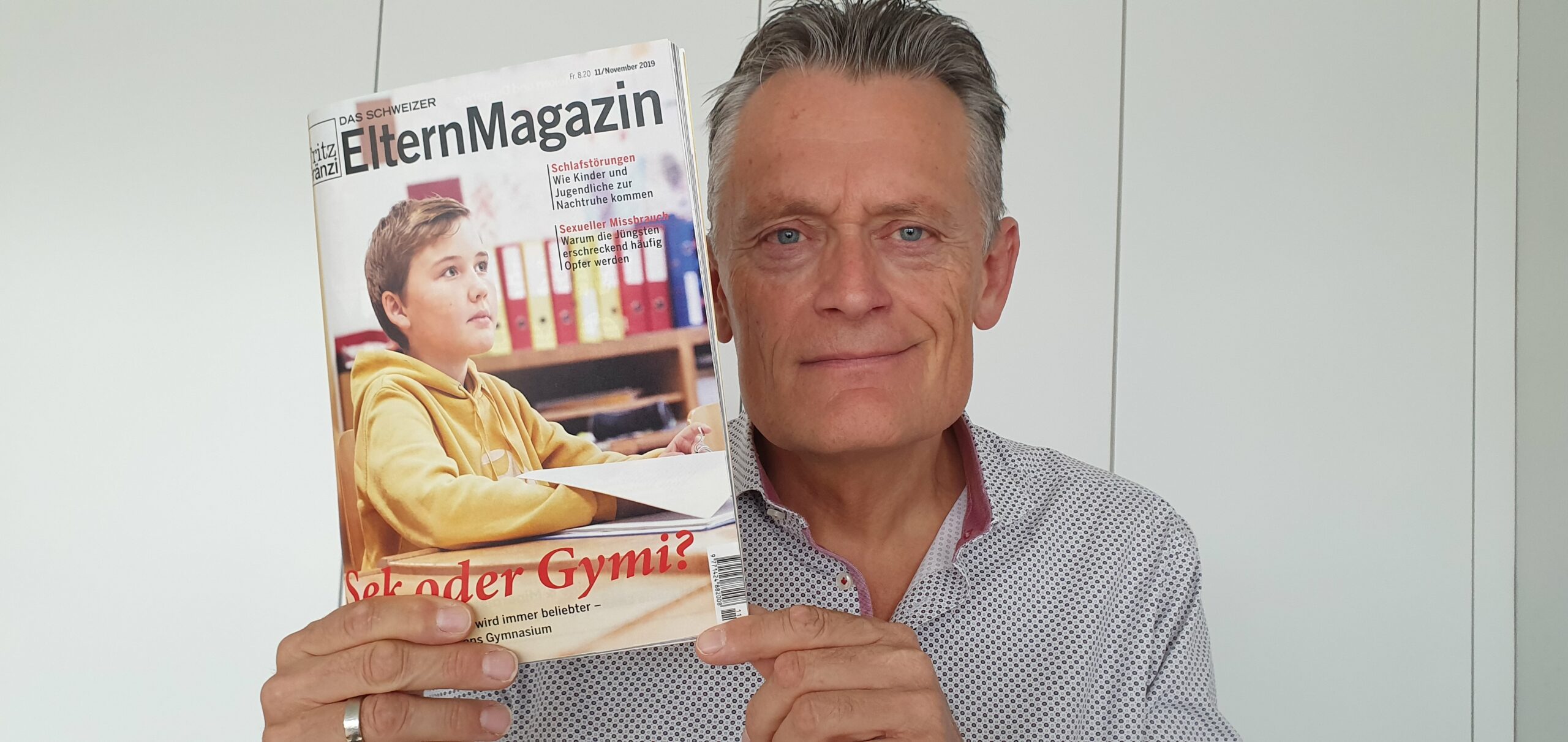Wer gehört aufs Gymnasium und wer nicht?

Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm über die Vorteile unseres dualen Bildungssystems, ehrgeizige Eltern und die Fehlannahme, dass Jugendliche mit guten Noten automatisch ans Gymnasium gehören.
Frau Stamm, in jedem Gespräch zum Thema Gymnasium kommt man irgendwann auf Kinder, die von ihren Eltern gedrillt werden. Inwiefern entspricht das Bild der ehrgeizigen Mütter und Väter der Realität?
Ich würde nicht von Drill sprechen, das klingt nach schwarzer Pädagogik. Aber sie sind eine Realität, diese kontrollierenden Eltern, die vor lauter Eifer, das Beste zu wollen, die Distanz zum Kind und zur Situation verlieren. Dieser Eindruck ergibt sich auch im Austausch mit Lehrpersonen. Unlängst berichtete mir die Rektorin eines Schweizer Gymnasiums, dass sie es immer öfter mit Müttern und Vätern zu tun habe, die Klassenzuteilungen ändern, Prüfungsresultate anfechten oder auf den Unterricht Einfluss nehmen wollen. Sie ging von gut 25 Prozent der Elternschaft aus.

Warum verhalten sich Eltern so?
Zu kurz greift die Erklärung, dass sie aus purem Ehrgeiz handeln. Vielmehr sind ihre Entscheidungen von einer gesellschaftlichen Haltung beeinflusst, die Leistungsorientierung und Wettbewerb fördert und bei Missständen auf die Eigenverantwortung verweist. Für Mütter und Väter bedeutet dies, dass sie für das Gelingen ihrer Kinder verantwortlich sind: Hat der Nachwuchs Erfolg, ist es ihr Verdienst, gibt es Probleme, sind sie schuld, weil sie zu wenig investiert haben. Da trägt unser Bildungssystem nicht zur Entspannung bei.
Inwiefern?
In verschiedenen Kantonen werden Kinder schon im Kindergarten anhand eines mehrseitigen Katalogs beurteilt. Stehen ein paar Kreuzchen am unerwünschten Ende der Skala, müssen Eltern häufig eine Vereinbarung unterschreiben, die vorsieht, dass die Eltern mit dem Kind üben. In der Primarschule folgen weitere Standortbestimmungen, von denen es heisst, sie seien stärkeorientiert, aber faktisch sind es Tests. Kommt dazu, dass viele Berufe, die früher keine Matura erforderten, auf die tertiäre Stufe angehoben wurden. Für Eltern ist das ein klares Signal: Es wird nicht einfach.
Schreibt ein Kind gute Noten, heisst es oft vorschnell: ab ins Gymi. Es wäre wünschenswert, dass die Schule nicht so stark auf Noten fokussieren würde.
Trotzdem gibt es Grund zu Optimismus: Via Berufsmaturität kann in der Schweiz auch ein Handwerker studieren.
Das stimmt. Wir haben eines der besten Bildungssysteme, was die Durchlässigkeit betrifft. Über die Möglichkeiten, die es bietet, wissen Eltern aber oft zu wenig Bescheid. Die gymnasiale Matura hingegen sehen sie als Passepartout und wähnen ihr Kind damit auf der sicheren Seite. Dazu kommt die steigende Anzahl hochqualifizierter Arbeitskräfte, die einwandern. Viele Expats sind Eltern, und vielen liegt daran, dass ihre Kinder die Matura machen, weil sie später vielleicht in ihr Heimatland zurückkehren, wo dieser Schulabschluss Standard, die duale Berufsbildung hingegen unbekannt ist. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Eltern sich immer stärker einmischen. Ausserdem hat die Schule sie dazu eingeladen.
Wie meinen Sie das?
Früher beschränkte sich der Austausch zwischen Eltern und Lehrpersonen auf einen Elternabend pro Jahr, dann führte Zürich vor gut 20 Jahren als erster Kanton die Elterngespräche ein. Mittlerweile müssen alle Schweizer Lehrpersonen ein bis zwei Gespräche pro Jahr durchführen. Die Standesregeln ihres Berufsverbandes verpflichten sie, mit den Eltern «zusammenzuarbeiten». Damit hat sich die Bildungspolitik selbst ein Ei gelegt, denn von dieser Möglichkeit machen gewisse Eltern – wir reden von der gut gebildeten Mittelschicht – in zuweilen ungebührlichem Masse Gebrauch. Die anderen hingegen schweigen.
Was dazu führt, dass nicht die Fähigkeiten eines Kindes, sondern seine soziale Herkunft über den Zugang ans Gymnasium entscheidet.
Wir haben es mit einer erheblichen Anzahl von Kindern zu tun, die ihr intellektuelles Potenzial nicht verwirklichen können, weil die Bedingungen zu Hause nicht stimmen. In der Bildungspolitik haben Massnahmen gegen diese Ungerechtigkeit nicht die Priorität, die sie verdienen. Man tut zu wenig und argumentiert stattdessen mit der Durchlässigkeit des Bildungssystems. Diese ist ein schwacher Trost für Kinder, die bereits beim Kindergarteneintritt im Rückstand sind, weil sie nicht Deutsch können oder keine geregelten Tagesstrukturen kennen.
Was könnte Abhilfe schaffen?
Der Staat hätte aus meiner Sicht die Aufgabe, früh in betroffene Familien einzugreifen, und zwar auf verpflichtender Basis. Ob nun in Form von Ganztagesstrukturen wie Vorschulen oder Sprachförderkursen. Sinnvoll wäre es, Kinder im Alter von etwa drei Jahren abzuholen. Aber in solchen Fragen ist sich hierzulande niemand einig. Gut situierte Eltern werden jedenfalls nicht aufhören, ihre Kinder zu fördern, das ist ihr Recht.
Selbständiges Denken, Eigeninitiative oder Ausdauer sind wichtige überfachliche Kompetenzen, um im Gymnasium bestehen zu können.
Wer gehört aus Ihrer Sicht ans Gymnasium?
Kinder, die entsprechende kognitive Fähigkeiten wie eine gute Auffassungsgabe, vor allem aber auch akademische Interessen mitbringen. Das bedeutet, dass sie gerne lernen, Freude daran haben, sich hinzusetzen, in Inhalte zu vertiefen oder an einer Aufgabe zu knobeln. Leider geht vergessen, dass Kinder oft weder gute kognitive Fähigkeiten noch besagte Neigungen haben. Und es gibt Jugendliche, die zwar wendig im Geist, aber auf Dauer unzufrieden sind, wenn sie die Schulbank drücken müssen. Schreibt ein Kind gute Noten, heisst es oft vorschnell: ab ins Gymi. Es wäre wünschenswert, dass die Schule nicht so stark auf Noten fokussieren würde.
Was schlagen Sie stattdessen vor?
Im Lehrplan 21 wurde den sogenannten überfachlichen Kompetenzen ein besonderer Stellenwert eingeräumt. Ich hoffe, dass dies irgendwann auch in der Praxis der Fall sein wird. Im Hinblick aufs Gymnasium sind zum Beispiel selbständiges Denken, Eigeninitiative oder Ausdauer wichtige überfachliche Kompetenzen, um in diesem Schultyp und später an der Uni bestehen zu können. Sinnvollerweise müsste sich die Schule stärker an solchen Voraussetzungen orientieren – und an Elterngesprächen früh thematisieren, inwiefern ein Kind sie mitbringt. Der Tunnelblick auf die Noten hat problematische Folgen.
Nämlich?
Er führt dazu, dass Kinder und Eltern mit vereinten Kräften auf ein Produkt hin büffeln: den Mindestnotenschnitt oder Prüfungen. So bringen wir Kinder erstens um die Erfahrung, dass Lernen Spass machen kann, und nehmen ihnen langfristig die Freude an der Schule. Zweitens lenkt dieser Fokus aufs Produkt vom selbständigen Denken ab, was dazu führt, dass viele junge Menschen nicht wissen, was sie interessiert, sondern einfach tun, was den Erwartungen entspricht, in der Regel jenen der Eltern. Die wiederum sind zufrieden, wenn der Nachwuchs spurt – und gerne bereit, ihm dafür alles andere abzunehmen. An der Universität Fribourg, wo ich dozierte, war es zu Semesterbeginn üblich, dass unter 30 Studenten auch gut sechs Mütter sassen, die wissen wollten, was den Nachwuchs erwartet. Den Jungen schien es nicht peinlich zu sein.