Wann bekommt mein Kind einen Nachteilsausgleich?

Bild: DEEPOL/Plainpicture
Mehr Zeit bei den Prüfungen, andere Formen der Lernkontrolle und das Hinzuziehen von Hilfsmitteln: Massnahmen, um Kindern und Jugendlichen Prüfungssituationen zu erleichtern, gibt es einige –
aber wer hat Anrecht auf einen Nachteilsausgleich und wer nicht?
Robin besucht die vierte Klasse. Das Lernen fiel ihm seit Beginn seiner Schulzeit schwer. Obwohl sich der Junge immer voll einsetzte, brauchte er für fast alle Lerninhalte länger als seine Kameraden. Jetzt, in der Mittelstufe, öffnet sich die Leistungsschere immer weiter. Das macht Robin und auch seinen Eltern grosse Sorgen.
Behinderungsbedingte Nachteile müssen nach dem Gesetz ausgeglichen werden, insbesondere bei Prüfungen.
Lia, Robin und Eronita haben derzeit mit unterschiedlichen Schwierigkeiten und «Nachteilen» bezüglich ihres Lernens und ihres Schulerfolgs zu kämpfen. Haben sie deshalb Anrecht auf einen Nachteilsausgleich in der Schule? Nein, das haben sie nicht. Jedoch: Sie haben Anrecht auf eine gezielte Unterstützung auf ihrem Lern- und Entwicklungsweg. Aber dazu später mehr.
Die Bundesverfassung verbietet Diskriminierung
Eine erste Antwort finden wir in der Bundesverfassung. Dort steht in Artikel 8, dass kein Mensch diskriminiert werden darf, sei es wegen seiner Herkunft, des Geschlechts, der sozialen Stellung oder einer Behinderung.
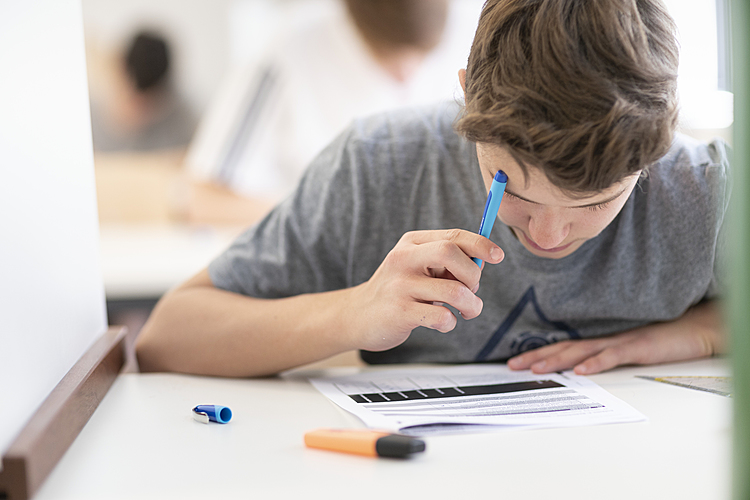
Massnahmen müssen stets individuell festgelegt und dürfen nie standardmässig umgesetzt werden.
Ungleichbehandlung, um Gleichbehandlung zu erreichen
Hier greift das Behindertengleichstellungsgesetz. Die Prüfungsbedingungen müssen für diesen jungen Mann aufgrund seiner Behinderung angepasst werden. In einem gemeinsamen Treffen unter Einbezug der Schulleitung wird eine schriftliche Vereinbarung erstellt. In ihr ist festgehalten, dass eine individuelle, einstündige schriftliche Prüfung durchgeführt wird.
Damit kann eine Diskriminierung des Prüflings aufgrund seiner Behinderung verhindert werden. Mit anderen Worten: Durch eine bewusste Ungleichbehandlung wird eine Gleichbehandlung erreicht.
Es braucht konkrete Leitplanken für die Einschätzung im Einzelfall
Man kommt nicht dank einer Behinderung leichter durch eine Prüfung oder erhält eine bessere Note. Das wäre unfair.
- Eine Funktionseinschränkung im Sinne einer Behinderung muss klar diagnostiziert sein. Weil ein Nachteilsausgleich nur dann infrage kommt, wenn eine ausgewiesene Behinderung vorliegt, braucht es ein Gutachten einer anerkannten Fachstelle. Neben der Diagnose muss beschrieben werden, wie sich die behinderungsbedingten Funktionseinschränkungen beim Lernen und in Prüfungssituationen konkret auswirken.
- Massnahmen des Nachteilsausgleichs müssen individuell festgelegt werden. Nachteilsausgleichsmassnahmen dürfen nie standardmässig umgesetzt werden, beispielsweise im Sinne von: «Bei Schülern mit ADHS-Diagnose geben wir bei allen Prüfungen 20 Prozent Zeitzuschlag.» Vielmehr muss individuell eingeschätzt werden, welche Massnahmen im individuellen Fall angemessen und fair erscheinen.
- Die Bildungsziele, die es zu erreichen gilt, dürfen inhaltlich nicht reduziert werden. Daher ist es falsch, von «Prüfungserleichterungen» zu sprechen. Dieser Begriff suggeriert, dass man dank einer Behinderung einfacher durch die Prüfung kommt oder eine bessere Note erhält. Das wäre gegenüber den anderen Schülerinnen und Schülern unfair.
Die gängigsten Massnahmen des Nachteilsausgleichs
Eine weitere Möglichkeit besteht (wie beim Beispiel des Zimmermannlehrlings) darin, den Prüfungsmodus zu ändern: schriftlich statt mündlich, oder auch umgekehrt.
Die Erlaubnis, gewisse Hilfsmittel benützen zu dürfen, kann behinderungsbedingte Einschränkungen verringern helfen. Bei motorischen Störungen ist das Schreiben mit Tastatur oft besser möglich als von Hand. Bei ausgeprägter Leseschwäche kann ein Tablet hilfreich sein, mit dem Texte fotografiert, digitalisiert und über Kopfhörer angehört werden können.
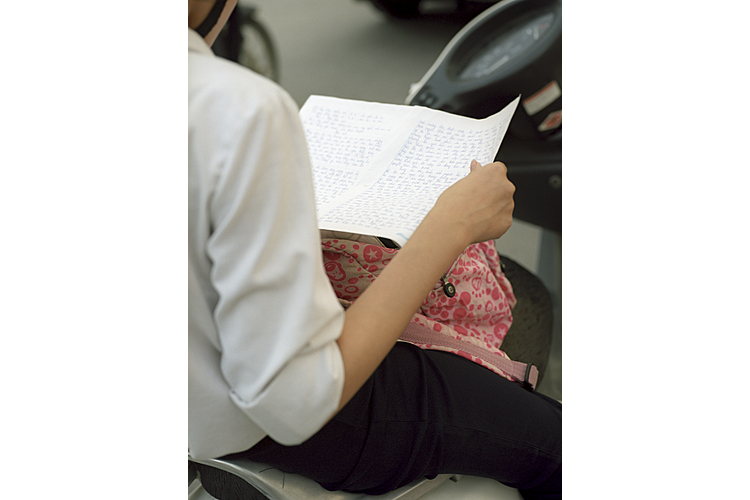
Diese Aufzählung macht nochmals deutlich, dass bei Nachteilsausgleichsmassnahmen keine inhaltlichen Änderungen am Lernstoff gemacht werden. Es werden lediglich die äusseren Rahmenbedingungen des Lernens oder der Prüfungen angepasst. Das ist für die Schule immer mit organisatorischem Aufwand verbunden. Ein gewisser Aufwand vonseiten der Lehrpersonen kann erwartet werden. Der Aufwand muss aber in einem angemessenen Rahmen bleiben, damit er im schulischen Alltag leistbar ist.
Erschwerungen des Lernens, aber kein Nachteilsausgleich?
- Lia macht zwar eine schwierige Phase durch, hat deswegen aber nicht eine eigentliche Behinderung. Nachteilsausgleich ist bei ihr deshalb nicht der richtige Ansatz. Wichtig ist, dass an einem Standortgespräch ihre aktuelle Situation besprochen wird. Vielleicht finden die Beteiligten gemeinsam hilfreiche Lösungen. Allenfalls ist der Beizug des Schulsozialarbeiters oder der Schulpsychologin sinnvoll.
- Robin ist zunehmend nicht mehr in der Lage, die regulären Lernziele zu erreichen. Angepasste Lernziele sowie eine entsprechende sonderpädagogische Unterstützung erscheinen für ihn sinnvoll. Um dieses Vorgehen zu prüfen, sind ein Standortgespräch und eine Einschätzung des Schulpsychologischen Dienstes wichtig. Weil bei einem Nachteilsausgleich immer reguläre Lernziele verfolgt werden, sind Nachteilsausgleichsmassnahmen bei Robin nicht passend.
- Eronita muss bezüglich ihres Nachteils, die Unterrichtssprache noch ungenügend zu beherrschen, gezielt mit Unterricht in «Deutsch als Zweitsprache» unterstützt werden. Weil erkannt wurde, dass sie voraussichtlich hohe Lernziele erreichen kann, muss sie auf diesem Weg von ihren Lehrpersonen gut begleitet werden. Ein Nachteilsausgleich wäre bei ihr weder zu legitimieren, noch würde ihr diese Massnahme etwas bringen.
Wie können Eltern oder Lehrpersonen vorgehen, wenn sie unsicher sind, ob ein Nachteilsausgleich bei einer Schülerin oder einem Schüler angezeigt ist?
Der erste Schritt ist immer ein gemeinsames Standortgespräch. Dabei könnte der folgende «Fünf-Punkte-Fragenkatalog» sinnvoll sein. Ergänzt sind jeweils die Antworten zum Beispiel des beschriebenen Zimmermannlehrlings.
1. Was ist der Kern dessen, was erreicht werden soll?
Das Wissen in Berufskunde soll an der Lehrabschlussprüfung gezeigt werden können.
2. Hat die Schülerin/der Schüler das Potenzial, die geforderte Leistung zu zeigen?
Ja, der Jugendliche hat die Fähigkeit, sich dieses Wissen anzueignen.
3. Wurde eine Behinderung von einer anerkannten Fachstelle diagnostiziert?
Ja, das schwere Stottern ist in einem logopädischen Gutachten nachgewiesen.
4. Welche Barrieren bestehen aufgrund der Behinderung?
Das erlernte Wissen im Fach Berufskunde kann in der vorgesehenen 30-minütigen mündlichen Prüfung aufgrund des schweren Stotterns nicht gezeigt werden.
5. Welche Nachteilsausgleichsmassnahmen können diese Barriere beseitigen helfen?
Die Prüfung wird schriftlich durchgeführt. Die Dauer wird auf eine Stunde festgelegt.
Ausgleichende Massnahmen sollen selten eingesetzt werden
Infos zum Nachteilsausgleich
Dort finden Sie unter anderem die folgenden Links und Dokumente zum Herunterladen:
- Der «Orientierungsrahmen Nachteilsausgleich» sowie die «Wegleitung Nachteilsausgleich» bieten vertiefte Informationen zum Nachlesen.
- Ein Kurzfilm des Zürcher Volksschulamts erklärt den Nachteilsausgleich kompakt in drei Minuten.
- Ausführlichere Informationen erhalten Sie in einem 45-minütigen Referat von Peter Lienhard.
- Schriftliche Nachteilsausgleichsvereinbarungen liegen in Form eines leeren Rasters und eines ausgefüllten Beispiels vor.
Lesen Sie mehr zum Thema Schule:
- Sek oder Gymi: Was ist besser für mein Kind?
Eltern wünschen ihren Kindern Erfolg – viele betrachten die Matura als Garant dafür. Dabei geht vergessen, dass der vermeintliche Königsweg nicht für jeden der richtige ist. Wer gehört ans Gymnasium? Wer sollte lieber eine andere schulische Bahn einschlagen? Und welche Folgen hat es, wenn die Matura für immer mehr Kinder zum Ziel wird? Eine Bestandsaufnahme.
- «Frau Stern, was bestimmt unsere Intelligenz?»
Wem verdanken wir unsere geistigen Fähigkeiten? Intelligenzforscherin Elsbeth Stern über Sinn und Unsinn von IQ-Tests und den Einfluss der Umwelt auf unsere Intelligenz. - Wie Inklusion gelingt
Jedes Kind mit einer Behinderung oder Lernstörung hat in der Schweiz grundsätzlich Anspruch auf Unterricht in einer Regelschule. Auch die 13-jährige Sophie. Wie gelingt Inklusion? Und warum profitieren alle vom gemeinsamen Unterricht? - Wann braucht mein Kind eine Therapie?
Ein Kind hält den Stift nicht richtig, ein anderes kann beim Turnen nicht auf einem Bein hüpfen – diese Dinge kommen im schulischen Standortgespräch im Kindergarten zur Sprache. Oft folgt ein Therapieangebot: Welche Therapieformen gibt es und wie sinnvoll sind diese?


















