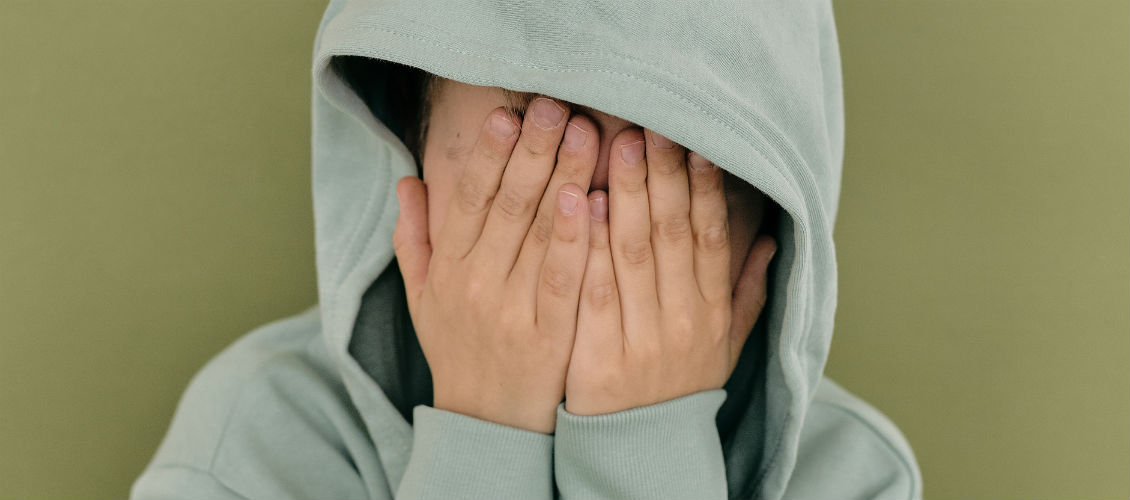Was tun, wenn mein Kind gehänselt wird?

Ist ein Kind Hänseleien ausgesetzt, kann es sich ganz unterschiedlich verhalten. Wie, hängt stark von seiner Persönlichkeit ab. Wichtiger als seine Reaktion ist aber die Frage, wie es sich dabei fühlt.
Der ganze Pausenplatz liegt voller Schnee. Ein Junge hat von zu Hause seine Schneeschaufel mitgebracht und schippt begeistert Schnee. Drum herum ein Kreis von Kindern, die sich über ihn lustig machen. «Wie kann der nur mit einer Schneeschaufel in die Schule kommen?!» «Mega uncool!» Dann kicken sie dem Jungen den Schnee wieder vor die Füsse. «Du hast was vergessen!»
Als Beobachter wartet man nur darauf, dass der Junge einen dummen Spruch zurückruft. Oder gar mit der Schaufel auf die Kinder losgeht. Doch er lässt sich nicht beirren und schaufelt in aller Ruhe weiter. Hat er Angst, sich zu wehren? Sollte man ihn vielleicht unterstützen? Oder macht ihm das eventuell gar nichts aus?
Kinder können manchmal ganz schön gemein zueinander sein. Für Erwachsene ist das oft schwer auszuhalten. Erst recht, wenn ein Kind dabei ist, das solchem Spott und solchen Hänseleien und dummen Sprüchen scheinbar nichts entgegenzusetzen hat. Sich alles gefallen lässt, statt selbstbewusst und schlagfertig zu reagieren. Immer nur einsteckt, statt auch mal auszuteilen.
«Ob und wie Kinder sich wehren, hat mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun», sagt Christelle Schläpfer, Elternberaterin und Mobbingexpertin. Zunächst einmal bringt jedes Kind eine ganz eigene Persönlichkeit mit. Die einen sind eher zurückhaltender, andere geben gern den Ton an. Das wirkt sich auch auf ihr Sozialverhalten aus. Ruhigere Kinder wehren sich vielleicht nicht so lautstark – das muss aber nicht weniger wirksam sein.
Selbstwirksamkeit testen
«Manchmal ist schweigen stärker als handeln», sagt Christelle Schläpfer. Denn reagiert ein Kind offensiv und schlagfertig, bedeutet das gleichzeitig auch: Es hat den Angriff an sich herankommen und sich provozieren lassen – und muss deshalb nun zurückschlagen, wenn auch nur mit Worten.
Das ist ja das Ziel von Hänseleien: schauen, welche Reaktionen man dadurch bei anderen herauskitzeln kann. Werden sie rot? Fangen sie an zu weinen? Werden sie handgreiflich? Laufen sie weg? «Für Kinder ist das sehr spannend, herauszufinden, was passiert, wenn man solche Knöpfchen drückt. Sie testen damit ihre Selbstwirksamkeit», sagt Regula Bernhard Hug, Leiterin der Geschäftsstelle von Kinderschutz Schweiz.
Wie geht es dem Kind dabei?
Dieses Testen fängt schon bei ganz kleinen Kindern an, wenn sie den Löffel auf den Boden werfen, um zu beobachten, was die Erwachsenen tun. Schon dieses Spiel macht nur dann Spass, wenn die Eltern darauf reagieren. Bleibt der Löffel dagegen auf dem Boden liegen und die Eltern kümmert das nicht, wird es ganz schnell langweilig.
Entscheidend beim Hänseln ist also weniger die Frage, wie das Kind reagiert, sondern vielmehr, wie es ihm mit seiner Strategie geht. Wenn die Hänseleien am Jungen mit der Schneeschaufel abprallen, weil er ein starkes Selbstwertgefühl hat oder ihm die anderen Kinder schlicht egal sind, dann hat er für sich einen guten Weg gefunden, damit umzugehen.
Wenn man sieht, dass ein Kind unter den Hänseleien leidet, muss man als Erwachsener eingreifen.
Andreas Schick, Psychologe
Es kann aber auch sein, dass er nur deshalb nicht auf die Hänseleien reagiert, weil er Angst hat, vor lauter grösseren Kindern den Mund aufzumachen. Oder weil unter den Spöttern auch seine Freunde sind, die ihn gerade im Stich lassen. Oder weil er tatsächlich keine andere Strategie kennt als das Schweigen, sich dabei aber schlecht fühlt.
«Sobald Erwachsene sehen, dass ein Kind unter einer solchen Situation leidet, dann schreitet man natürlich ein», sagt Andreas Schick, Psychologe und Familientherapeut im Heidelberger Präventionszentrum, einem Institut, das sich auf Gewaltprävention spezialisiert hat. Nicht selten seien es jedoch die Erwachsenen, die mit den Hänseleien ein Problem hätten und sich deshalb einmischen würden. «Man kann das betroffene Kind ja auch einfach mal fragen, wie es die Situation gerade erlebt», so Schick.
Hilfe holen ist kein Petzen
Geht man als Eltern dazwischen, empfiehlt Christelle Schläpfer, das geschwächte Kind aus der Situation herauszuholen und etwas zu sagen wie: «So ein Verhalten tolerieren wir nicht, wir wollen einen respektvollen Umgang miteinander.» Was dagegen kontraproduktiv sei: mit dem Angreifer zu schimpfen oder ihn zum Aufhören bewegen zu wollen. «Dadurch bekommt er nur negative Aufmerksamkeit», so Schläpfer.
Neben der Persönlichkeit spielt auch die Erziehung eine entscheidende Rolle dabei, wie Kinder mit Foppereien umgehen. «Sie schauen sich ganz viel von ihrem Sozialverhalten bei anderen ab», sagt Christelle Schläpfer. Herrscht zu Hause ein wertschätzender, respektvoller Umgang untereinander, bei dem es wichtig ist, die Meinungen des anderen zu hören? Oder wächst ein Kind mit Anschreien, Drohen, Erpressen auf? «Je nachdem entwickelt es ganz andere Strategien, damit umzugehen, wenn es ausgelacht oder gehänselt wird», sagt Andreas Schick.

Nur eine Minderheit spricht über Mobbing
Eine dieser Strategien ist es, sich an Erwachsene – seien es Lehrer oder Eltern – zu wenden. Unter Kindern wird dieser Weg meist als «Petzen» abgestempelt. «Petzen tue ich, wenn ich mir nur deshalb Hilfe hole, um Aufmerksamkeit zu bekommen», findet Andreas Schick. Sobald es aber darum gehe, Probleme zu lösen – und man vielleicht selbst sogar schon versucht habe, einen Weg zu finden –, sei dies kein Petzen mehr. Regula Bernhard Hug ergänzt: «Sobald Gewalt im Spiel ist, egal ob verbal, körperlich oder emotional, geht es grundsätzlich nie ums Petzen.»
An Schulen würden solche Verhaltensregeln normalerweise auch gelernt. Und Christelle Schläpfer findet es wichtig, gegenüber den Kindern auch regelmässig zu betonen, dass Hilfe holen etwas sehr Mutiges sei. «Aus Umfragen zum Thema Mobbing wissen wir, dass es nur etwa 20 bis 30 Prozent der Kinder schaffen, zu sagen, dass sie gemobbt werden, der Rest schweigt und traut sich eben nicht, Hilfe zu holen», so Elternberaterin Schläpfer.
Den Angreifer ignorieren, obwohl man getroffen ist, funktioniert nicht. Denn das merkt der sofort.
Christelle Schläpfer, Mobbingexpertin
Durch Rollenspiele Übung erlangen
Eine andere Strategie ist das körperliche Wehren. «Da das meist zu einem Hochschaukeln der Eskalation führt, bin ich grundsätzlich für gewaltfreie Kommunikation», sagt Andreas Schick. Er sagt aber auch, dass Rangeleien zur kindlichen Entwicklung dazugehören, insbesondere auch unter Geschwistern. «Kinder müssen auch ihre körperlichen Grenzen austesten», so Andreas Schick. Im besten Fall würden sie dabei merken, dass sie damit ohnehin nicht ihr Ziel erreichen. Beobachten Eltern aber, dass ein Kind nur den Weg des körperlichen Angriffs kennt, um etwas zu erreichen, sei es an der Zeit, einzuschreiten und das Gespräch zu suchen.
Ein Patentrezept, wie Kinder sich am besten verhalten sollen, wenn sie gehänselt werden, gibt es zwar nicht – dafür sind die Persönlichkeiten und das erlernte Sozialverhalten zu verschieden. Neben dem Vorleben von sozialen Umgangsformen können Eltern aber aufmerksam beobachten, welche Taktik ihr Kind nutzt und kennt, um mit Spötteleien umzugehen.
«Gerade wenn Kinder nicht glücklich aus einer solchen Situation herausgehen und man merkt, dass es sie belastet, kann man ihnen auch andere Wege vorschlagen, die sie beim nächsten Mal ausprobieren könnten», sagt Regula Bernhard Hug vom Kinderschutz Schweiz. Solche Dinge können zu Hause oder in Schulen auch in Rollenspielen geübt werden.
Christelle Schläpfer lässt Kinder dafür auch gern mal in die Rolle desjenigen schlüpfen, der ärgert – und spielt selbst jemanden, der Hänseleien gar nicht erst an sich herankommen lässt. Der sie abblockt mit Worten wie: «Diesen Kommentar kannst du gern für dich behalten.» Dabei würden Kinder schnell merken, dass es so gar keine Freude mehr macht, zu hänseln.
«Das funktioniert aber wirklich nur dann, wenn ein Kind tatsächlich über der Situation steht und sie wirklich nicht an sich herankommen lässt. Nur ignorieren, aber getroffen sein, reicht nicht. Denn das merkt derjenige, der ärgert, sofort. Auch das kann man in Rollenspielen zeigen», sagt Christelle Schläpfer.
Wo beginnt Mobbing?
Was nicht funktioniert: dem Kind klar vorgeben, wie es sich zu verhalten hat. «Wir können verschiedene Wege anbieten. Am Ende ist es aber wichtig, dass das Kind etwas wählt, das zu ihm passt, mit dem es sich wohlfühlt», sagt Regula Bernhard Hug.
Der Junge aus dem Anfangsbeispiel ist am nächsten Tag übrigens wieder mit der Schneeschaufel in die Schule gekommen – genauso wie zwei andere Kinder, die seine Idee offensichtlich auch gut fanden. Ausgelacht hat sie keiner mehr.
Wenn Kinder zur Zielscheibe von dummen Sprüchen und Hänseleien werden, schrillen bei vielen Eltern auch deshalb die Alarmglocken, weil sie Angst davor haben, ihr Kind könnte ein Mobbingopfer werden. «Tatsächlich ist Hänseln eine Vorstufe von Mobbing», sagt Elternberaterin Christelle Schläpfer.
Von Mobbing spricht man dann, wenn Gewalt im Spiel ist, sei das körperlicher, verbaler oder emotionaler Art. «Aber auch wenn wir keine Gewalt haben, das Hänseln aber regelmässig auftritt, kann es für ein betroffenes Kind zu Mobbing werden», sagt Regula Bernhard Hug von Kinderschutz Schweiz. Ihr ist es wichtig, zu betonen, dass sich kein Kind durch seine Persönlichkeit, sein Aussehen oder sein Verhalten selbst zum Opfer macht. «Das kommt immer von aussen, alles andere ist eine Umkehrung der Verantwortung.»