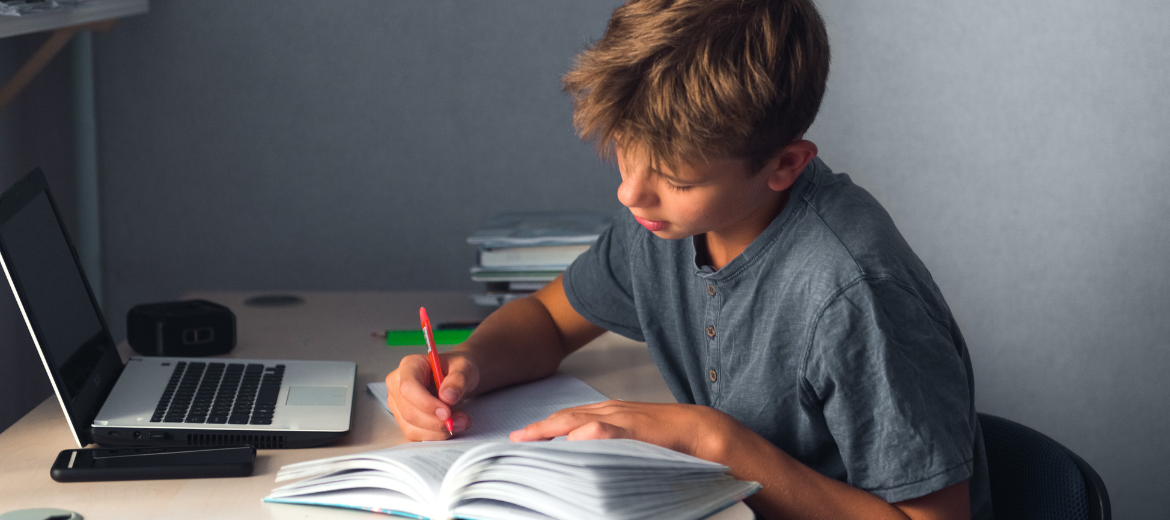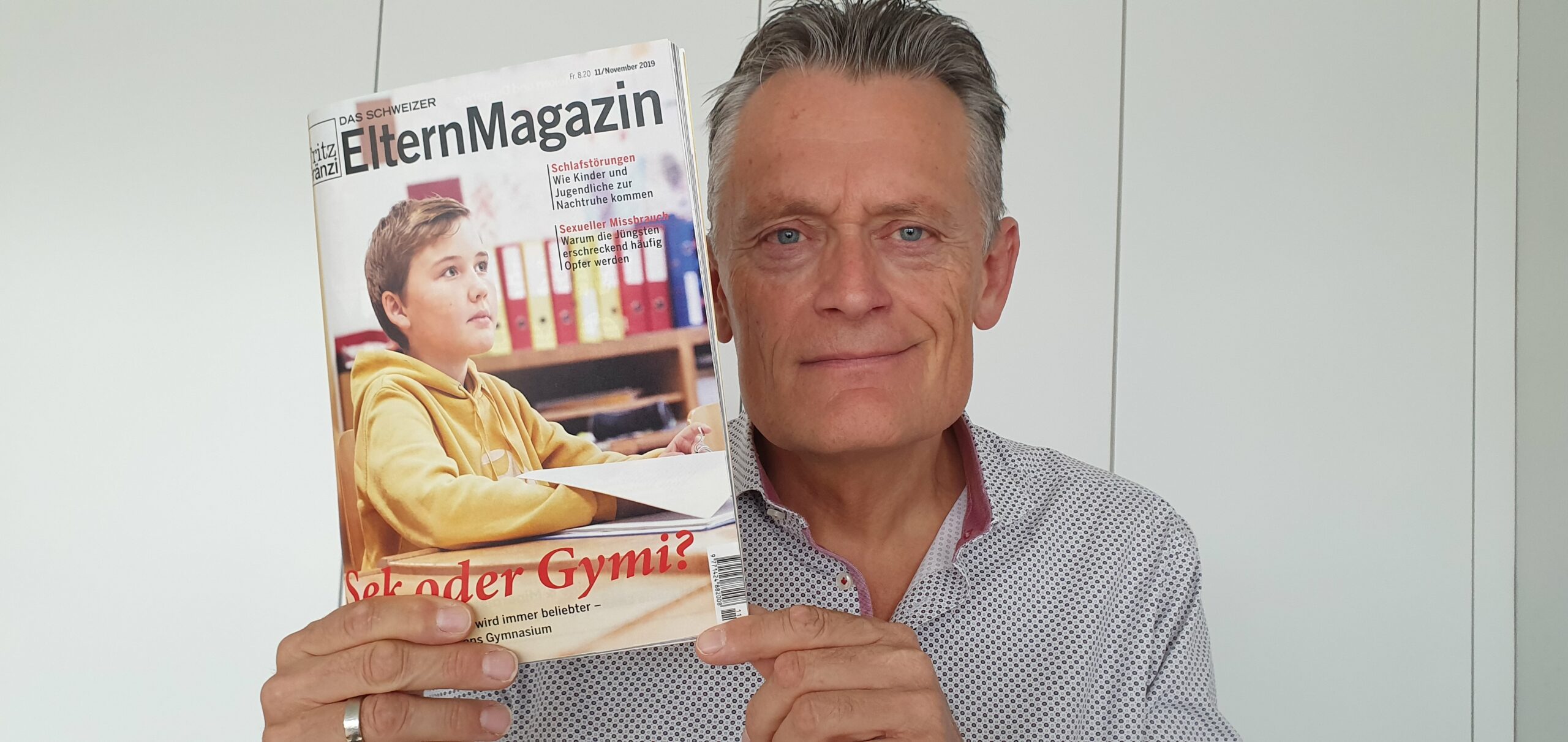Sek oder Gymi: Was ist besser für mein Kind?

Wer gehört ans Gymi? Wer sollte lieber eine andere schulische Bahn einschlagen? Und welche Folgen hat es, wenn die Matura für immer mehr Kinder zum Ziel wird? Eine Bestandsaufnahme.
Für viele Schweizer Schülerinnen und Schüler galt es nach den Sommerferien ernst. Für die einen fiel der Startschuss zur Berufswahl, für die anderen stand der Wechsel in die Sekundarstufe an – oder aber der Übertritt ins Gymnasium. Die gymnasiale Matura ist der höchste Abschluss, den Jugendliche auf der Sekundarstufe II erzielen können.
Das Schweizer Gymnasium sei ein Sonderfall, sagt Franz Eberle, Professor für Gymnasialpädagogik an der Universität Zürich: «Mit 13 bis 14 obligatorischen Fächern im Grundlagenbereich plus einem Schwerpunkt- und einem Ergänzungsfach sowie einer Maturaarbeit haben Schweizer Gymnasiasten im internationalen Vergleich das umfassendste Pflichtprogramm.»
Dafür belohne die Matura sie mit dem Eintrittsticket zu allen Universitäten im Land, ermögliche ihnen den prüfungsfreien Zugang zu sämtlichen Studienfächern mit Ausnahme von Medizin. «Das ist im internationalen Vergleich ebenfalls aussergewöhnlich.»
Regelmässig berichten Medien über Eltern, die Lehrpersonen bestürmen, bis die Noten fürs Gymi reichen.
Was die Schweizer Matura zudem besonders macht, ist die Tatsache, dass vergleichsweise wenige eine haben. «Die Schweizer Maturitätsquote gehört mit 20 Prozent zu den tiefsten innerhalb der OECD-Staaten», sagt Eberle.
Bildung als hart umkämpftes Gut
Gut möglich, dass der Ruf des Gymnasiums als Königsweg einer Schullaufbahn von all diesen Besonderheiten herrührt: Was rar ist, hat Strahlkraft. Offensichtlich scheint diejenige des Gymnasiums den einen oder anderen zu blenden. Mit zuverlässiger Regelmässigkeit berichten Medien über Eltern, die Anwälte einschalten, um ihr Kind durch die Probezeit zu boxen, oder Lehrpersonen so lange bestürmen, bis der Notendurchschnitt fürs Gymi reicht. Eine arge Zuspitzung? Vielleicht.
«Sicher ist, dass viele Eltern Bildung nicht mehr als ein selbstverständliches, öffentliches, sondern als hart umkämpftes privates Gut betrachten», sagt Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm. (Das ganze Interview finden Sie hier.) «Nur im Gymnasium, so ihr Kalkül, liegt die Zukunft ihrer Kinder.»
Worin liegt diese Haltung begründet? Was macht sie mit der Schule und dem Ideal von Chancengleichheit, was mit den Kindern? Was hilft Kindern und Jugendlichen, ihren Platz zu finden, und für wen ist der Weg ans Gymnasium der richtige? Diesen Fragen geht dieses Dossier nach – und will Eltern ermuntern, ihren Blick nicht nur auf die Matura zu richten. Mitunter geht vergessen, dass das Schweizer Bildungssystem einen weiteren «Sonderfall» zu bieten hat, der für viele Länder ein Vorbild ist: die duale Berufsbildung.
Ziel der Matura
Gemäss Bildungszielartikel im Schweizerischen Maturitätsreglement hat das Gymnasium zwei Hauptziele: Es soll Absolventen mit der «allgemeinen Studierfähigkeit» ausstatten und sie «auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft vorbereiten». Mit allgemeiner Studierfähigkeit ist gemeint, dass Maturanden in der Lage sein sollten, nicht nur ein bestimmtes, sondern jedwedes Studium erfolgreich aufzunehmen.
Für Bildungsforscher Stefan Wolter ergibt sich daraus, dass das Gymnasium die zielgerichtete Vorbereitung auf die Universität darstellt. Als Beispiel führt er das gymnasiale Schwerpunktfach Psychologie und Pädagogik an: «Es soll nicht so sein, dass man einfach angeregt über Freud diskutiert. Wenn die Schüler erst an der Universität begreifen, dass zur Psychologie Statistik gehört, hat das Gymnasium seine Aufgabe nicht erfüllt.»

Wolter ist Titularprofessor für Bildungsökonomie an der Universität Bern und Leiter der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Aus seiner Feder stammt der 2018 veröffentlichte dritte Schweizer Bildungsbericht, eine umfangreiche Datenanalyse aus Statistik, Forschung und Verwaltung zum Schweizer Bildungswesen.
Dem Bildungsbericht zufolge treten 95 Prozent der Schweizer Maturanden im ersten Jahr nach dem Abschluss ein Studium an, 80 Prozent an einer Universität, 15 Prozent verteilen sich auf Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen. Ein Viertel derjenigen, die sich für ein Uni-Studium entscheiden, schliesst dieses nicht ab – der meistgewählte Weg bleibt es trotzdem. «In der Schweiz macht man die Matura, um zu studieren», resümiert Wolter.
Vornoten oder Test – was ist fairer?
Ob es «die Richtigen» ins Gymnasium schaffen, ist eine heiss diskutierte Frage. Sie betrifft auch das Aufnahmeverfahren. Zehn Schweizer Kantone, darunter Zürich, Glarus oder St. Gallen, regeln die Zulassung mit einer Aufnahmeprüfung. Meist haben in diesem Fall auch die Vornoten Einfluss darauf, ob das Kind einen Platz bekommt. 16 Kantone, darunter Bern, beide Basel, die lateinische und die Zentralschweiz, verzichten auf eine Aufnahmeprüfung. Hier ist ein bestimmter Notenschnitt ausschlaggebend, oft kombiniert mit der Empfehlung durch die Lehrperson.
Die Aufnahmeprüfung ist als Zulassungskriterium unfair, ein regelrechtes Damoklesschwert.
Eine Mutter
Notenschnitt oder Prüfung: Was ist fairer? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Die Aufnahmeprüfung sei lediglich eine Momentaufnahme, abhängig von der Tagesform des Kindes und daher wenig repräsentativ für dessen tatsächliches Potenzial – häufig kommt dieses Argument von Eltern wie einer Zürcher Mutter, die nicht mit Namen genannt werden will. «Die Aufnahmeprüfung ist als Zulassungskriterium schlicht unfair, ein regelrechtes Damoklesschwert», findet sie. «Kein Wunder, dass die Vorbereitung auf das Gymnasium damit auch zur Elternsache wird.»
Potenzial des Kindes hängt von der Umwelt ab
Was es mit dieser Kritik auf sich hat, zeigt eine bereits länger zurückliegende Studie von Urs Moser, dem Leiter des Instituts für Bildungsevaluation an der Universität Zürich. Moser und sein Team untersuchten im Jahr 2009, ob der sogenannte AKF-Test, den Anwärter für Langzeitgymnasien in Zürich während einiger Jahre zusätzlich zur Aufnahmeprüfung absolvierten, die Chancengerechtigkeit beim Übertritt ins Gymnasium verbessern könnte. AKF steht für allgemeine kognitive Fähigkeiten, die mit dem Test ermittelt wurden.
Für das Prüfungsresultat selbst war sein Befund irrelevant. Die Untersuchung sollte klären, ob Kinder aus Migrantenfamilien, die eigentlich das Potenzial fürs Gymnasium hätten, an der Aufnahmeprüfung scheitern, bloss weil sie wenig Unterstützung haben. Entsprechend erwarteten die Forscher bei diesen Prüflingen eine Kluft zwischen hoher Punktzahl im AKF-Test und geringem Erfolg bei der Aufnahmeprüfung. «Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt», sagt Moser. «Schüler mit Deutsch als Zweitsprache schnitten sowohl im AKF-Test als auch in allen Prüfungsteilen deutlich schlechter ab als jene mit Deutsch als Erstsprache.»
Intelligenz ist keine fixe Grösse, sondern wird von Geburt an beeinflusst.
Urs Moser, Bildungsforscher
Für den Forscher ist die Folgerung naheliegend. «Intelligenz ist keine unveränderliche Grösse, sondern wird von Geburt an beeinflusst», sagt Moser. «Ob ein Kind sein angeborenes Potenzial ausschöpfen kann, hängt von der Umwelt ab.»
So profitierten Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern von einer anregungsreicheren Umgebung: «Sie haben einen Vorsprung, der sich nicht nur auf den Prüfungserfolg, sondern auch auf ihre kognitiven Fähigkeiten auswirkt.»
Eltern beeinflussen Lehrpersonen
Die Untersuchung zeigt auch: Ganz generell deckt sich die Punktzahl aus den kognitiven Fähigkeiten in der Regel nicht nur mit dem Prüfungsresultat eines Kindes, sondern auch mit seinen Vornoten. «Das legt nahe, dass die Prüfung ihre Aufgabe relativ gut erfüllt und die passende Auswahl trifft», sagt Moser.
Auch da, wo ausschliesslich Vornoten zählten, stelle sich die Frage nach deren Aussagekraft, gibt der Forscher zu bedenken: Welche Noten ein Kind erziele, hänge von der Klassenzusammensetzung ab – und davon, wie stark der Einfluss der Eltern auf das Urteil der Lehrperson sei.

«Während die Zentralschweiz mit Lehrerempfehlungen gute Erfahrungen macht», sagt Moser, «muss man kein Hellseher sein, um die Probleme zu sehen, die mit der Abschaffung der Gymi-Prüfung auf Zürcher Lehrpersonen zukämen. Hier ist der Test ein wichtiger ausgleichender Faktor zum elterlichen Powerplay.» So argumentiert auch Bildungsforscher Wolter: «Fehlt die Aufnahmeprüfung als Hürde, profitieren vor allem Akademikerkinder. Sie schaffen den Sprung ans Gymnasium deutlich häufiger als dort, wo es Prüfungen zu bestehen gibt.»
Der Bildungsbericht zeige auch, dass Akademikerkinder unter den Gymnasiasten mit schlechten Schulleistungen überdurchschnittlich häufig vertreten seien. «Sie müssen typischerweise der elterlichen Erwartungshaltung entsprechen, obwohl sie nicht an diese Schule gehören», sagt Wolter. «Das ist schlecht für die Jugendlichen – und sozial ungerecht.»
Nötige Intelligenz fehlt oft
Jugendliche, die das Gymnasium besuchen, obwohl sie nicht über das kognitive Rüstzeug dafür verfügen, sind keine Seltenheit. Das legt die Arbeit der Intelligenzforscherin Elsbeth Stern nahe. Stern ist ordentliche Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung und Vorsteherin des Instituts für Verhaltensforschung an der ETH Zürich. Zusammen mit ihrem Team erhob sie den Intelligenzquotienten (IQ) von Schweizer Gymnasiasten. «Fast die Hälfte der Schüler, die wir testeten, verfügten nicht über die dafür nötige Intelligenz», sagt Stern.
Ein Drittel der Jugendlichen, die das Gymi besuchen, verfügen nicht über das kognitive Rüstzeug dafür.
Was ist darunter zu verstehen? «Die Schweizer Maturitätsquote sieht vor, dass nicht mehr als 20 Prozent aller Jugendlichen das Gymnasium besuchen. Sinnvollerweise wären das die intelligentesten 20 Prozent ihrer Altersgruppe. Orientieren wir uns an ihnen, müsste der Mindest-IQ fürs Gymnasium bei 112 Punkten liegen», sagt Elsbeth Stern.
46 Prozent aller getesteten Gymnasiasten erreichten diesen Wert nicht. «IQ-Tests sind nicht perfekt», so die Forscherin, «zum Beispiel kann jemand einen schlechten Tag haben.» Unter Berücksichtigung solcher Messfehler hat Stern die Quote nach unten korrigiert – auf 30 Prozent. «Das ist eine konservative Schätzung», betont sie, «und betrifft auch so jeden dritten Gymnasiasten.»
Überfordert auch später im Beruf
Warum ist das problematisch? «Weil zu viele ungeeignete Leute die Universität besuchen, dort das Niveau drücken oder scheitern», sagt Stern. «Oder sie kommen mit Ach und Krach durch und später in berufliche Positionen, denen sie intellektuell nicht gewachsen sind.»
Für viele Akademiker sei die Vorstellung, dass es das eigene Kind nicht aufs Gymnasium schafft, schwer erträglich. Um ihrem Kind einen Platz zu sichern, investierten gut situierte Eltern Unsummen in Nachhilfe.
So auch Maximilians Eltern, ein Akademikerpaar aus einer Zürcher Seegemeinde. Der 12-jährige Sechstklässler tritt im kommenden März zur Gymi-Prüfung an – wöchentlichen Stützunterricht bei einem privaten Nachhilfeinstitut nimmt er seit zwei Jahren. «Nicht, weil wir überehrgeizig sind», sagt seine Mutter, «sondern weil unser Sohn genügend Zeit haben soll, sich mit neuen Aufgabenstellungen, die im Hinblick auf die Prüfung wichtig sind, vertraut machen zu können. In der öffentlichen Schule bleibt dafür gar keine Zeit.» Es sei ein offenes Geheimnis, findet der Vater, dass der Test ohne Zusatzunterstützung nicht machbar sei. «Alle setzen auf Nachhilfe», glaubt er, «aber keiner gibt es zu.»
Ein Stadtzürcher Paar, diesmal keine Akademiker, begründet seine Entscheidung für private Gymi-Vorbereitung anders: «Wir sind sicher, dass sich unsere Tochter da mehr engagiert als im Kurs, den die Klassenlehrerin anbietet. Da sind ihr Umgebung und Gruppenzusammensetzung zu vertraut, um sie zu Höchstleistungen anzuspornen.»
Zweifel äussert das Paar auch an der Qualität der kostenlosen Vorbereitung, wie sie die öffentliche Schule anbietet: «Die Lehrer sind ja verpflichtet, diese Kurse zu geben – zusätzlich zum normalen Unterricht. Der Verdacht, dass sie diesem Extraaufwand nicht wahnsinnig viel Engagement entgegenbringen, liegt doch nah.»
Wie viel bringt die Nachhilfe wirklich?
Kann Drill fehlende Intelligenz kompensieren oder, wie es ein nicht näher genannter Lehrer eines Nachhilfeinstituts gegenüber einer Schweizer Tageszeitung formulierte, «aus jedem Deppen ein Genie machen»? «So würde ich es nicht formulieren», sagt Stern. «Aber bei durchschnittlicher Intelligenz gibt es durchaus Spielraum für Leistungssteigerung – wenn entsprechend trainiert wird und man weiss, was einen erwartet.»
Die Gymi-Prüfung sei in dieser Hinsicht ein dankbares Lernziel: «Sämtliche Aufgaben vergangener Jahre finden sich im Internet, und das Prüfungsschema ist jeweils mehr oder weniger dasselbe.» Mehr zu leisten, als die eigene Intelligenz hergibt, funktioniere aber nicht auf lange Sicht, sagt Stern: «Vielleicht kommt man dank Nachhilfe durchs Gymnasium, möglicherweise auch durch die ersten Jahre an der Universität. Irgendwann wird der Druck zu gross.»
Das Nachsehen hätten nicht nur die jungen Erwachsenen, die unter ihm zerbrächen, «sondern auch die, denen sie am Gymnasium den Platz wegnehmen», sagt Stern. «In sozial schwächeren Familien gibt es durchaus intelligente Kinder, bloss stehen die oft allein da.»

Störende kantonale Unterschiede
Die Gerechtigkeitsfrage stellt sich auch im Hinblick auf die Maturitätsquote. Obwohl sie im Gesamtschweizer Schnitt 20,2 Prozent beträgt und damit der vom Bund angepeilten Marke entspricht, variiert sie je nach Kanton stark. Während 2016 gerade einmal 11 Prozent der Obwaldner und 14 Prozent der Thurgauer Jugendlichen die gymnasiale Matura machten, waren es in Genf (29,4 Prozent) und Basel-Stadt (29,6 Prozent) ungleich viel mehr.
«Mögliche Gründe für diese Unterschiede sind politische Entscheidungen als Reaktion auf den technologischen Fortschritt und die steigende Nachfrage nach Fachkräften», sagt Bildungsforscher Moser. «Sicher spielen aber auch die gestiegenen Bildungsambitionen eine Rolle.» Abseits der Städte fielen diese deutlich weniger ins Gewicht.
2016 machten in Obwalden 11 Prozent der Jugendlichen die gymnasiale Matura, in Basel-Stadt waren es 29,6 Prozent.
Die Vielzahl an Maturanden in der Westschweiz und im Tessin begründet Moser mit kulturellen Unterschieden der Bildungssysteme, die vom französischen respektive italienischen Pendant geprägt seien. «Die grossen kantonalen Unterschiede sind störend, weil die gymnasiale Matura den Zugang zur Universität regelt», findet Moser. «Es wäre wünschenswert, dass die Anforderungen für bestimmte Ausbildungen in jedem Kanton gleich sind.»
Ein teures und ineffizientes System
Langfristig haben Gymnasiasten in Kantonen mit hoher Maturitätsquote aber nicht unbedingt die besseren Karten: So fliegt in Genf und im Tessin – beide Kantone kennen nur das auf die Sekundarschule folgende Kurzzeitgymnasium – ein Drittel der Gymnasiasten im ersten Jahr wieder raus. «In der Regel versuchen sie es daraufhin noch zwei- oder dreimal», sagt Wolter. «Gelingt das nicht, führt der Weg meist in eine Fachmittelschule.»
Einige Jugendliche verfügten dafür nicht über die nötigen Voraussetzungen und scheiterten. «Und erst, wenn alle Stricke reissen, bewerben sie sich um eine Lehrstelle», sagt Wolter. Gemäss dem Forscher sind Genfer Jugendliche, die eine Berufsausbildung mit höherem Anforderungsprofil antreten, im Durchschnitt bereits 20 Jahre alt.
«Dieses System ist ineffizient, teuer und tragisch für die Betroffenen», sagt Wolter. «Es wäre sinnvoller gewesen, den gescheiterten Gymnasiasten früher reinen Wein einzuschenken und ihnen direkt die Vorzüge einer Berufslehre aufzuzeigen.»
Viele Gymnasiasten, viele Abbrüche
Schlimmer als die gescheiterten Gymnasiasten, findet Wolter, trifft es jene, die die Matura schafften, «aber so schlecht sind, dass sie an keiner Universität bestehen». So zeige ein Blick in die Statistik, dass eine überdurchschnittlich hohe Maturitätsquote mit höheren Abbruchquoten an den Universitäten einhergehe.
Die OECD sagt, die Schweiz laufe mit ihrer tiefen Maturitätsquote Gefahr, international den Anschluss zu verlieren.
Ebenso belegten Langzeitdaten, dass Gymnasiasten in Kantonen mit höherer Maturitätsquote eine tiefere durchschnittliche Leistung an den Tag legten. Trotz teilweise hoher Ausfallquoten während der Probezeit gelinge es in Kantonen wie Basel-Stadt, Genf oder Tessin nicht, Jugendliche, die nicht über das nötige Rüstzeug für die Schule verfügten, rechtzeitig auszusortieren: «Dann stehen sie Mitte 20 ohne Ausbildung da, weil sie durch die Uni fallen.»
Kritik der OECD an Schweizer Maturaquote
Die OECD kritisierte die Schweiz mehrfach für ihre tiefe Maturitätsquote: Sie laufe damit Gefahr, den Anschluss an die internationale Entwicklung zu verlieren. «Diese Diskussion wird von Zahlen bestimmt, die mit Quoten und kaum mit Qualitäten zu tun hat», findet Jürgen Oelkers, emeritierter Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität Zürich.
Erstens greife die Kritik zu kurz: Sie berücksichtige allein die gymnasiale Maturitätsquote, obwohl man mit Fach- und Berufsmittelschulen mittlerweile über zwei weitere Maturatypen verfüge. Zählt man alle drei Typen zusammen, kommt die Schweiz in der Tat auf eine Maturitätsquote von 37 Prozent.
Zweitens seien für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes nicht nur Bildungsabschlüsse, sondern auch die Situation im Hinblick auf Produktion und Arbeitsmarkt entscheidend. Hier punkte die Schweiz auf ganzer Linie – nicht zuletzt dank ihres einzigartigen Berufsbildungssystems, das die OECD nicht angemessen berücksichtige. «Ebenso wird unterschlagen, dass in der Schweiz, anders als in anderen Ländern, die Hochschulausbildung den Arbeitsmarkt bisher nicht dominiert», hält Oelkers fest. «Qualität wird auch auf anderem Weg erzeugt, und man braucht in der Schweiz in vielen Sparten keine gymnasiale Maturität, um erfolgreich zu sein.»
Das sieht auch Bildungsforscher Wolter so. Das Schweizer Bildungssystem gehöre zu den durchlässigsten weltweit. Auch demjenigen, der keine gymnasiale Matura mache, stünden alle Türen offen: «Es gibt nicht diesen einen Zeitpunkt, zu dem Jugendliche sich für einen Weg in Richtung Studium entscheiden müssen. Sie können während oder nach der Lehre die Berufsmatura machen, danach stehen ihnen alle Fachhochschulen offen. Wer will, kann via Passerelle sogar an die Uni. Und selbst beim Lohn hat ein Lehrling heute langfristig nicht unbedingt schlechtere Aussichten als ein Gymnasiast.»