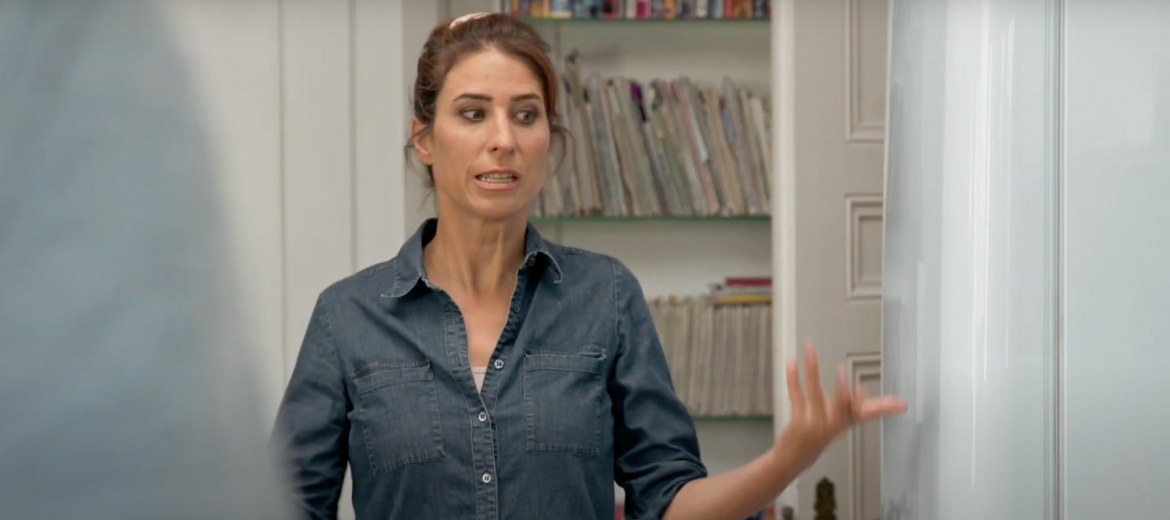Frau Tazi-Preve, wie sind Kinder und Beruf vereinbar?

Irene Mariam Tazi-Preve zeichnet ein düsteres Bild von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die österreichische Familienforscherin über die Wirtschaft als Feind der Familie, den zukünftigen Stellenwert von Kindererziehung in der Gesellschaft und warum der Ruf nach mehr weiblichen Arbeitskräften nichts mit Gleichstellung zu tun hat.
Frau Tazi-Preve, Frauen sollen ihre Erwerbspensen aufstocken und möglichst lebenslang 70 Prozent arbeiten – das fordern nicht nur Wirtschaftsvertreter, sondern neuerdings auch Gleichstellungsbeauftragte. Was halten Sie von solchen Forderungen?
Das ist in etwa so, als wenn man dem Esel die Karotte vorhält, die er sowieso niemals erhaschen wird. Als Nächstes wird verlangt, dass Frau – trotz Kinder und Haushalt – Vollzeit arbeiten muss. Das aber ist problematisch, weil Frauen in der Regel weiter hauptverantwortlich für Haushalt und Kinderbetreuung sind. Tatsache ist auch: Frauen verdienen europaweit immer noch bis zu 30 Prozent weniger als Männer. Zudem wird ihnen die Erziehungsarbeit selten an die Renten angerechnet.
Weshalb setzen Gleichstellungsbeauftragte arbeitende Mütter noch mehr unter Druck?
Gleichstellungsfrauen verkörpern den liberalen Feminismus – und der hat sich ganz dem Neoliberalismus verpflichtet. Das heisst: Nur Profit zählt, der Staat soll verkleinert und insbesondere der Sozialstaat beschnitten werden. Alles soll privatisiert werden, und man appelliert an die Eigenverantwortung.

Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik publiziert. Ihr Buch «Vom Versagen der Kleinfamilie. Ideologie und Alternativen» erscheint im Frühjahr 2017. Bild:zVg
Die so gennante Vereinbarkeit von Beruf und Familie – das hat nichts mit Frauenförderung zu tun?
Geht es um die sogenannte Vereinbarung von Familie und Beruf, muss man sich immer das Wirtschaftssystem und die Politik vor Augen führen: Das Interesse an der weiblichen Arbeitskraft hat nichts mit Gleichstellung oder Vereinbarung, wie es heute heisst, zu tun. Es geht einzig darum, den Profit des Unternehmens oder das Wirtschaftswachstum des Landes zu vergrössern.
Wem nützt es denn, wenn wir alle immer mehr arbeiten?
Die Globalisierung zeigt uns: Die Einkommen steigen nur im obersten Segment, während der Mittelstand schrumpft. Vielleicht muss man die Geschichte der Arbeit etwas genauer betrachten. Die Trennung von Arbeit und Familie von der Politik fand in der Antike statt.
Lange Zeit hat sich dann die Wirtschaft mit der Familie entwickelt – das Handwerk fand zu Hause bei der Familie statt. Erst ab der Neuzeit, mit Beginn der Industrialisierung, wurden Produktion und Reproduktion getrennt. Die Menschen arbeiteten ausser Haus in Fabriken, wo Frauen die Hälfte der männlichen Einkommen verdienten.
Mit welcher Begründung?
Man sagte ihnen, dass sie ja keine Familie zu ernähren bräuchten – selbst dann, wenn sie Kinder hatten. Schon damals verlangte das vorherrschende Mutterbild von den Frauen, einerseits gute Mütter zu sein, andererseits mussten sie zehn Stunden in der Fabrik arbeiten – niemals ist es aufgegangen mit diesem Miteinander von Beruf und Familie. Kommt hinzu, dass Arbeit ohnehin etwas für das Volk war und nicht für die Elite, die ja bis heute nicht arbeitet. Wohlhabende lassen arbeiten, sie delegieren. Sie können es sich auch problemlos leisten, eine hohe Anzahl Kinder zu haben. Trotzdem stellen sie immer noch die Wächter des Systems dar, indem sie verlangen, dass Menschen, die auf Erwerbstätigkeit angewiesen sind, immer mehr arbeiten.
Zudem zählt die weibliche Arbeitskraft nach wie vor nicht so viel wie die männliche …
Wo Frauen arbeiten, wird weniger verdient. Frauen sind zumeist in «zuarbeitenden» Berufen, als Verkäuferinnen, Coiffeusen und Assistentinnen, beschäftigt – also im Niedriglohnsektor. Dringen sie in Berufe vor, die vorher in Männerhand waren, wie etwa das Lehramt, die Psychologie oder die Medizin, verlieren diese Berufe an Prestige und das Lohnniveau sinkt.
Die Arbeitswelt hat sich brutalisiert. Sie fordert immer mehr.
Die Wirtschaft ist also der Feind der Familien.
Lange sind wir dem Irrglauben aufgesessen, dass Arbeit befreien soll. Das hat sich mittlerweile als ein riesiger Irrtum herausgestellt. Die Belastungsszenarien zeigen, dass neben niedrigem Verdienst die gesundheitlichen Probleme zunehmen. Es ist ein neues Phänomen, dass in Amerika die Todesrate der weissen Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren steigt – also just in der Zeit, wenn sie Kinder und Beruf unter einen Hut bringen müssen.
Doch die meisten von uns sind auf Arbeit angewiesen. Was tun?
Eine Lösung wäre, wenn sich auch Männer mitbefreien und sich sowohl in der Kinderbetreuung als auch im Haushalt engagieren würden. Doch das passiert nicht. Männer arbeiten nach wie vor Vollzeit und zementieren damit dieses Ungleichgewicht. Sie unterwerfen sich dem neoliberalen System, weil sie glauben, das sei normal.
Deshalb leiden vor allem Familien unter diesen Umständen. Sie haben wenig Zeit für ihre Kinder und kaum mehr Energie. Weshalb kommt kaum Kritik aus ihren Reihen?
Diejenigen, die im System sind, werden es nicht kritisieren, im Gegenteil: Sie verteidigen ihre Lebensweise. Aber innerhalb des Systems wird es nie eine Lösung geben, denn es geht immer um Macht und Geld. Das widerspricht natürlich allen Bedürfnissen nach Empathie und Sicherheit in einem Familienleben. Daher müsste man den jungen Frauen sagen: Hört auf, an das Märchen von der Karriere zu glauben, an die vermeintliche Macht, die ihr niemals haben werdet. Auch die jungen Männer müssen ihre Karriereentwürfe überdenken. Es ist ja ungeheuerlich, welche Abstriche an Lebensqualität es bedeutet, Karriere zu machen. Viele sind mit 40 oder 50 Jahren desillusioniert, glauben an ihr persönliches Versagen, was falsch ist. Die Arbeitswelt hat sich brutalisiert, fordert immer mehr. Etwa «Flexibilität» oder allzeitige Verfügbarkeit und das Eintreten für Prinzipen, die auschliesslich der Profitmaximierung dienen. Das Ganze wird dann «Fortschritt» genannt, und es wird sanktioniert, wenn dagegen opponiert wird.
Die Gesellschaft fordert zwar permanent Kinder, aber kümmert sich nicht um sie.
Welchen Stellenwert hat das Kind in unserer leistungsorientierten Gesellschaft?
Die Gesellschaft fordert zwar permanent Kinder, aber kümmert sich nicht um sie. Doch die Erziehung von Kindern – das ist an sich eine Aufgabe für mehrere Menschen. Selbst zwei Personen sind im Prinzip zu wenig für ein Kind.
Was wäre die Lösung für ein besseres Leben für alle?
Es gibt seit den 1970er-Jahren Experimente der Lebensführung, wo man sich vieles – Kinderbetreuung, Essenszubreitung, Wäsche – teilte. Obwohl diese Lebensform sowohl Frauen als auch Männer von der Familienarbeit entlasten würde, sind viele solcher Kommunen mittlerweile verschwunden. Ganz grundsätzlich gesehen kommen wir wohl nicht um eine Debatte über die sich verschärfende Arbeitswelt, also die Existenzsicherung, im Zusammenhang mit der Nachwuchsproblematik herum. Zudem muss eine Kultur des Teilens von Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung normal werden – sonst kommen wir mit der Gleichberechtigung niemals weiter.
Wie können Frauen entlastet werden?
Empirisch gesehen ist das weibliche soziale Netz – Mutter, Schwestern, Freundinnen, andere Mütter – das wertvollste, um Frauen nachhaltig zu entlasten. Auch von politischer Seite ist nicht wirklich Hilfe zu erwarten, es geht ja heute nur mehr um das Schlagwort der «Vereinbarkeit von Familie und Beruf» – besonders also darum, dass genügend Kita-Plätze vorhanden sind. Der erwerbstätigen Mutter ist damit allerdings nicht ausreichend geholfen. Sie muss ihre Kinder trotzdem holen, bringen und anschliessend einkaufen, kochen, waschen und so weiter. Das gesamte Management bleibt grösstenteils bei ihr.
Empirisch gesehen helfen Mütter, Schwester, Freundinnen und andere Mütter der Mutter am meisten bei der Entlastung. Ihr weibliches soziales Netz also.
Was schlagen Sie vor?
Das Erste ist, dass Frauen und Männer aufhören, daran zu glauben, dass die Kleinfamilie der ideale Ort zum Aufziehen der Kinder ist. Das Zweite ist, dass Mütter beginnen, Familie als «Matrilinearität» zu verstehen (Matrilinearität, lateinisch «in der Linie der Mutter», bezeichnet die Weitergabe und Vererbung von sozialen Eigenschaften und Besitz ausschliesslich über die weibliche Linie von Müttern an Töchter, Anm. der Red.) Das heisst, dass Frauen die Hilfe und Unterstützung, die sie von ihren Müttern, Schwestern, anderen Müttern erhalten, als wesentlich begreifen und nicht als Ersatz für den oft abwesenden Partner.
Wo stehen wir in dieser Debatte in fünf Jahren?
Wir sind einen wesentlichen Schritt weiter in Richtung einer «equal share society» (gleichberechtigte Gesellschaft) und eines Infragestellens der Sinnhaftigkeit des Arbeitsmarktes. Menschen werden zunehmend nicht ausbeuterische Arbeit einfordern wollen, d. h., sie werden eine sinnstiftende Arbeit anstreben, womit sie weder sich selbst noch anderen Menschen oder der Natur schaden. Die Unterscheidung in bezahlte und unbezahlte Arbeit wird obsolet. Neu wird die Kindererziehung als eine der wertvollsten Tätigkeiten überhaupt erachtet, die die Gesellschaft leistet.