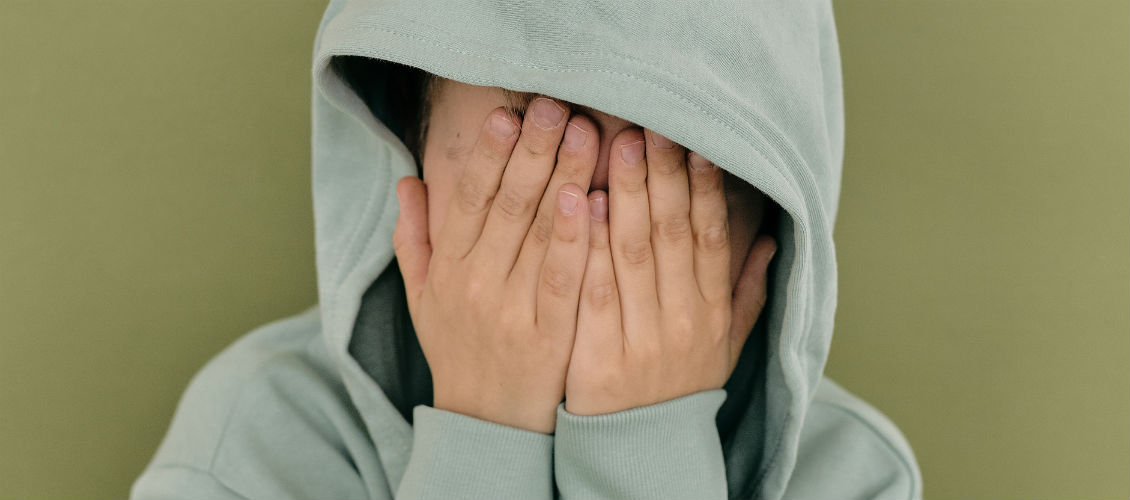Mobbing: Und alle schauen weg

Was gehört zu einer schönen Kindheit? Einsamkeit, Trauer und Verzweiflung sicher nicht. Warum mobben Kinder andere Kinder? Woran erkennen Eltern, dass ihr Kind gemobbt wird? Und was können sie dagegen tun?
«Hallo Tobias, hast du ein paar Anrufe bekommen?» Alle lachen. «Ihr wart das. Etwa hundert Leute haben bei uns angerufen!» Tobias schluckt. Ihm wird klar, dass Silvan, Fabian und Thomas ihm wieder einen Streich gespielt haben. Auf der Messe, die die drei am Samstag besucht hatten, gab es die Möglichkeit, kostenlos ein Zeitungsinserat aufzugeben.
Fabian meinte zu seinen Freunden: «Kommt, wir schauen die Telefonnummer von Tobias im Telefonbuch nach und schreiben rein, dass er eine kostenlose Nintendo-Konsole abzugeben hat.» Ein lustiger Streich? Oder bereits Mobbing?
In diesem Fall war es Mobbing. Wir haben uns häufig auf dem Pausenplatz geprügelt, dabei gelegentlich auch eine blutige Nase geholt – ohne dass ich deshalb von Mobbing sprechen würde. Warum bezeichne ich diesen scheinbar harmlosen Streich als Mobbing?
Ich tue es deshalb, weil ich die Hintergründe kenne, weil – so sehr ich mich dafür schäme – ich in diesem Beispiel alle Namen verändert habe, ausser meinen eigenen.
Mobbing war es, weil wir Tobias ständig solche Streiche spielten. Weil wir die Augen verdrehten, wenn er so fleissig aufstreckte und mit den Fingern schnippte, weil die halbe Klasse stöhnte, wenn er eine von seinen «neunmalklugen» Antworten gab.
Mobbing war es, weil wir viele waren und Tobias alleine. Mobbing war es, weil er stets das Opfer war, weil wir ihm unmissverständlich und immer wieder signalisierten: Wir mögen dich nicht! Und wir werden dich nicht in Ruhe lassen, egal, was du tust!
Mobbing war es, weil Tobias uns nie etwas getan hatte – und weil er keine Möglichkeit hatte, uns auszuweichen, sich zu wehren oder sich anzupassen. Aus allem, was er tat, leiteten wir Gründe ab, um ihn weiter fertigzumachen.
Dabei gelang es uns – und das finde ich an Mobbing das Schlimmste –, die Erwachsenen auf unsere Seite zu ziehen. Ihnen zu suggerieren, dass unsere Aktionen gerechtfertigt waren und dieser Junge es nicht anders verdient hatte.

Während meiner gesamten Primarschulzeit hat kein einziges Mal ein Elternteil oder eine Lehrperson klar Stellung gegen unsere Taten bezogen. In der dritten Klasse kam Tobias’ Mutter dreimal vorbei, um mit unserem Lehrer zu sprechen. Dieser führte danach jeweils ein Gespräch mit uns.
Ich kann mich erinnern, dass er uns viel Verständnis entgegenbrachte, uns zustimmte, dass dieser Junge schwierig sei und er es nachvollziehen könne, dass wir teilweise so reagierten. Und dass unsere Streiche natürlich nicht so schlimm gewesen seien, dieser Junge einfach sehr sensibel reagiere. Aber wir sollten doch bitte damit aufhören, diese Mutter käme ständig in die Schule.
Die Botschaft war klar: Tobias hatte es eigentlich verdient, aber wir sollten es auf eine Art und Weise tun, die den Lehrer weniger stört. Irgendwann kam die Mutter nicht mehr. Sie hatte aufgegeben. Tobias war nun ganz allein.
«Das haben wir doch früher auch so gemacht!»
Wie konnten meine Freunde und ich so gemein sein? Wir waren keine «bösen» Kinder. Wir waren auch nicht schlecht erzogen. Es fehlte uns grundsätzlich weder an Empathie noch an Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen.
Wir fühlten uns in der Klasse wohl und waren sozial kompetent genug, unsere Aktionen so darzustellen, dass Eltern mitgelacht haben, wenn wir von Streichen erzählten, und der Lehrer die Mutter von Tobias als lästig empfand und sie abwimmelte.
Ich höre sehr oft von ähnlichen Geschichten, obwohl viele Schulen heute stark auf das Thema Mobbing sensibilisiert sind. Vielleicht denken Sie: «Das haben wir früher doch auch gemacht.» Ja, das haben wir. Ich auch. Und es war gemein und falsch!
Es sorgt dafür, dass einzelne Kinder leiden, ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl einbüssen und in schlimmeren Fällen diese Erlebnisse ihr ganzes Leben lang mit sich herumtragen, eine psychische Störung entwickeln und sich manchmal sogar das Leben nehmen.
Es war Mobbing, weil Tobias uns nie etwas getan hatte und sich nicht wehren konnte.
Mobbing können wir nur verhindern, wenn wir alle, Lehrpersonen, Eltern und Kinder, anfangen, Verantwortung zu übernehmen. In diesem Dossier möchten wir Ihnen vermitteln, welche Mechanismen bei Mobbing am Werk sind, was uns daran hindert, Verantwortung zu übernehmen – und wie wir uns aus der Hilflosigkeit befreien können.
Es gibt kaum ein Kind, das während seiner Schulzeit nicht mit Mobbing in Berührung kommt. Davon bekommen Sie als Mutter, Vater oder Lehrperson meist wenig mit.
Sogar wenn Kinder von anderen massiv schikaniert, ausgegrenzt, verprügelt und fertig gemacht werden, verkennen viele Eltern und Lehrpersonen das Problem.
In fast jeder Klasse wird ein Kind gemobbt. Dies bedeutet für Sie als Mutter oder Vater, dass wahrscheinlich auch Ihr Kind in irgendeiner Form involviert ist.
Es wird dabei eine von sechs Rollen einnehmen, die Heike Blum und Detlef Beck in ihrem Buch «No Blame Approach» beschreiben: Die Mobbingaktionen gehen von den Akteuren aus. Diese holen sich durch ihre Taten Anerkennung und sichern sich eine starke Position in der Klasse.
Sie ernten Lacher für ihre Streiche und sorgen in der Klasse für Spannung und Action. Die Assistenten und Verstärker springen auf den Zug auf.
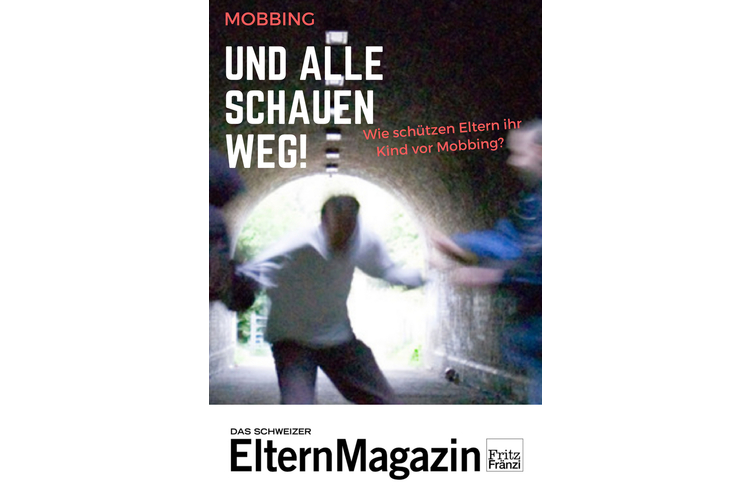
Die Assistenten unterstützen tatkräftig, indem sie Ideen ausführen oder mitmachen. Die Verstärker machen nichts direkt mit, signalisieren den Akteuren jedoch klar, dass sie auf deren Seite stehen und das Mobbing gutheissen. Die Zuschauer halten sich raus, meist aus Angst, selbst Opfer zu werden.
Schliesslich gibt es noch die Verteidiger, die zu Beginn versuchen, das von Mobbing betroffene Kind zu schützen. Sie werden – wenn sie keine Unterstützung durch andere Kinder oder Erwachsene erhalten – oft zu Erduldern, die das Mobbing als falsch empfinden, sich aber nicht mehr dagegen zur Wehr setzen. Der oder die von Mobbing Betroffene wird gedemütigt, erniedrigt und misshandelt.
Mobbing entsteht aus einer Gruppendynamik, bei der Kinder mit der Zeit bestimmte Rollen einnehmen. Es lässt sich daher nur lösen, wenn diese Dynamik durchbrochen wird. Wer denkt, es ginge nur um eine Auseinandersetzung zwischen «Täter» und «Opfer», übersieht das wirkliche Problem und setzt am falschen Punkt an.
Ein Konflikt oder Streit zwischen Kindern entsteht meist aus einer bestimmten Situation heraus. Meist leiden beide Parteien darunter und sind froh, wenn die Auseinandersetzung beigelegt werden kann.
Eine Mobbingsituation entwickelt sich hingegen oft schleichend und nimmt langsam Fahrt auf. Meist merken alle Beteiligten lange Zeit nicht, was eigentlich geschieht. Sie finden langsam in ihre Rolle hinein und gewöhnen sich daran, dass die Gemeinheiten an Häufigkeit und Intensität zunehmen.
Die Reaktionen des betroffenen Kindes werden dabei als Rechtfertigung für die weiteren Aktionen herangezogen. Das Ausmass des Leids des gemobbten Kindes wird dabei nicht wahrgenommen und der eigene Anteil daran verdrängt.
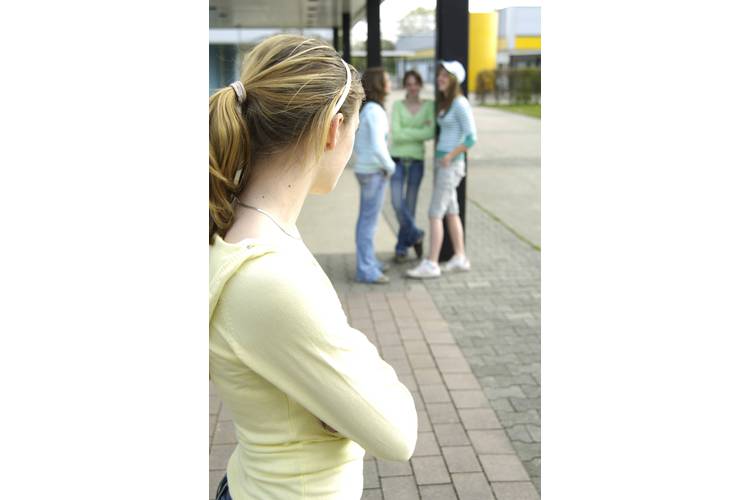
Bild: Imago
Etwas, das im Zusammenhang mit Mobbing immer auftaucht, ist das Wort «nur». Wir haben doch nur Mein Kind hat doch nur – … es sind doch nur Kinder.
Das gesamte Ausmass wird erst deutlich, wenn man «nur» durch «und» ersetzt: Wir haben ihm die Schuhe versteckt und wir haben ihn bei der falschen Antwort ausgelacht und ihn beim Fussball ausgeschlossen und ihm gesagt, dass er stinkt, und den Stuhl «desinfiziert», auf dem er gesessen hat, und – ihm durch all das zu verstehen gegeben, dass wir ihn verachten. Es ist, als würde aus der Gruppe heraus ein Ungeheuer beschworen, das niemand mehr alleine bändigen kann.
Im Gegensatz zu einem Konflikt zielt Mobbing darauf ab, einen anderen fertigzumachen, sein Leben zu vergiften. Es ist ein Gruppenphänomen, das durch ein extremes Machtungleichgewicht gekennzeichnet ist.
Der Betroffene wird dabei wiederholt und systematisch von einer Gruppe gequält, erniedrigt, ausgeschlossen und attackiert, ohne die Möglichkeit zu haben, sich aus seiner Lage zu befreien.
Das gemobbte Kind beginnt sich in dieser Situation zu verändern. Manche ziehen sich zurück, wirken still, ängstlich und apathisch. Andere werden aggressiv, entwickeln eine «dünne Haut» und explodieren. Das Kind beginnt «komisch» zu wirken, es scheint das Mobbing durch sein Verhalten auf sich zu ziehen.
In dieser Situation braucht das Kind unbedingt Hilfe von aussen. Es braucht Erwachsene, die sehen und erkennen wollen, was vorgeht, klar Stellung gegen das Mobbing beziehen, wissen, was sie tun, und gemeinsam mit den Kindern eine Lösung entwickeln. Ungünstige Einstellungen, Ängste, Unsicherheiten und Unwissenheit hindern die Erwachsenen daran.
Er ist ja auch nicht ganz unschuldig…
Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass Sie sich in einzelnen Sätzen, die wir im Folgenden beschreiben werden, wiedererkennen. Dann braucht es Mut und Offenheit, um sich kritisch mit den eigenen Ansichten auseinanderzusetzen.
Ich werde Sie nicht schonen und vertraue darauf, dass Sie ehrlich mit sich sind. Wir können Mobbing nur begegnen, wenn wir sehen, wie wir selbst dazu beitragen.
Es geht dabei nicht um Schuld, sondern um Verantwortung, die wir Erwachsenen übernehmen müssen, um nicht unbewusst am Mobing mitzuwirken.
Es kann sein, dass das betroffene Kind durch sein Verhalten den Ärger anderer Kinder auf sich zieht. Vielleicht ist es besonders strebsam, kleidet sich anders an als andere, hat eine eigentümliche Art, sich auszudrücken, oder kann soziale Signale nicht richtig einordnen.
Es wäre unproblematisch, wenn Eltern und Lehrpersonen zum Schluss kommen würden, dass nach einer Intervention in der Klasse auch das betroffene Kind dabei unterstützt werden sollte, sich ein Stück weit anders zu verhalten.
Dabei sollte klar sein, dass das Kind erst dann ein neues Verhalten ausprobieren kann, wenn es dafür einen sicheren Raum hat und die Klasse das neue Verhalten positiv aufnimmt. In vielen Fällen ist das scheinbar problematische Verhalten des gemobbten Kindes lediglich eine Reaktion auf die Quälereien.
«Du musst dich halt wehren!»
Sätze wie «Er ist ja auch nicht ganz unschuldig» oder «Sie provoziert ja auch» sind deshalb so daneben, weil sie oft als Begründung dienen, um nicht aktiv werden zu müssen.
Die Botschaft dahinter ist: Das Opfer müsste nur «an sich arbeiten» und sich anders verhalten, dann würde das Mobbing aufhören.
Meist unbewusst signalisiert man in diesem Fall als Lehrperson oder Elternteil die folgende Einstellung: «Das gemobbte Kind ist selbst schuld. Es hat deswegen das Mobbing als gerechte Strafe verdient und von mir keine Hilfe zu erwarten.»
Mit dieser Haltung wird das Kind in einer Situation alleine gelassen, die es nur mit entschlossener Hilfe von aussen bewältigen könnte.
Teilweise übernehmen gemobbte Kinder diese Einstellung und beginnen selbst zu glauben, dass sie es nicht anders verdient haben und Mobbing als ihr Schicksal akzeptieren müssen. Eltern von Kindern, die gemobbt werden, reagieren nicht selten mit Vorschlägen, die sich wie Vorwürfe anhören:
- «Du musst dich halt wehren!»
- «Warum hast du das der Lehrerin nicht erzählt!?»
- «Hau dem doch einfach mal eine runter, dann hört der schon auf!»
Hinter solchen Aussagen stehen völlig naive Überzeugungen – beispielsweise, dass jeder Mobber im Grunde genommen ein Feigling ist und gleich aufhören wird, wenn man sich zur Wehr setzt.
Tatsächlich hat ein Kind, sofern sich eine Mobbingsituation eingespielt hat, kaum Möglichkeiten. Sucht es Hilfe, gilt es als Petze, läuft es weg, ist es ein Feigling, versucht es sich anzupassen und freundlich zu sein, ist es ein Schleimer, und wehrt es sich, gilt es als «voll aggro».
Es ist nicht hilfreich, wenn dieses Kind auch noch erleben muss, dass die eigenen Eltern es als Schwächling empfinden und seine Situation nicht nachvollziehen können. Werden dem Kind auch noch zu Hause seine Gefühle abgesprochen, vereinsamt es im Kreis der eigenen Familie.
Manche Kinder schämen sich, dass sie die Vorschläge der Eltern nicht umsetzen können, und verheimlichen in der Folge das Mobbing.
«Das ist doch noch lange kein Grund, gleich zuzuschlagen!»
Manche Kinder reagieren aggressiv auf das Mobbing. Es fällt geschickten Akteuren leicht, dies auszunutzen und so lange und subtil auf den wunden Punkten des betroffenen Kindes herumzuhacken, bis dieses explodiert und sich wehrt. Die Lehrperson sieht oft nur diese heftige Reaktion.
Schlägt das Kind, das über Wochen hinweg drangsaliert wurde, schliesslich zu, hat es etwas getan, das aus Sicht der Lehrperson bestraft werden muss.
Erklärungen des betroffenen Kindes werden in der Folge oft mit dem Satz «Du musst dich halt mit Worten wehren» oder «Das ist noch lange kein Grund, gleich zuzuschlagen» abgetan.
Ehrlich gesagt: Es ist ein ziemlich guter Grund, zuzuschlagen – insbesondere dann, wenn niemand zuhört, hinsieht und erkennt, was wirklich los ist.
Manche Eltern und Lehrpersonen reagieren nicht, weil sie Angst haben, die Situation noch schlimmer zu machen. Eltern befürchten oft, als Nervensägen zu gelten. Lehrpersonen fühlen sich unsicher, wie sie das Thema aufgreifen sollen.
Der Philosoph Paul Watzlawick hat einmal gesagt: «Man kann nicht nicht kommunizieren.» Das gilt im Falle von Mobbing ganz besonders. Nicht Reagieren ist ein klares Signal an die Akteure und die gesamte Klasse, dass das Mobbing geduldet wird und die Schule keinen Schutz bietet.
Eine Mutter hat mir tatsächlich berichtet, dass sich die Schulleitung bei ihrem Kind, das täglich schikaniert wurde, mit dem folgenden Satz aus der Verantwortung stahl: «Der Schulweg fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich.»
Das ist, als würde man den Schülern sagen: «Schaut, da, bei diesem Strich, endet das Schulareal. Wenn ihr jemanden quälen wollt, dann bitte ausserhalb dieser Linie. Dann müssen wir uns nicht darum kümmern.»

Bild: André Schuster / plainpicture
Eine andere Mutter, deren Kind regelmässig von zwei anderen Jungen zusammengeschlagen wurde, meinte, dass sie bereits zweimal mit der Lehrerin gesprochen habe und nichts passiert sei. Auf meine Frage, was sie als Nächstes tun werde, sagte die Mutter: «Ich habe doch schon alles versucht – und er muss ja trotzdem zur Schule.»
Warum nehmen wir bei Kindern etwas hin, womit wir keinen Erwachsenen alleine lassen würden? Stellen Sie sich vor, Ihre Partnerin oder Ihr Partner wird bei der Arbeit regelmässig von zwei grossen, starken Kollegen verprügelt und kommt mit blauen Flecken nach Hause und Sie sagen: «Ich kann da leider nicht viel machen – ich habe schon mit deinem Chef gesprochen und wir brauchen das Geld.»
Wir müssen aufhören, die Schuldfrage zu stellen und unsere Kinder ernst nehmen!
Fachpersonen, die sich auf das Thema Mobbing spezialisiert haben, raten einhellig davon ab, die Eltern der Akteure zu kontaktieren. Meist verschlimmert dies die Situation des gemobbten Kindes.
Viele Eltern können sich nicht vorstellen, dass ihr kleiner Sonnenschein zu perfiden Taten fähig ist, und weisen bereits den Gedanken daran entrüstet von sich oder suchen wiederum automatisch die Schuld beim «Opfer».
Auch gut erzogene, sympathische Kinder aus behütetem Elternhaus können Teil dieser Gruppendynamik werden. Es macht Ihr Kind nicht zu einem schlechten Menschen, wenn Sie hinschauen, mit Ihrem Kind über Mobbing reden und mit ihm überlegen, wie es diese Rolle verlassen kann.
Vielmehr macht es Sie zu einem verantwortungsvollen Elternteil. Manche Eltern hätten gerne, dass ihr Kind unerschütterlich und selbstbewusst zu seiner Individualität steht. Beinahe verzweifelt versuchen sie dem Kind Powersätze einzubläuen wie:
- «Ich bin nicht auf der Welt, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten.»
- «Die sind doch nur neidisch.»
- «Ist mir doch egal, was die von mir denken.»
- «Sollen die doch reden.»
Kinder verbringen ihre halbe Lebenszeit in der Schule. Wie es ihnen in der Klasse geht und ob sie sich dort akzeptiert fühlen, bestimmt zu einem grossen Teil, wie wohl sie sich fühlen und welchen Wert sie sich als Mensch zuschreiben.
Floskeln und Rezepte, die für Erwachsene funktionieren, die sich ihre Bezugspersonen selbst aussuchen können, greifen bei Kindern nicht. Das Bedürfnis, dazuzugehören, ist Teil unserer Existenz. Ein Kind kann dieses nicht einfach mit oberflächlichen Sprüchen ersticken.
Wie lautet also das Fazit?
Wenn wir wirksam gegen Mobbing vorgehen möchten, müssen wir aufhören, die Schuldfrage zu stellen. Diese verstellt den Blick auf das Problem und führt dazu, dass wir uns rechtfertigen und die Verantwortung abschieben.
Wir müssen:
- Kinder ernst nehmen und Vorfälle nicht bagatellisieren;
- lernen, Mobbing zu erkennen und von Konflikten oder Streit zu unterscheiden;
- Klare Stellung dafür beziehen, dass jedes Kind das Recht darauf hat, sich in der Schule sicher und wohlzufühlen;
- ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Mobbing ein Gruppenphänomen ist und daher auch auf Gruppenebene gelöst werden muss;
- Lösungen gemeinsam mit den Kindern entwickeln, ohne jemanden zu verurteilen.
Im Dossier der Septemberausgabe des Schweizer ElternMagazin Fritz+Fränzi gehen wir auf diese Punkte ein. Auch hier auf der Internetseite des Elternmagazins wollen wir in dieser Woche viele Punkte ansprechen. Unter anderem lernen das «No Blame Approach»-Programm kennen, mit dessen Hilfe Sie als Lehrerperson eine Mobbingsituation auflösen können. Sie lesen über die Erfahrungen einer Primarlehrerin mit Mobbing im Schulalltag. Sie erfahren, was Sie als Mutter oder Vater tun und unterlassen sollten, wenn Ihr Kind in eine Mobbingsituation verwickelt ist.
An wen kann ich mich wenden?
Da Mobbing ein Gruppenphänomen ist, sollte es auch in der Gruppe gelöst werden. Ansprechpartner ist daher die Schule.
Die folgenden Personen können Sie unterstützen:
- Lehrperson
- Schulleitung
- Schulsozialarbeiter/in
- Schulpsychologe/in
- Schulpflege
Schulsozialarbeiter wissen normalerweise am besten, wie man Mobbing begegnen kann. Die Lehrperson und der/die Schulsozialarbeiter/in sind daher meist die ersten Personen, die informiert werden sollten. Bereiten Sie das Gespräch gut vor.
Schildern Sie, was Sie sich von der Schule wünschen, und fragen Sie nach, was die Schule unternehmen wird. Führen Sie das erste Gespräch ohne Ihr Kind. Beziehen Sie weitere Personen mit ein, wenn sich die Situation nicht verbessert.