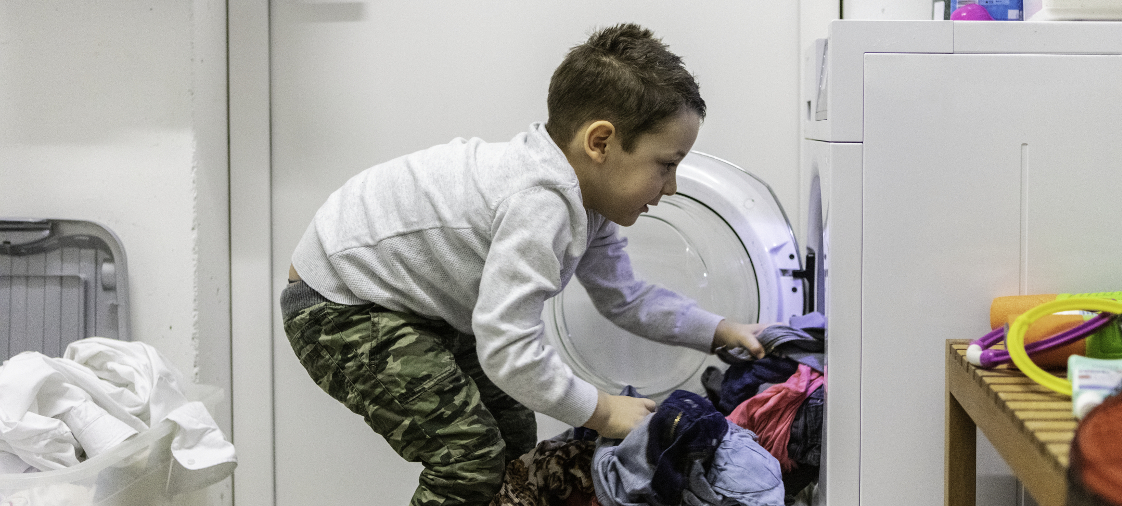Warum wir ohne Strafe erziehen – Familien erzählen

Wenn das Kind nicht so möchte wie die Eltern, kommt es schnell zu Streit, Reibereien und Geschrei. Wie schaffen es Mütter und Väter, Konflikte ohne Bestrafung zu meistern? Drei ganz persönliche Erfahrungsberichte.
Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und bei Konflikten klare Regeln durchzusetzen, geht auch ohne Bestrafung. Doch: Erziehen ohne Strafen – wie kann so etwas funktionieren? Zwei Mütter und eine Tochter erzählen, wie sie es erleben.
Corinna Nüesch: «Ich wollte herausfinden, warum ich oft schlecht gelaunt und unzufrieden war»
Vor drei Jahren besuchte Corinna Nüesch, 39, mit ihrem Mann Daniel, 45, einen Elternkurs zur gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg. In der fünfköpfigen Familie war es immer wieder zu Spannungen und Reibereien gekommen. «Mein Mann und ich, aber auch unsere drei Kinder sind ziemlich eigensinnig und dickköpfig», sagt Corinna Nüesch selbstkritisch.
Thorin, 14, habe schon als kleines Kind die Auseinandersetzung mit seiner Mutter gesucht. «Er war sehr wissbegierig, und mit einfachen Erklärungen liess er sich nicht abspeisen», erinnert sich die Mutter. Als Corinna Nüesch einmal von ihm verlangte, er solle sein Zimmer aufräumen, drohte er ihr, von zu Hause wegzulaufen. Und so kam es auch: Der kleine Bub packte seine Zahnbürste und sein Kuscheltuch ein, zog Schuhe und Jacke an und lief aus der Wohnung. Die Eltern folgten ihm, so dass dem Jungen nichts passieren konnte.
Im Kurs über gewaltfreie Kommunikation merkten Corinna und ihr Mann, dass in der Theorie manches einfacher ist als im Alltag. Es brauchte viel Übung, bis die beiden die zentrale Haltung der gewaltfreien Kommunikation zunehmend besser umsetzen konnten: Verbundenheit entsteht, indem wir versuchen, nicht nur auf das Gesagte, sondern auch auf das Gemeinte zu hören.
Corinna erkannte vor allem, dass es für sie eine grosse Herausforderung war, ihre eigenen Bedürfnisse als Mutter zu erkennen und zu kommunizieren. Herauszufinden, warum sie etwa schlecht gelaunt oder unzufrieden war und was sie brauchte, damit es ihr wieder besser ging, war für sie ein längerer Prozess.
Wer seine Bedürfnisse kennt, kann auch viel besser seine Wünsche äussern.
Heute weiss sie, dass sie vor allem dann «aus dem Gleichgewicht» gerät, wenn ihr zentrales Bedürfnis nach Autonomie verletzt oder ihr zu wenig Vertrauen entgegengebracht wird. Sie kann dies nun auch äussern und vor allem kundtun, was sie möchte und braucht. Der veränderte Umgang in der Familie führte zu neuen Erkenntnissen: Im «Nein» immer auch ein «Ja» – jedoch zu etwas anderem – zu sehen. Es galt nun vermehrt zu klären, wozu man denn «Ja» meinte, wenn «Nein» gesagt wurde. Wer etwas nicht will, möchte etwas anderes. Und wer seine Bedürfnisse kennt, kann auch viel besser seine Wünsche äussern.
Corinna und Daniel leben seit einem Jahr getrennt, stehen jedoch in einem freundschaftlichen Verhältnis zueinander. Jeweils am Sonntagabend isst die ganze Familie gemeinsam. Die gewaltfreie Kommunikation habe ihr und auch Daniel dabei geholfen, ihren Konflikt auf der Paarebene anzugehen, ohne die Kinder damit zu belasten. Weil das Verständnis füreinander gefördert worden sei, sagt Corinna Nüesch. Und die 10-jährige Smetine erinnert ihre Eltern manchmal daran, doch in der «Giraffensprache» miteinander zu reden.
Mia Vökler: «Gewaltfreie Erziehung heisst, angstfrei miteinander zu kommunizieren»
Die 21-jährige Mia studiert Politikwissenschaften und Psychologie in Leipzig. Diese Fächerkombination wählte sie aufgrund ihres Interesses für zwischenmenschliche Prozesse sowie für Themen wie Konfliktlösung und interkulturelle Verständigung. Mia fühlte sich von ihren Eltern – beide Psychologen mit humanistischem Hintergrund – immer ernst genommen. Mit ihnen konnte sie reden, auch und insbesondere dann, wenn sie sich nicht verstanden fühlte. So entwickelte sie schon früh ein gutes Einfühlungsvermögen in sich und in andere und konnte auf dem Pausenplatz die eine oder andere Konfliktsituation lösen. Aufgrund ihrer nicht bewertenden Art konnte sie offen auf andere zugehen und war ein sehr kommunikatives Kind.
«Ich kann mich gut erinnern», sagt Mia, «dass ich sehr sensibel dafür war, wenn jemand missverstanden oder beschämt wurde. Autoritätspersonen haben mir keine Angst gemacht, und so hab ich mich getraut, auch Lehrer zu kritisieren und das Gespräch mit ihnen zu suchen, wenn Mitschüler ungerecht behandelt wurden.» Wenn Mia auf Menschen trifft, die vielleicht nicht über ihre Gefühle sprechen möchten, respektiert sie das auch: «Dahinter steckt schliesslich ebenfalls ein Bedürfnis.» Mittlerweile wohnt sie in einer grossen Wohngemeinschaft in Leipzig. «Da bekommt man immer wieder mit, wie unterschiedlich Bedürfnisse sein können.»
Eine gewaltfreie Erziehung bedeutet nicht, keinerlei Konflikte mit den Eltern zu haben.
Wie hat sie den Ablösungsprozess von ihren Eltern erlebt? «Tatsächlich war es eine besondere Aufgabe, meine Mutter und meinen Vater auch im Lichte ihrer nicht perfekten Seiten zu betrachten», sagt Mia.
Sie habe erkannt, dass es Dinge gebe, die sie anders und auf ihre Weise mache möchte – «trotz der tiefen Verbundenheit, die ich zu meinen Eltern immer verspürte. Aber ich kann offen mit ihnen darüber reden. Eine gewaltfreie Erziehung bedeutet nicht, keinerlei Konflikte mit den Eltern zu haben, sondern dass man angstfrei miteinander kommunizieren kann.» Neben ihrem Studium engagiert sich Mia mit anderen Studenten zusammen in einem wöchentlichen Spieletreff für Kinder aus Familien, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Dieses Zusammentreffen sei für alle eine grosse Bereicherung und Freude, sagt Mia.
Eva Schmid: «Ich habe meinen Sohn frühmorgens oft angeschrien»
Alles fing damit an, dass Aaron nicht mehr in den Kindergarten wollte. Der damals Fünfjährige zeigte verschiedene Ängste und entwickelte sich zu einem Kind, das zunehmend unglücklich war. Im Kindergarten zog Aaron sich zurück, und als er in die 1. Klasse kam, verstärkte sich dies. Eva Schmid, 46, liess ihren Sohn bei Nadine Zimet psychologisch abklären. Die Untersuchung ergab, dass Aaron ein hochbegabter und hochsensibler Junge ist – jedoch mit asynchronem Begabungsprofil. In seinem Fall bedeutet dies, dass er sehr hohe Leistungen im mathematischen Bereich zeigt, jedoch beim Lesen und Schreiben mehr Unterstützung benötigt als andere Kinder.
Eva Schmid hatte immer gespürt, dass es ihrem Kind nicht gut ging.
In der Schule wurde von Aaron vor allem verlangt, dass er sich anpasst. Für den hochsensiblen Jungen, der sich in den mathematischen Fächern langweilte und beim Schönschreiben erfolglos abmühte, war das unmöglich. Er fühlte sich unverstanden, anders als die anderen, wollte morgens oft nicht mehr aufstehen und war antriebslos.
Eva Schmid hatte immer gespürt, dass es ihrem Kind nicht gut ging. Dennoch hatte sie während vielen Jahren versucht, Aaron «windschnittig» zu machen. Sie wollte ihn disziplinieren, seine Anpassung an die Schule forcieren. Bis die Verzweiflung des Jungen so gross war, dass er der Mutter gegenüber Suizidgedanken äusserte. Eva Schmid wusste nun, dass es so nicht mehr weitergehen konnte, und holte sich Unterstützung.
Eva merkte: Strafen bringt nichts
In einem mehrmonatigen Kurs über gewaltfreie Kommunikation lernte sie, wie sie ihre eigenen Bedürfnisse und die ihrer Kinder besser wahrnehmen konnte. Sie merkte, dass sie oft aus Erschöpfung und Überforderung nicht auf ihre Kinder einging und sie deshalb schimpfte und herumschrie. Sie merkte auch, dass sie mit Drohungen und Bestrafungen ihre Kinder nicht erreichte. Eva Schmid traf auf andere Eltern, die mit ihrem bisherigen Erziehungsstil ebenfalls an ihre Grenzen stiessen. Gemeinsam mit ihnen fand die 46-Jährige heraus, wie sie die Bedürfnisse hinter dem Verhalten ihrer Kinder erkennen und diesen so eher gerecht werden konnte.
Wir redeten wirklich miteinander und hörten uns zu – und es war viel weniger Geschrei zu Hause.
«Während mich meine Mutter früher in ihrer Verzweiflung morgens anschrie, ich solle nun endlich aufstehen, sie mich aus dem Bett zu zerren versuchte, verstand sie nun, dass all dies die Situation nur verschlimmerte», sagt der 17-jährige Aaron heute. Seine Mutter habe angefangen, viel einfühlsamer mit ihm zu reden, aber auch ihre eigenen Grenzen kundzutun.
Auf dieser Basis habe das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und seiner Mutter allmählich wieder wachsen können. Und während der Sohn erzählt, wird spürbar, wie sehr die Mutter die positiven Veränderungen nach all den Jahren immer noch berührt.
Auch der heute 14-jährige Bruder erinnert sich gerne daran zurück, wie der Umgang zwischen ihm und seiner Mutter zusehends ein anderer wurde: «Wir redeten wirklich miteinander und hörten uns zu – und es war viel weniger Geschrei zu Hause.»
Rico, 24, der älteste Sohn, wohnt nicht mehr bei der Mutter. Es schmerzt Eva Schmid, dass sie mit ihm während seiner Kindheit noch nicht auf diese Weise umgehen und kommunizieren konnte. Auf die Frage, ob sie denn nicht hin und wieder dennoch «ausflippe» oder die Nerven verliere, meint Eva Schmid gelassen: «Das passiert auch heute noch. Aber dann weiss ich, welches die Gründe dafür sind, und kann darüber reden und mich auch einmal entschuldigen.»