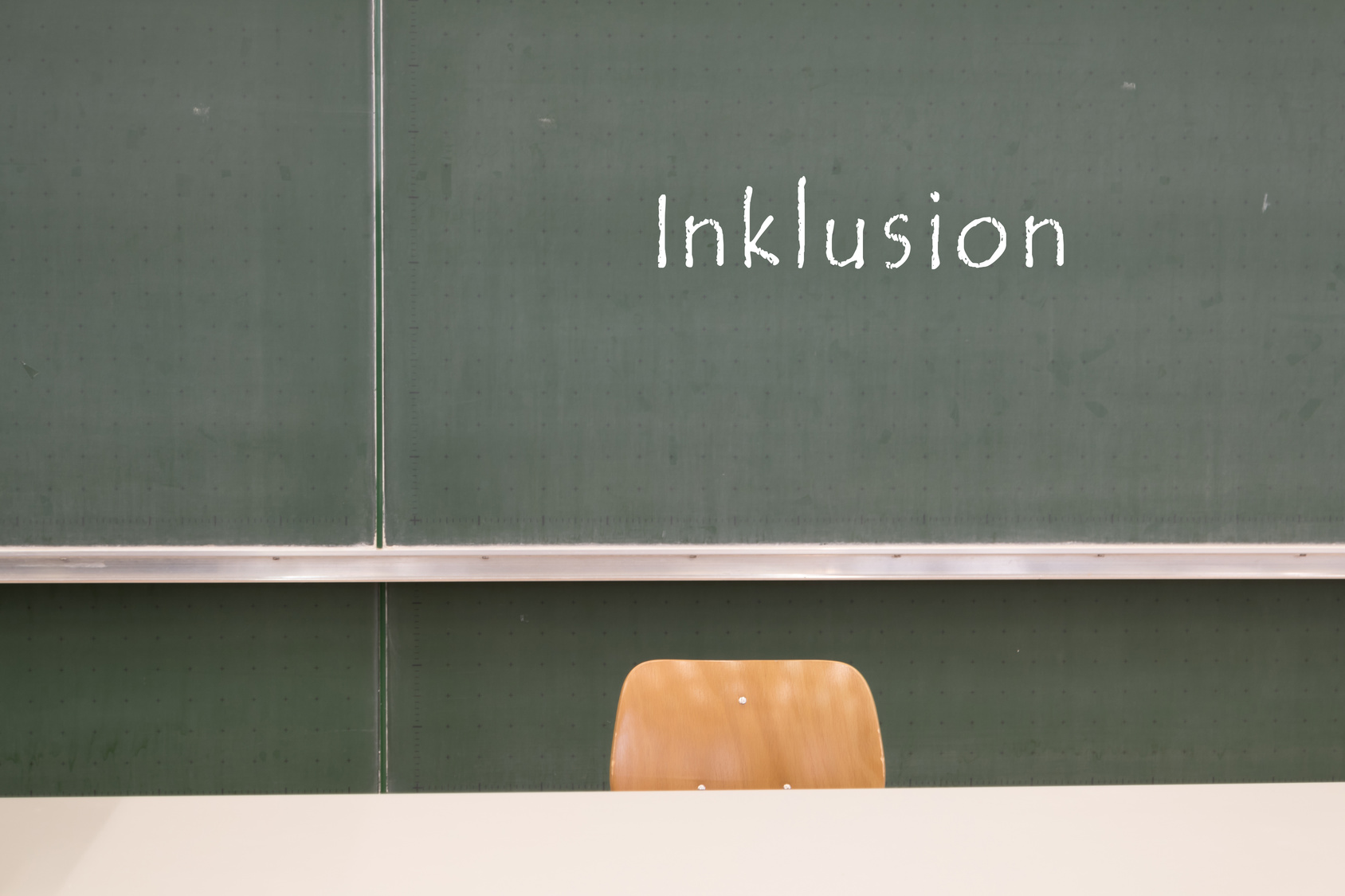Eine Schule für alle?

Früher besuchten Kinder mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensproblemen Sonderschulen, heute wenn möglich die Regelschule. Was Befürworter als gesellschaftliche Errungenschaft loben, sehen Kritiker als Zerreissprobe fürs Schulsystem. Was kann Inklusion wirklich leisten, was nicht?

Rahand ist ein Kind mit besonderem Bildungsbedarf. Als solche bezeichnet die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren Schülerinnen und Schüler, «die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihnen angemessene Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können». Das heisst: Sie brauchen spezielle Hilfestellungen, um dem Unterricht folgen zu können.
Ein besonderer Bildungsbedarf kann geringfügig sein oder vorübergehend auftreten, beispielsweise, wenn ein Kind eine leichte Lese-Rechtschreib-Schwäche hat. Dann greift im Idealfall das sonderpädagogische Grundangebot, das die Volksschule bereitstellen muss. Zu diesen niederschwelligen Massnahmen gehören Logopädie oder Psychomotorik, aber auch integrative Förderung (IF), also in den Klassenunterricht eingebettete Unterstützung durch die schulische Heilpädagogin.
Mancherorts gibt es sechs Wochenlektionen integrative Förderung – anderswo nur zwei.
IF setzt keine Diagnose voraus und kommt etwa zum Einsatz, wenn ein Kind leichtere Lernschwierigkeiten wie einen verzögerten Schriftsprachenerwerb, Probleme mit Mathematik oder mangelnde Arbeitsstrategien hat. Wie viel Zeit die Heilpädagogin für die Klasse hat, hängt von der Schulstufe, vor allem aber von Kanton oder Gemeinde ab. Mancherorts sind es sechs, anderswo nur zwei Wochenlektionen – ein Pensum, das sich alle teilen müssen.
Massgeschneiderte Förderung dank Sonderschulstatus
Kinder wie Rahand hingegen haben Anrecht auf individuelle Förderressourcen. Heil- oder Sozialpädagoginnen und Hilfskräfte wie Klassenassistenten unterstützen sie stunden- oder tageweise, damit sie am Unterricht in der Regelschule teilhaben können. Diese Spezialbetreuung ist an einen Sonderschulstatus gekoppelt und dieser an eine medizinische Diagnose oder die Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst des Kantons.
Zielgruppe sind Kinder mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, Sprach- und Lernbehinderungen, Autismus-Spektrum- oder Verhaltensstörungen. Früher besuchten sie eine Sonderschule oder Sonderklassen an den Regelschulen, auch bekannt als Kleinklassen. Heute lernen sie nach Möglichkeit gemeinsam mit durchschnittlich entwickelten Gleichaltrigen.
Diesem Paradigmenwechsel liegen ein gesellschaftlicher Wandel, aber auch die Bestimmungen des Behindertengleichstellungsgesetzes zugrunde, das 2004 in Kraft trat. Zwar lässt sich ein Platz in der Regelschule nicht einklagen – die Schule darf ein Kind mit besonderem Bildungsbedarf aber auch nicht unbegründet abweisen.
Bessere Lernbedingungen oder Nachteile für alle?
Die Volksschule von heute will eine Schule für alle sein. Dies führe zur Überlastung von Lehrpersonen und zu Nachteilen für alle, sagen Kritiker: Kinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen würden an der Regelschule nicht adäquat gefördert und normalbegabte Peers durch sie ausgebremst. Sie fordern die Rückkehr zu Kleinklassen und Sonderschulung.
Befürworter integrativer Ansätze sind hingegen überzeugt, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf in Regelklassen gut aufgehoben sind, dort bessere Lernfortschritte erzielen als in Sonderschulen – und sie glauben, dass dieser Vorteil nicht zu Lasten der Normalbegabten geht. Was sagt die Forschung dazu? Worauf kommt es an, damit Inklusion gelingt? Wo stösst sie an ihre Grenzen? Wie geht es denen, die sie pädagogisch umsetzen müssen?
Wenn mehr als zwei Drittel der Erstklässler zu Hause kein Deutsch sprechen, ist es nicht einfach, Inhalte zu vertiefen.
Zurück zu Rahand und der Schule Schauenberg. Der Kreis löst sich auf, die Kinder setzen sich an ihre Pulte. Heilpädagogin Lea Albrecht kommt mit einem Teil der Klasse aus dem Gruppenraum zurück, wo sie Antons Geschichte in vereinfachter Sprache erzählt hat. Mehr als zwei Drittel der 22 Erstklässler sprechen zu Hause kein Deutsch. Inhalte zu vertiefen, ist nicht einfach, wenn sprachliche Grundlagen fehlen, Kinder etwa nicht wissen, was «Beutel» heisst.
Zehn Lektionen pro Woche arbeitet Albrecht in der Klasse von Lehrerin Joy Traber. Sechs davon hat die Klasse zugute, vier sind der sonderpädagogischen Förderung von Rahand gewidmet. Weil deren Ziel auch darin liegt, den Jungen in seiner Selbständigkeit zu fördern, sitzt die Heilpädagogin nicht permanent neben Rahand, sondern lässt ihn auch in Eigenregie arbeiten. So bleibt sie dem Rest der Klasse als zusätzliche Ansprechperson erhalten.

Albrecht arbeitet möglichst oft integrativ, also im Klassenverband. «Je nachdem bietet sich auch separiertes Arbeiten an», sagt sie. Etwa, wenn die Schülerin, die Mühe im Rechnen hat, Platz braucht, um Bohnen auszulegen, die ihr helfen, den Zahlenraum zu visualisieren. Oder, wie jetzt, wenn Kinder mit grösseren Lücken im Deutsch das Buchstabieren in der Kleingruppe üben. Oft bindet die Heilpädagogin schulisch starke Kinder als Helfer mit ein. Heute ist es Kristina, die im Schreiben weiter ist.
Nach der Pause geht die Klasse zur Mathematik über. Die Kinder addieren im Zwanzigerraum. Rahand hat den Schwierigkeitsgrad auf eigene Faust erhöht: Er multipliziert. Sein Bruder habe ihm das beigebracht. «Zahlen sind super», sagt er, «ich rechne sogar im Auto.» Während das Rechnen flott läuft, macht es dem Buben sichtlich Mühe, die Zahlen aufs Blatt zu bringen.
Für den Schulbetrieb sind verhaltensauffällige Kinder oft am anspruchsvollsten.
Heilpädagogin Dorothee Miyoshi
«Streng», klagt er und schielt zu Joëlle Toscan, die neben ihm sitzt: «Komm, Rahand, eine noch.» Die Klassenassistentin begleitet Rahand während zehn Lektionen pro Woche. Im Sport hilft sie ihm beim Umziehen oder bei Übungen, für die ihm Kraft und Gleichgewicht fehlen. Stifte bereitlegen, die Arbeitsmappe hervorholen, Seiten umblättern – auch das geht bei Rahand länger, und nicht immer hat er Geduld mit sich.
«Ich darf ihm nicht zu viel abnehmen», sagt Toscan augenzwinkernd, «sonst wird er bequem.» Rahand grinst. Phasenweise muss er starke Medikamente einnehmen, dann endet seine Aufnahmefähigkeit oft vor Schulschluss. In solchen Momenten hilft es, mit Frau Toscan draussen eine Runde zu drehen. «Gleichzeitig arbeiten wir daran, das Durchhalten zu üben», sagt die Klassenassistentin, «und die Einsicht, dass manche Regeln für alle gelten.»




Eine Zeit lang sorgte es für Unmut, dass Rahand so viel Aufmerksamkeit bekommt. Manche seiner Klassenkameraden fanden das unfair, und mitunter goss Rahand Öl ins Feuer, indem er mit Schimpfworten konterte, wenn ein anderes Kind ihn beim Umziehen versehentlich anstiess. «Die ersten Wochen waren konfliktreich», sagt Heilpädagogin Albrecht. Aufklärung half: Im Buch «Eugen und der freche Wicht» erfahren Kinder, wie das Gehirn Sprache, Sinne und Bewegungen steuert – und was passieren kann, wenn es irgendwo klemmt.
«Den Kindern half das, die Bedürfnisse von Rahand besser einzuordnen», sagt Albrecht. «Wir thematisierten ihn nicht als Spezialfall, sondern überlegten gemeinsam, inwiefern wir alle Eigenschaften haben, die bedingen, dass wir spezielle Unterstützung brauchen – zum Beispiel in Form einer Brille.»
Wo Integration an Grenzen stösst
Klassenassistentin Toscan, gelernte Pharmaassistentin und Mutter zweier Kinder, war vor 16 Jahren eine der ersten Hilfskräfte, die in Zürich Lehrpersonen bei der Integration von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf unterstützten. Seither hat sie viele Kinder begleitet: Schülerinnen und Schüler mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen, mit Autismus-Spektrum-Störungen oder Lernbehinderungen. Wo sieht Toscan die Grenze dessen, was Integration leisten kann?
«Schwierig wird es, wenn die Distanz zum Regelschulkind langfristig zu gross ist», sagt sie. «Etwa im Kognitiven: Wenn wir mit dem integrierten Kind hauptsächlich separat arbeiten, weil es dem, was die Klasse macht, auch mit angepasstem Material nicht folgen kann. Bei Kindern mit geistiger Beeinträchtigung habe ich oft erlebt, dass die Anforderungen ab der Mittelstufe zu hoch, Gelegenheiten für Teilhabe an Gruppenthemen immer kleiner wurden. Dann stellt sich die Frage, ob noch von Integration die Rede sein kann.»
Viele Kinder sind nicht in der Lage, sich an Regeln zu halten, Wut und Frust zu zügeln und sich auch mal zurückzustellen.
Wie viel Integration verträgt die Schule? Es kommt darauf an, um wen es geht – dieses Fazit legt ein Beitrag des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH zum Thema nahe: «In der Diskussion um die Weiterentwicklung der integrativen Schule sollte vorgängig immer geklärt werden, um welche zu integrierende ‹Klientel› es sich handelt. Dies wird oft vergessen, und dann werden Äpfel mit Birnen verwechselt», schreibt Dorothee Miyoshi, Geschäftsleitungsmitglied des LCH.
«Lernende mit Schwierigkeiten im Lern- und Verhaltensbereich stellen nicht dieselben Anforderungen an die Schule wie Lernende mit einer Behinderung. Grundsätzlich ist es für den Schulbetrieb oft am anspruchsvollsten, mit Lernenden mit Verhaltensauffälligkeiten adäquat umzugehen. Diese können das System an seine Grenzen bringen.»
Wie das aussieht, wissen Lehrerin Traber und Heilpädagogin Albrecht aus Erfahrung – mit Kindern, die sich verweigern, sich auf den Boden werfen, einen nachäffen, herumschreien, davonrennen, das Klassenpensum der Heilpädagogin für sich beanspruchen, die sie ausserhalb «hütet», damit im Klassenzimmer Unterricht stattfinden kann.
«Sicher», sagt Traber, «das sind Extremsituationen. Aber auch im Alltag nimmt schwieriges Verhalten viel Raum ein.» Viele Kinder seien nicht in der Lage, sich an Regeln zu halten, Wut und Frust zu zügeln, wenn sie auf Widerstand stossen, und hätten Mühe, sich auch mal zurückzustellen oder länger als fünf Minuten bei der Sache zu bleiben.
Wo die einen so viel Aufmerksamkeit einfordern, kommen andere zu kurz, daraus machen die Pädagoginnen keinen Hehl: Hintanstehen müssten die motivierten, aber leistungsschwächeren Kinder, die ihre Bedürfnisse auch mal zurückstellen können.
«Es sind nicht Kinder mit Sonderschulstatus, die uns am stärksten fordern, sondern die Verhaltensauffälligen», fasst es Primarlehrerin Aléxia Jaggi aus Opfikon zusammen. «Und dass Verhaltensprobleme zu einem Sonderschulstatus führten, der den Weg zu mehr Ressourcen ebnet, habe ich nie erlebt.»

Die Grundlagen dafür wären gegeben: Der Kanton Zürich etwa unterscheidet drei Indikationsbereiche für einen Sonderschulstatus, wobei Typus A Kinder «mit besonderen Strukturbedürfnissen» betrifft, zu denen unter anderem eine «Verhaltensbehinderung» Anlass geben kann.
«Der Sonderschulstatus vom Typus A kommt in unserem Schulkreis bisher nicht zur Anwendung – zumindest nicht in der integrativen Sonderschulung», sagt Rafael Summerauer, Schulleiter an Rahands Schule. Das sei nachvollziehbar, wenn man das Einzugsgebiet der Schule, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen im Blick habe, sagt Co-Schulleiter Pirmin Pelican: «Da droht ein Fass ohne Boden.»
Nicht mehr Kranke, aber immer mehr Diagnosen
Pelican spricht eine Herausforderung im Hinblick auf Verhaltensstörungen an: Es gibt nicht mehr Kranke, aber immer mehr Diagnosen. Das wird sichtbar am Beispiel Autismus: «Als ich studierte, betraf die Diagnose eine von 1000 Personen – nun ist es eine von 80 bis 100 Personen», sagt der Basler Jugendpsychiater Alain Di Gallo. Heute spreche man von Autismus-Spektrum-Störungen und berücksichtige damit die ganze Bandbreite der Entwicklungsstörung – auch milde Formen.
432 Kinder besuchen die Tagesschule Schauenberg, zehn haben einen Sonderschulstatus. In weiten Teilen des Einzugsgebiets in Zürich Nord erfüllen acht von zehn Familien zwei oder mehr Risikofaktoren für soziale Belastung: Sie leben von Sozialhilfe oder tiefem Einkommen, sind Einelternfamilien, haben beengte Wohnverhältnisse oder keine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung. «Als Brennpunktschule haben wir zusätzliche Ressourcen», sagt Schulleiter Pelican, «es gilt sie effizient einzusetzen.»
Die Schulleitung geht bei der Ressourcenverteilung so vor, dass sie das ganze Kontingent für niederschwellige integrative Förderung und Deutsch als Zweitsprache zusammennimmt und daraus ein Fördersetting macht, das sich am Unterstützungsbedarf der Klasse orientiert.
«So kommen wir auf der Kindergarten- und Unterstufe auf mindestens acht und in der Mittelstufe auf mindestens sechs wöchentliche Förderlektionen pro Klasse», sagt Pelican. «Dabei legen wir je nach Gruppenzusammensetzung einen stärkeren Fokus auf integrative Förderung oder Deutsch als Zweitsprache.»
In weiten Teilen von Zürich Nord erfüllen acht von zehn Familien zwei oder mehr Risikofaktoren für soziale Belastung.
Von der Kreisschulbehörde fühlen sich die Schulleiter gut unterstützt: «Man tut viel, um den Bedürfnissen vor Ort gerecht zu werden», sagt Summerauer. In den Startlöchern stehe etwa ein Projekt, das Lehrpersonen im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern gezielter unterstützen soll. Geplant seien unter anderem Coachings für systemsprengende Schüler. Dafür werde eine Coach-Stelle geschaffen, auf deren Expertise das pädagogische Personal zurückgreifen könne.
Zu einem sinnvollen Setting gehört auch Konstanz
Kinder besuchen die Schule Schauenberg in der Regel vom Kindergarten bis zum Ende der Primarschule. «Wir kennen die Kinder, die neu in die Unter- oder Mittelstufe kommen», sagt Schulleiter Summerauer, «das vereinfacht ein sinnvolles Setting bei der Klassenzuteilung. Zum Beispiel nehmen wir mehrere Kinder mit ähnlichen Bedürfnissen zusammen, um das Profil von Lehr- und Förderpersonen passend darauf abstimmen und die Klasse mit entsprechenden Ressourcen ausstatten zu können.»
Ein sinnvolles Setting bedeute auch Konstanz: nicht zu viele Lehr- und Förderpersonen pro Klasse und nach Möglichkeit eine Heilpädagogin, die Team-Teaching-Lektionen übernimmt und als Ergänzung zur Klassenlehrperson auftritt. «Das wäre der Idealfall», sagt Summerauer, «der lässt sich nicht immer umsetzen. Teilweise haben Lehr- und Förderpersonen wenig verhandelbare Forderungen, was ihre Einsatztage betrifft.»

Brauche eine Lehrperson unverhofft mehr Unterstützung, etwa aufgrund einer schwierigen Klassendynamik, könnten Ressourcen aufgestockt werden, sagt Pelican: «Wir können ihr eine Klassenassistenz zur Seite stellen oder auf den Gestaltungspool zurückgreifen, also Lektionen in der Reserve aktivieren.»
Die Crux mit dem Gestaltungspool: Hier macht sich der Mangel an pädagogischem Personal bemerkbar. «Oft findet sich niemand, der den Zusatzbedarf abdecken kann», sagt Pelican. «Und im laufenden Schuljahr neue Leute zu finden, ist schwierig.» Dies erschwere es oft, auf Unterstützungsbedarf flexibel reagieren zu können.
Der Kindergarten wird zum Brennpunkt
Dringend nötig wäre dies im Kindergarten, sagt Summerauer: «Auf dieser Stufe stehen Lehrpersonen Herausforderungen gegenüber, die für eine Einzelperson oft nicht zu bewältigen sind.» So zeigten immer mehr Kinder Anzeichen erzieherischer Defizite oder einer Entwicklungsverzögerung.
Bereits 2015 befasste sich im Kanton Zürich eine Arbeitsgruppe des Volksschulamtes mit Verhaltensauffälligkeiten im Kindergarten. Ihr Bericht hält fest, womit Kindergartenlehrpersonen konfrontiert sind: Die aufgezählten Beispiele handeln von Kindergärtlern, die auf dem Stand eines Kleinkinds sind, verbal und körperlich aggressiv, die sich auf den Boden werfen oder die Toilette nicht selbständig benutzen können, die bis zu zwei Stunden am Stück schreien und sich nicht sicher bewegen können, die alles verweigern, sich einkoten oder während Monaten kein Wort sprechen.
Immer mehr Kindergärtler zeigen Anzeichen einer Entwicklungsverzögerung oder erzieherischer Defizite.
Als mögliche Ursachen nennt der Bericht insbesondere Faktoren des Elternhauses wie «Verwahrlosung und Überbehütung, Reizarmut oder -überflutung (auch Medienkonsum) und schwierige Familienverhältnisse».
Diesen Entwicklungsrückstand, ist Summerauer überzeugt, kann die Schule allein nicht auffangen. Es brauche ausserdem eine Diskussion über die Rolle des Kindergartens. «Soll seine Funktion weiterhin darin bestehen, Kinder auf die erste Klasse vorzubereiten, dann braucht es eine Vorstufe, die Mädchen und Buben ermöglicht, dem Vorschulalter entsprechende Entwicklungsschritte zu machen», sagt er. «Wir sehen, was passiert, wenn solche Versäumnisse auf den Kindergarten abgewälzt werden: Es kommen Kinder in die Schule, die dafür nicht bereit sind.»
Was bedeutet ein besonderer Bildungsbedarf genau und was versteht man unter integrativer Förderung? Wir haben für Sie ein Glossar mit den wichtigsten Begriffen der sonderpädagogischen Massnahmen der Volksschule zusammengestellt. Mehr dazu erfahren Sie hier.