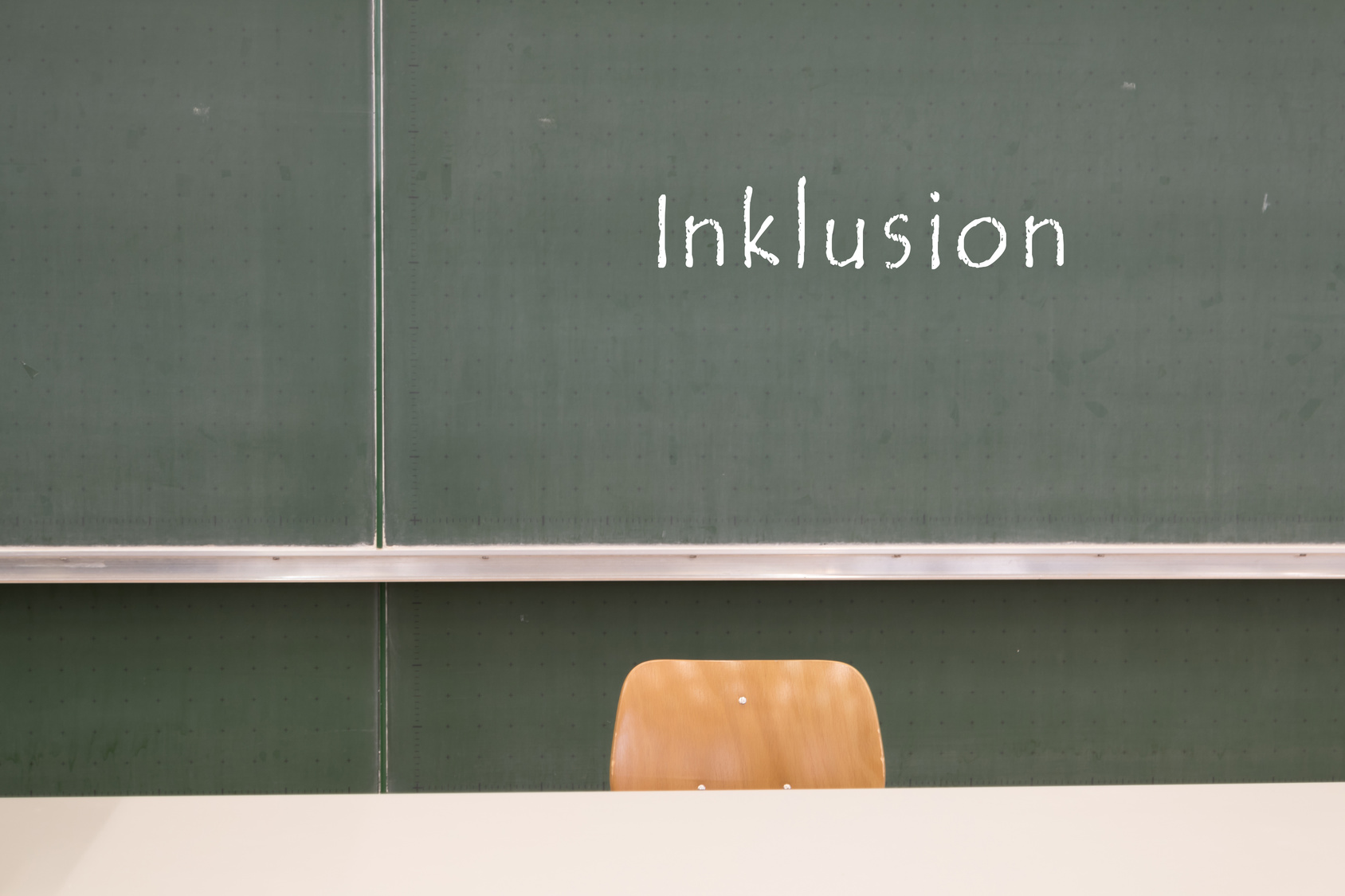Wie Inklusion gelingt

Jedes Kind mit einer Behinderung oder Lernstörung hat in der Schweiz grundsätzlich Anspruch auf Unterricht in einer Regelschule. Auch die 13-jährige Sophie. Wie gelingt Inklusion? Und warum profitieren alle vom gemeinsamen Unterricht?
Wenn Sophie in die Schule kommt, kümmern sich gleich mehrere Betreuungspersonen um sie. Da ist natürlich die Lehrperson, der sie Fragen stellen kann. Zusätzlich sitzt aber meist auch ein Heilpädagoge oder eine Heilpädagogin neben Sophie. Er oder sie erinnert sie daran, bei der Sache zu bleiben, oder erklärt ihr Sachen noch einmal, die sie nicht verstanden hat (siehe in der Reportage «Ich will dranbleiben»).
Diese spezielle Betreuung steht Sophie zu. Sie hat einen ausgewiesenen «besonderen Bildungsbedarf». Weil Sophie ein Downsyndrom hat, fällt es ihr schwerer als den meisten anderen Schülerinnen und Schülern, Inhalte zu verstehen und sich über längere Zeit zu konzentrieren.
In integrativen Schulklassen werden Schüler mit bestimmten «funktionellen Störungen» gemeinsam mit normalbegabten Regelschülern unterrichtet. Das sind beispielsweise Kinder mit einer Behinderung, mit einer Lernschwäche, einem niedrigen IQ, mit Autismus, ADHS oder einer Verhaltensstörung. Bis vor einigen Jahren wurden diese Schüler in der Schweiz vor allem in Sonderschulen oder in speziellen Kleinklassen in der Regelschule unterrichtet.
In integrativen Schulklassen werden Schüler mit bestimmten «funktionellen Störungen» gemeinsam mit normalbegabten Regelschülern unterrichtet. Das sind beispielsweise Kinder mit einer Behinderung, mit einer Lernschwäche, einem niedrigen IQ, mit Autismus, ADHS oder einer Verhaltensstörung. Bis vor einigen Jahren wurden diese Schüler in der Schweiz vor allem in Sonderschulen oder in speziellen Kleinklassen in der Regelschule unterrichtet.
Gemeinsam Lernen mit unterschiedlichen Lernzielen
Während Sonderschulen weiterbestehen, sind die Kleinklassen inzwischen in fast allen Kantonen abgeschafft worden. Das ist ein Schritt weg vom separierten hin zu einem integrierten Schulmodell. Ein Grund dafür sind die rechtlichen Bestimmungen in der Schweiz. Zwar können Eltern noch keinen Platz in einer Regelschule einklagen, aber mehrere Gesetzestexte belegen, dass der Integration, wann immer möglich, Vorrang zu geben ist. Seit 2004 sind die Kantone durch das Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet, die Integration von Schülern mit «besonderem Bildungsbedarf» zu fördern.



Auch die Volksschulgesetze der Kantone, die jeweils vom Stimmvolk verabschiedet wurden, sehen Integration vor. Im vergangenen Mai ratifizierte die Schweiz als 144. von 193 UNO-Staaten die Behindertenrechtskonvention. Diese besagt, dass Behinderte einen gleichberechtigten Zugang zu einem inklusiven hochwertigen Schulsystem haben müssen. Das Lernen soll gemeinsam erfolgen, wenn auch zum Teil mit unterschiedlichen Lernzielen.
Wie gut die UN-Konvention bisher umgesetzt wurde, soll dieses Jahr untersucht werden. «Die Beweislast hat sich umgekehrt», fasst Professor Peter Lienhard von der Interkantonalen Hochschule fur Heilpädagogik Zürich die Lage in der Schweiz zusammen. «Haben früher die Eltern nachweisen müssen, dass ihr Kind für den Unterricht in einer Regelschule in Frage kommt, so muss heute die Schule nachweisen, dass dies nicht möglich ist.»
Die Vielfalt als Stärke
Hinter der UN-Konvention steht die Ideologie der Inklusion: Demnach sollen nicht mehr die Kinder dahingehend geprüft werden, ob sie für das normierte Schulsystem geeignet sind, sondern es sind die Schulen, die sich auf die Vielfalt der Kinder einstellen müssen.
Inklusion sieht alle Schüler als Wesen mit eigenen Lernbedürfnissen und Stärken an. Der Schüler mit Einschränkung sticht nicht mehr heraus, er hat lediglich ein anderes Stärkenprofil. Inklusion geht damit einen ganzen Schritt weiter als Integration. Bei der Integration ist noch klar festgelegt – meist durch die Diagnose einer Funktionsstörung –, wer die Norm ist und wer der zu Integrierende. Für die Inklusion ist also ein anderes Denken nötig, das Vielfalt als Stärke, nicht als Problem ansieht.
Inklusion heisst: Nicht das Kind muss sich der Schule anpassen, sondern die Schule den Bedürfnissen der Kinder.
Nur ändert sich ein Schulsystem, ja eine ganze Gesellschaft nicht von heute auf morgen. Daher wird in der Schweizer Schulpraxis heutzutage hauptsächlich die Integration geübt – sozusagen als Vorstufe für die Inklusion. Das heisst, Kinder mit einer bestimmten Diagnose vom schulpsychologischen Dienst erhalten Massnahmen, die ihren Nachteil ausgleichen sollen.
Zum Beispiel technische Hilfsmittel, Förderstunden, leichtere Aufgabenstellungen, die Möglichkeit, eine Prüfung mündlich abzulegen, oder eben die Unterstützung durch einen Heil- oder Sonderpädagogen. In den meisten Kantonen haben alle Klassen Anspruch auf einen Grundstock an heilpädagogischer Betreuung – und dieser wird grösser, je mehr Integrationskinder die jeweilige Klasse besuchen.
Integration in der Schule heisst: Weg vom Stigma Kleinklasse
Inzwischen gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, dass die Lernfortschritte bei den lern- und leistungsschwachen Kindern in integrativen Klassen grösser sind als in separativen Settings. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum es heute in den meisten Kantonen keine Kleinklassen mehr gibt. Es hat auch mit dem mit ihnen verbundenen Stigma zu tun.
Urs Haeberlin, ehemaliger Direktor des Heilpädagogischen Instituts der Universität Freiburg und Leiter vieler Integrations-Forschungsprojekte, hat beobachtet, dass in den Kleinklassen seit 1990 immer weniger Schweizer Kinder geschult wurden. Sie wurden vielerorts zum Auffangbecken für Kinder aus bildungsfernen Migrantenhaushalten sowie Schüler mit Verhaltensproblemen und Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen. Daraus entstanden auch die Probleme, mit denen viele Kinder nach dem Schulabschluss zu kämpfen hatten.
Eine Schweizer Längsschnittstudie aus dem Jahr 2011 zeigte: Viele schwache Schüler besuchen nach dem Schulabschluss Brückenangebote. Im zweiten und im dritten Jahr nach dem Abschluss finden allerdings viel mehr schwache Schüler aus integrativen Regelklassen einen Zugang zu einer Ausbildung. Die Schüler aus den Kleinklassen bleiben hingegen häufiger auf der Strecke – ihr Ruf in den Ausbildungsbetrieben ist schlecht.
Immer mehr Sonderschüler?
Was aber passiert mit schwierigen Schülern ohne Diagnose? Wohin kommen sie, wenn Kleinklassen aufgelöst werden? Die Medien berichteten vergangenen Herbst von einer «explosionsartigen Steigerung der Zahl von Sonderschülern» – es seien so viele wie nie zuvor. Die Vermutung wurde aufgestellt, dass einfach besonders viel diagnostiziert werde, damit Schulen mehr Mittel und Personal erhalten würden.
Beat Zemp, Präsident des Dachverbands der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), relativierte in einem Interview mit dem Internetportal «Watson», die Zahlen liessen sich nicht ohne Weiteres vergleichen: «Dadurch, dass diese Kleinklassen abgeschafft worden sind und die meisten der betroffenen Schüler in die Regelklassen integriert wurden, steigt in der Statistik automatisch die Zahl der sogenannten integrierten Sonderschüler.»
Ausserdem gebe es erst seit 2014 ein standardisiertes und kantonsübergreifendes Abklärungsverfahren des Schweizerischen Erziehungsdepartements. Darin werden Kriterien festgelegt, die zeigen, wer ein Sonderschüler ist und welche Massnahmen sinnvoll sind.
Prinzipiell gelte heute aber das «Bildungsprinzip», nicht mehr das «Versicherungsprinzip», das noch vor dem Rückzug der IV aus der Finanzierung der Sonderschulpädagogik gegolten habe, so Peter Lienhard.



Inklusion ist ein Angstthema bei Eltern
Das bedeutet: «Es wird geschaut, was das Kind braucht, damit es sein Bildungsziel erreichen kann. Nicht mehr so sehr, welche Störung es hat.» Und da kommen wieder die leistungsschwachen Kinder ohne klar diagnostizierte Behinderung ins Spiel. Auch einige von ihnen brauchen Hilfe, um ihr Potenzial entfalten zu können.
Ein Beispiel aus der Praxis: In der 4i der Sekundarschule Leonhard in Basel haben die Heilpädagogen im Schulalltag auch ein Auge auf die schwachen oder verhaltensauffälligen Schüler, die kein medizinisches oder psychologisches Zeugnis mitbringen. Zum Beispiel auf ein Mädchen aus Japan, das erst vor wenigen Wochen in die Schweiz gezogen ist.
Es scheint normal begabt zu sein, spricht aber nur Englisch. Oder auf ein Mädchen mit Migrationshintergrund, das sehr unsicher ist und sich nicht traut, Fehler zu machen. Auch ihnen wenden sich die Heilpädagogen zu und verfassen zusammen mit ihnen persönliche Lernziele und Förderpläne.
Das Mädchen aus Japan erhält zudem Förderstunden in «Deutsch als Zweitsprache». Dass die Heilpädagogen nicht nur für die Schüler mit Integrationsstatus wie Sophie da sind, sondern auch für diese Fälle Zeit haben, liegt laut Peter Lienhard daran, dass die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Sek Leonhard die Klassen und Fächer intelligent zusammenführen und damit auch ihre eigenen Ressourcen bündeln.
«Das ist sehr clever – genau so muss man es eigentlich machen, damit Integration funktioniert», so Lienhard. Denn eines ist klar: Integration fordert nicht nur von den Heilpädagogen, sondern auch von den Lehrpersonen und Eltern viel.
«Bei vielen herrscht Unsicherheit – die Inklusion ist ein Angstthema», sagt Bettina Ledergerber, Kommunikationsverantwortliche von Pro Infirmis. Die Fachorganisation berät vor allem Eltern von Kindern mit Behinderung, aber auch Lehrpersonen und Behörden. Sie übernimmt eine Übersetzerrolle für das Fachchinesisch und hilft beim Einfordern von Ansprüchen. Ledergerber bezeichnet das Schweizer Schulsystem als «im Umbruch».
Lern- und leistungsschwache Kinder machen in Regelklassen grössere Fortschritte.
Die Vision der Inklusion, die Vielfalt der Menschen als Stärke zu sehen, sei ein hoher Anspruch. Und die Umsetzung sei zudem der ständigen Beobachtung der Medien ausgeliefert. Fehlende Ausbildung, knappe Mittel Und die Medien finden immer wieder Lehrpersonen, die darüber klagen, dass ein normaler Unterricht mit so unterschiedlichen Schülern kaum möglich sei. Vielen Lehrern fehlt die entsprechende Ausbildung im Umgang mit Integrationsschülern.
Erst seit einigen Jahren gehören Module für Integration und Sonderpädagogik zur Lehrerausbildung an den Pädagogischen Hochschulen. Gerade ältere Lehrkräfte aber müssen nachschulen – wenn denn Geld und Zeit dafür da sind. Als der «Tages-Anzeiger» vergangenen Herbst überforderte Lehrer in einem Artikel zu Wort kommen liess, verneinten dann auch 73,6 Prozent der Online-Leser die Frage: «Gehören Sonderschüler in die Regelklasse?».
Schulen haben zum Teil zu wenig Ressourcen
Es sind besonders die Eltern der normalbegabten Regelschüler, die befürchten, dass Kinder in der Entwicklung gebremst werden, wenn schwache Schüler und Sonderschüler in derselben Klasse unterrichtet werden. Urs Strasser zeigt in der «Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik» die Wirkung von integrativen Settings auf Regelschüler auf: Sie entwickelten bessere soziale Kompetenzen, würden nicht gebremst und machten sogar, entgegen den Befürchtungen, besonders grosse Fortschritte.
In Deutschland hat die Bertelsmann-Stiftung im Jahr 2015 Eltern befragt und zeigte auf: Sie geben inklusiven Schulen durch die Bank weg gute Noten (siehe Box). Auch Heilpädagoge Martin Gürtlervon der Sek Leonhard ist überzeugt, dass gerade die stärkeren Kinder vom integrativen System profitieren,weil sie zum einen die Vielfalt der Gesellschaft wirklich erfahren würden, zum anderen aber auch eineintensivere Betreuung genössen.
- www.proinfirmis.ch: Fachorganisation für behinderte Menschen mit Beratungsangebot
- peterlienhard.ch/blog: Blog des Professors der Hochschule für Heilpädagogik mit vielen informativen Texten und Videopräsentationen
- www.hfh.ch
- www.integrationundschule.ch
- www.myhandicap.ch
Wenn Integration beziehungsweise das Fernziel Inklusion also Vorteile für alle bringt – warum stossen sie dann so oft auf Widerstand? «Die Schulen haben zum Teil zu wenig Ressourcen, die Politiker haben oft Panik vor dieser komplexen Thematik, und für die Eltern ist der Schulerfolg ihres Kindes so zentral, dass sie sich nicht auf Experimente einlassen wollen», fasst Lienhard zusammen.
Integration um jeden Preis?
Trotzdem sei eine Integration beziehungsweise Inklusion «nicht nur nicht mehrheitsfähig, sondern auch nicht immer sinnvoll», betont Lienhard. Wichtig ist, den Einzelfall zu prüfen. Das stark autistische Kind zum Beispiel, welches in grossen Gruppen in Panik gerät, ist in einer Sonderschule mit kleinen Gruppen, 1-zu-1-Betreuung und Psychiatern wohl besser aufgehoben als in einer Regelschule.
Und es gibt Schülerinnen und Schüler, deren Verhaltensstörung den Unterricht für alle anderen unmöglich macht. Auch kann es vorkommen, dass Schüler mit einer starken Hör- oder Sehbehinderung in der Regelschule Strategien entwickeln, damit niemand merkt, dass sie nichts verstehen. Aber: «Es hängt nicht nur vom Kind ab, ob Integration gelingt», betont Lienhard. Er werde oft gefragt, bei welchen Behinderungen Integration sinnvoll sei, und antworte dann mit einem Mindmap.
Dieses zeigt: Der Schüler ist nur ein Puzzleteil. Damit Integration und Inklusion an Schulen gelingen, müssen Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung und -behörde zusammenspielen, Räume und Hilfsmittel müssen gegeben sein und Beratung und Ausbildung von aussen hinzukommen. «Wenn zum Beispiel die Eltern aller anderen Schüler dagegen sind, dass ein Kind mit Behinderung in die Klasse kommt, wird es dieses Kind sehr schwer haben», sagt Lienhard.
Sprachunterricht, individuelle Förderpläne, grössere Schrift – die Hilfsmittel sind vielfältig.
Inklusion bedeutet nicht zwangsläufig, dass alles gemeinsam gemacht und mit denselben Massstäben gemessen wird. So bekommen die Sonderschüler in integrativen Settings nur dann Noten, wenn ihre Leistung wirklich mit der der Regelschüler vergleichbar ist. Im Zeugnisbericht stehen dann ihre individuellen Lernziele – zum Beispiel «Addieren im Zehnerraum» – und eine Beschreibung, wie gut diese erreicht wurden.
Es ist auch nirgends festgelegt, dass die Schüler stets in einem Raum unterrichtet werden müssen. Wenn zum Beispiel Sophie und die anderen Kinder mit Integrationsstatus der 4i an der Sek Leonhard ein Referat vorbereiten sollen, gehen die Heilpädagogen mit ihnen in den Heilpädagogikraum. Hier dürfen sie auch mal laut werden, hier kann die Aufgabe wieder und wieder erklärt werden, ohne dass man die anderen Schüler stört. Das Ergebnis wird dann wieder vor der ganzen Klasse vorgetragen.
Ausserdem lässt der Stundenplan der 4i genug Raum für den persönlichen Wochenplan der Schülerinnen und Schüler – und da kann es passieren, dass eine Schülerin am Rechenschieber 5 und 7 zusammenzählt, während ihre Mitschülerin am Nebentisch die Entfernung von zwei Städten anhand einer Landkarte berechnet.
Für Christian Liesen, Professor an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik, geht es bei Inklusion darum, «sich vorzustellen, wie Bildungs- und Erziehungsziele erreicht werden können, ohne seine Vorstellungskraft einzuschränken». Entscheidend sei die Erkenntnis, so Liesen, «dass stets mehrere vernünftige Wege ins Ziel führen».
Redaktionelle Mitarbeit: Martina Proprenter

Möchten Sie sich diesen Artikel zum Thema Integration an Schulen merken? Dann pinnen Sie dieses Bild auf Ihre Pinterest-Pinnwand. Wir freuen uns, wenn Sie und auch bei Pinterest folgen.