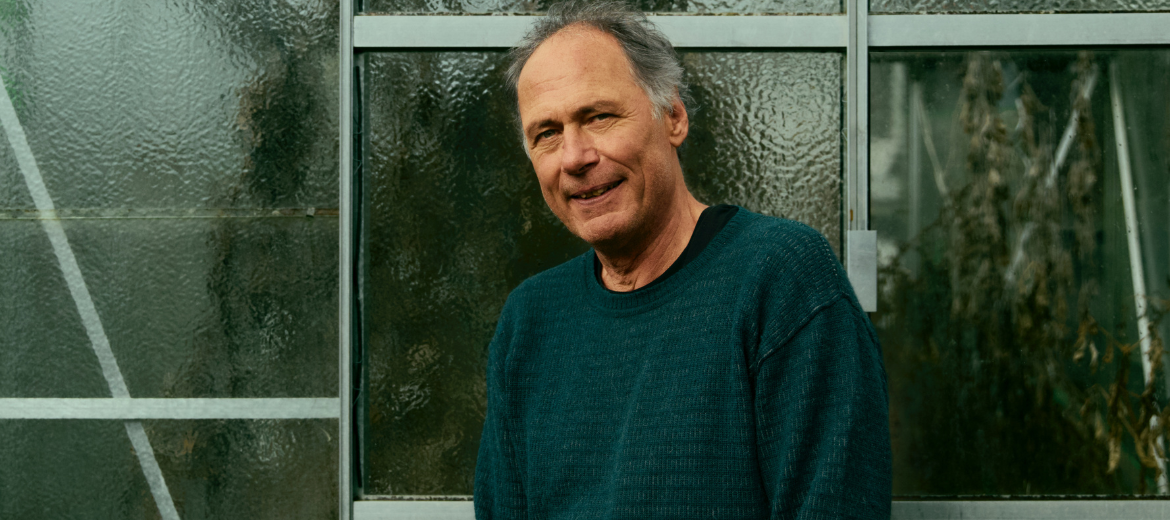«Strafaufgaben haben keinen positiven Effekt»

Die Kinder- und Jugendspychologin Irina Kammerer erklärt, was Kindern besser hilft als Fleisskärtchen und Strafaufgaben an Schulen.
Frau Kammerer, lange Zeit ging man davon aus, dass Kinder in der Schule zu Disziplin und Gehorsam erzogen werden müssten, notfalls auch mit körperlicher Züchtigung. Das ist zum Glück passé. Welche Rolle spielen Belohnungen und Bestrafungen heute im schulischen Kontext?
Bestrafungen sind nach wie vor allgegenwärtig, wenn auch in anderer Form als noch vor 100 oder 50 Jahren. Bis in die 1980er-Jahre galten Körperstrafen als entschuldbar, das war in der Volksschulverordnung extra so festgehalten. Inzwischen sind Züchtigungen ausdrücklich untersagt. Das ist wichtig, weil diese Strafen das Selbstwertgefühl eines Kindes extrem schädigen. Leider ist es aber immer noch alltäglich, dass Schüler harsch vor der Klasse angegangen werden. Wenn Kinder regelmässig verbal erniedrigt oder lächerlich gemacht werden, ist das fatal für die Entwicklung. Die Abwertungen, die durch diese Strafen passieren, schaden ausserdem der Lehrer-Schüler-Beziehung.
Es bringt einem Kind überhaupt nichts, wenn es hundert Mal schreiben muss: ‹Ich darf den Unterricht nicht stören.›
Wo verläuft die Grenze zwischen sinnvoller Kritik und verletzendem Tadel?
Wenn ich als Erwachsene deutlich zeige, dass ich das Kind als Person wertschätze, verletze ich seine Integrität nicht, wenn ich es auf einen Fehler aufmerksam mache. Ich kann sagen: «Dein Lösungsweg ist falsch.» Ich darf aber nicht so etwas äussern wie «Wenn du besser aufpassen würdest, stündest du jetzt nicht so dumm da» oder «Wie kann man nur so begriffsstutzig sein?».
Erreicht eine Lehrperson durch Strenge und Strafen vielleicht die Ruhe, die sie im Klassenzimmer braucht?
Aus der Forschung wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Wenn eine Lehrperson ein Kind oder einen Jugendlichen abmahnt, also zum Beispiel Strafaufgaben aufgibt oder einen Störenfried vor die Tür setzt, haben diese Strafen langfristig gesehen überhaupt keinen positiven Effekt. Möglicherweise gibt es eine kurze Ruhephase, solange das Kind nicht im Klassenzimmer ist. Auch das ist aber nicht garantiert, viele Kinder wüten vor der Tür weiter. Häufig kommt es zu einem beziehungsschädigenden Pingpong-Effekt, weil das Verhalten der Lehrperson beim Kind neue Aggressionen auslöst.

Was sollen Lehrer denn machen, wenn Kinder sich nicht an Regeln halten und den Unterricht gezielt stören? Das erfordert doch eine disziplinarische Reaktion.
Vom amerikanischen Kinderpsychologen Ross Greene stammt das Zitat: «Kids do well, if they can.» Wenn Kinder über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, machen sie es gut. Ich finde diese Annahme hilfreich für die eigene Herangehensweise. Sie hält uns Erwachsene dazu an, zunächst einmal zu überlegen, welche Kompetenz einem Kind vielleicht fehlt, um sich angemessen zu verhalten.
Wie meinen Sie das?
Es gibt zum Beispiel Kinder, die in einem sozial schwierigen Elternhaus aufwachsen und ihre Eltern nicht als verlässliche Fürsorgepersonen erleben. Die übertragen ihre unsicheren Bindungsmuster auf den schulischen Kontext und erwarten, dass sich die Lehrer ihnen gegenüber genauso destruktiv verhalten, wie sie es kennen. Wenn ich auf deren Provokationen mit harten Strafen reagiere, bestätige ich sie und es ändert sich nichts. Es wäre viel hilfreicher, sich zu überlegen, wie man mit so einem Kind ein Bündnis aufbauen und ihm helfen kann, fehlende Kompetenzen zu erwerben.
Das klingt nach einer zeitintensiven Aufgabe.
In der akuten Situation verlangt das von den Lehrern ausserplanmässigen pädagogischen Einsatz, das ist richtig. Und es verlangt darüber hinaus, dass die Erwachsenen ihre eigenen Stressgefühle gut managen können. Lehrer und Erzieher stehen auch unter Druck, verlieren die Geduld und reagieren dann unverhältnismässig. Das kann uns allen mal passieren, es sollte aber nicht der Regelfall sein. Auch die Erwachsenen tun sich damit keinen Gefallen. Strafen haben keinen positiven Effekt auf die schulische Mitarbeit. Ein Klassenklima, in dem das Kontroll- und Strafbarometer immer am Anschlag sind, kostet letztendlich mehr Energie und Zeit als der Versuch, eine andere pädagogische Lösung zu finden.
Wie kann so eine pädagogische Massnahme aussehen?
Wenn wir beim Beispiel von zu grosser Unruhe im Klassenraum bleiben, kann man als Lehrer dieses Thema mit der Klasse besprechen und sagen: «Das ist mir zu unruhig. Wie können wir das anders lösen?» Man kann überlegen, ob man die Struktur des Unterrichts ändert und zum Beispiel kleine Unruhepausen einbaut. Man kann die Sitzordnung mit den Kindern besprechen und sie verändern. Man kann einem besonders unruhigen Kind erklären, warum man es in die Nähe des Lehrerpults setzt. Es bringt diesem Kind jedenfalls überhaupt nichts, wenn es hundert Mal schreiben muss: «Ich darf den Unterricht nicht stören.» Davon ist es einfach nur genervt – und das auch zu Recht.
Eltern sollten stets darauf achten, welche Art von Rückmeldung sie ihren Kindern geben.
Kann es helfen, das richtige Verhalten zu belohnen?
Anerkennung ist ein psychosoziales Grundbedürfnis von allen Menschen, von Kindern und Jugendlichen ganz besonders. Wenn ein jüngeres Kind einen Smiley unter seine Hausaufgaben bekommt, ist es stolz. Wenn ein Teenager gelobt wird, fühlt er sich wertgeschätzt. Es gibt aber inzwischen etliche kritische Stimmen zu Belohnungen und auch zu Lob. Beide können die Motivation verändern, warum ein Kind etwas tut oder lernt. Es geht dann nicht mehr um die Sache an sich, sondern nur noch um die Bestätigung von aussen. Bleibt die aus, schwindet auch das Interesse an etwas. Das kann Einfluss auf die Kreativität, die Disziplin und das Sozialverhalten haben. Eine Studie hat beispielsweise gezeigt, dass die Hilfsbereitschaft bei Kindern abnahm, nachdem sie dafür materiell belohnt wurden. Eltern sollten also stets darauf achten, welche Art von Rückmeldung sie ihren Kindern geben.
Welche Rückmeldung wäre denn sinnvoll? Wie soll man als Lehrerin denn Anerkennung zeigen?
Kinder wollen wahrgenommen werden. Wenn beispielsweise ein Kind mit einer Zeichnung oder einem Aufsatz zu mir kommt, kann ich über die Maltechnik oder seinen Schreibstil reden, die Idee dahinter besprechen und Fragen stellen. Diese Art positiver Rückmeldung bringt mehr als ein blosses «Gut gemacht». Wenn ich mich mit einem Kind wirklich auseinandersetze und mein Interesse zeige, kann ich vollkommene Wertschätzung und Anerkennung zeigen.