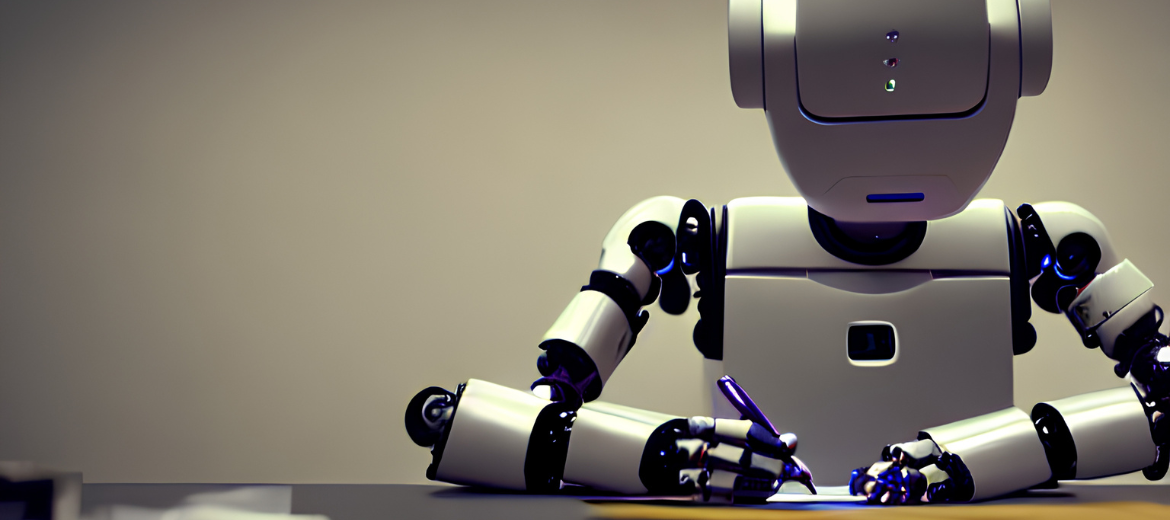Musik aus und stillsitzen? Lernmythen auf dem Prüfstand

Wie sieht «richtiges lernen» aus?
Dazu gibt es eine Menge Vorstellungen und Ratschläge, die seit Jahrzehnten weitergegeben werden. Lernt ein Kind oder Jugendlicher auf eine andere Art und Weise, wird er rasch dazu aufgefordert, sich beispielsweise «ordentlich hinzusetzen und nicht herumzuhampeln». Es wird ihm erklärt, dass man sich so «doch nicht konzentrieren kann» und er sich nicht wundern müsse, wenn am Ende nichts hängen bleibe.
Doch dürfen wir den gängigen Lernratgebern trauen, wenn sie einen festen Arbeitsplatz und Ruhe verordnen und betonen, dass das Kind die Hausaufgaben in einer ordentlichen Arbeitshaltung alleine in seinem Zimmer machen soll?
Mythos 1: Musik stört die Konzentration! Also schalte sie aus!
Dieser Ratschlag ist für viele Menschen hilfreich. Vor allem introvertierten Personen gelingt es besonders gut, sich zu fokussieren, wenn sie in Ruhe arbeiten können – das zeigt die Forschung eindrücklich.
Es gibt jedoch auch Menschen, die das Arbeiten bei Stille als Qual empfinden. Gerade bei leicht ablenkbaren Kindern wird oft empfohlen, dass die Lernumgebung möglichst reizarm sein soll. Neuere Studien deuten jedoch darauf hin, dass dies kontraproduktiv ist. Die Stille führt bei unaufmerksamen Kindern dazu, dass sie innerlich unruhig werden und unbewusst nach Ablenkung suchen. In Studien machten diese Kinder beim Lösen von Mathematikaufgaben weniger Fehler, wenn sie dazu Musik hören durften. Sie konnten sich bei einem Gedächtnistest auch an mehr erinnern, wenn während der Lernphase moderate Hintergrundgeräusche zu hören waren.
Neben der Konzentration kann auch die Motivation durch die passende Musik gefördert werden.
Viele Jugendliche berichten zu dem, dass sie die richtige Musik in die nötige Stimmung versetze, um auch unliebsamen Aufgaben zu Leibe zu rücken. Neben der Konzentration kann also auch die Motivation durch die passende Musik gefördert werden.
Wenn Ihr Kind mit Musik arbeiten möchte, empfehlen wir Folgendes: Erstellen Sie gemeinsam eine Playlist mit Liedern, die sich zum Lernen eignen (eher ruhige Stücke ohne Text). Das Drücken der Playtaste kann von diesem Moment an zum Startsignal werden und dem Kind helfen, anzufangen und in die Arbeit einzutauchen. Was jedoch stört, sind Geräusche, die zum Hinhören und Mitmachen einladen – beispielsweise der Ton eines spannenden Films, der im Hintergrund läuft , eine Radioansage oder Gespräche von anderen.
Zum Thema Musik gilt also: ausprobieren! Wir Menschen reagieren unterschiedlich darauf. Für den einen ist sie eine Lernhilfe, für den anderen eine Belastung und Ablenkung.
Mythos 2: Kinder benötigen einen fixen Arbeitsplatz – am besten in ihrem Zimmer!
Wenn der Schuleintritt bevorsteht, haben die Möbelhäuser einmal mehr Hochkonjunktur. Scharen an engagierten Müttern und Vätern pilgern mit dem Nachwuchs in die Büroabteilungen, um ergonomisch geformte Schreibtischstühle, höhenverstellbare Pulte und augenfreundliche Leselampen auf Herz und Nieren zu prüfen. Kurze Zeit später ist der optimale Arbeitsplatz im Kinderzimmer eingerichtet. So weit, so gut. Vieles spricht dafür, die Hausaufgaben stets im Kinderzimmer zu erledigen: das Kind kann sich zurückziehen, wird nicht von den Geschwistern bei der Arbeit unterbrochen und sollte nach und nach lernen, selbständig zu arbeiten.
Für einen fixen Arbeitsort scheinen auch Konditionierungseffekte zu sprechen: Wird immer am gleichen Ort gearbeitet, verbindet das Gehirn diesen Ort nach und nach mit dieser Tätigkeit. Das kann sehr nützlich sein: Sobald Sie sich ins Büro setzen und den Computer hochfahren, fühlen Sie sich in Arbeitsstimmung versetzt.
Zudem zeigen Studien aus der Gedächtnisforschung, dass man sich besser an Inhalte erinnert, wenn man diese mehrmals am gleichen Ort lernt und dort abruft . Zu diesem Thema wurden einige interessante Experimente durchgeführt. So konnten beispielsweise Taucher, die sich unter Wasser Listen mit Wörtern eingeprägt hatten, diese unter Wasser besser erinnern als an Land und umgekehrt. Diese Wirkung der Umgebung auf die Lern- und Abrufleistung wird als kontextabhängiges Erinnern bezeichnet.
Genau diese beiden Effekte können aber auch zur Falle werden. Der Mechanismus des kontextabhängigen Erinnerns spricht nicht unbedingt dafür, immer am gleichen Ort zu lernen. Prägt man sich den Stoff immer in derselben Umgebung ein, kann man sich dort zwar besser an das Gelernte erinnern – dafür wird es an allen anderen Orten schwieriger. Wenn man also nicht die Chance hat, genau dort zu lernen, wo auch geprüft wird, kann man sich stärker auf Wissen verlassen, das man an unterschiedlichen Orten gelernt hat.
Ein Ortswechsel kann dem Kind dabei helfen, neue, positivere Erfahrungen mit dem Lernen zu verknüpfen.
Ähnlich verhält es sich mit Konditionierungseffekten: Macht ein Kind regelmässig sehr positive Erfahrungen beim Lernen, hilft ihm ein fixer Arbeitsort, in seine Arbeitsstimmung zu kommen. Bei vielen Kindern, die das Lernen eher mit Frust und Mühsal verbinden, passiert genau das Gegenteil. Kaum sitzen sie auf ihrem Bürostuhl am Pult, kann man zusehen, wie sie innerlich abschalten und körperlich erschlafen. Das Gesicht schläft ein, der Blutdruck sinkt ab und sie beginnen zu gähnen.
In diesem Fall kann ein Ortswechsel einen Neustart mit sich bringen und dem Kind dabei helfen, neue, positivere Erfahrungen mit dem Lernen zu verknüpfen.
Konditionierungseffekte machen auch das eigene Zimmer für viele Kinder und Jugendliche zum ungünstigsten Lernort überhaupt. Denn was tut das Kind normalerweise in seinem Schlafzimmer? Spielen! Dieser Ort ist demnach mit Freizeitstimmung assoziiert. Kaum rollt Ihr Kind mit dem ergonomisch geformten Stuhl an den höhenverstellbaren Tisch, fallen ihm die spannenden Spielsachen ins Auge. Die Sehnsucht, aufzustehen und sich damit zu beschäftigen, wächst.
Nun benötigt das Kind eine grosse Portion Selbstdisziplin, um seine Aufmerksamkeit weiterhin auf die Aufgaben zu lenken. Es sagt sich vielleicht: «Eigentlich würdest du am liebsten am Raumschiff weiterbauen, aber du musst jetzt Hausaufgaben machen. Wo war ich nochmal? Ah ja, hier.» Solche inneren Konflikte lenken ab und sind zermürbend. Hierzu ein kleines Beispiel aus der Erwachsenenwelt: Es ist vielleicht etwas ungünstig, sich zum Kaffee in einer Konditorei zu verabreden, wenn man gerade auf Diät ist. Wie lange braucht es wohl, bis der Blick zu den Rahmtorten wandert und man der süssen Verführung nachgibt?
Welche Plätze würden sich für Ihr Kind eignen? Kann es auch einmal in der Küche oder im Wohnzimmer lernen? Die Vokabelliste auf die Terrasse, in die Badewanne oder in den Zug mitnehmen? Oder ist es schon älter und darf in der Schule oder in der Bibliothek arbeiten?
Mythos 3: Sitz jetzt still und konzentriere dich!
Manche Eltern werden ganz kribbelig, wenn sie ihren Kindern beim Lernen oder Arbeiten zusehen. Wer auf dem Stuhl herumturnt, den Radiergummi von einer Hand in die andere wandern lässt oder sich am Boden mit dem Lesebuch in seltsame Positionen verknotet, kann doch nicht wirklich konzentriert sein, oder? Bei dieser Annahme handelt es sich offenbar um einen Trugschluss. Forscher konnten nämlich nachweisen, dass Primarschüler sich bei Stillarbeiten mehr bewegen, sobald ihr Arbeitsgedächtnis beansprucht wird. Mussten Kinder sich beispielsweise eine Fülle von Zahlen und Buchstaben merken und diese am Ende in eine Reihenfolge bringen, also eine klassische Aufgabe für das Kurzzeitgedächtnis lösen, nahm ihre körperliche Unruhe zu.

Bewegung unterstützt das Gehirn offenbar dabei, Informationen im Kopf zu behalten. Vielleicht ist Ihnen auch schon einmal aufgefallen, wie man – ohne gross darüber nachzudenken – aufsteht und im Zimmer umhergeht, wenn man sich die Inhalte für eine Präsentation ein prägen möchte oder fieberhaft nach Lösungen für ein Problem sucht.
Schon im antiken Rom war der förderliche Effekt von Bewegung auf die Gedächtnisleistung bestens bekannt. So prägten sich Profiredner wie der bekannte Politiker Marcus Tullius Cicero ihre ellenlangen Manuskripte am liebsten im Gehen ein. Vielleicht darf Ihr Kind das nächste Mal durch den Garten streifen, wenn es ein Gedicht auswendig lernen muss, oder ein wenig Trampolin hüpfen, während Sie ihm Einmaleins-Rechnungen oder Vokabeln vorgeben?
Mythos 4: Lernen muss Spass machen!
Während die bisher beschriebenen Mythen bereits von unseren Eltern und Grosseltern geäussert wurden, ist die Überzeugung, dass Lernen nur dann effektiv ist, wenn es durchgehend Spass macht, erst seit Kurzem auf dem Vormarsch. In diesem Credo steckt viel Wahrheit, aber es lohnt sich auch hier, etwas genauer hinzusehen.
Im Allgemeinen gilt: Freude, Neugier und Begeisterung machen es uns leichter, uns auf ein Themengebiet einzulassen, neues Wissen aufzunehmen und unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Es gibt jedoch mehrere Missverständnisse rund um die obige Aussage.
Das eine Missverständnis besteht darin, dass wir davon ausgehen, dass Begeisterung beim Lernen automatisch zu besseren Leistungen führt. Es macht mehr Spass, Volleyball oder Fussball zu spielen, als an der Technik zu feilen. Es ist cooler, mit Freunden zu jammen als Stunden für Fingerübungen auf der Gitarre zu investieren. Es ist auch lustvoller, Buchstaben zu kneten und aus Sandpapier auszuschneiden als sie immer wieder zu schreiben. Aber ist der Lerneffekt deswegen auch höher? Wenn man dieser Logik folgt, müssten die Menschen, die beim Üben am meisten Spass haben, auch die beste Leistung erbringen.
Interessanterweise aber empfinden die Profis das Üben auf einem Gebiet als unangenehmer und anstrengender als Amateure. Ein Grossteil der Schriftsteller berichtet, dass das Schreiben ihre grösste Leidenschaft sei und gleichzeitig eine zuverlässige Quelle von Anstrengung und Mühsal. Für Peter Bichsel bedeutet «eine Kolumne zu schreiben» beispielsweise «eine ganze Woche Leidenszeit». Und der bekannte Schriftsteller Philip Roth meint: «Es ist eine Qual. Wenn ich ein Kind hätte, das Schriftsteller werden wollte, würde ich versuchen, ihm das auszureden.»
Fortschritte zu machen ist anstrengend.
Im Grunde wissen wir es alle – wir hören es nur nicht gerne: Wenn wir in einem Bereich wirklich Fortschritte machen wollen, ist das anstrengend. Wenn wir uns in der Rechtschreibung verbessern möchten, sollten wir herausfinden, wo wir die meisten Fehler machen – und dann beispielsweise zwei Monate lang jeden Tag während zehn Minuten die Gross- und Kleinschreibung üben. Wenn wir unsere Vortragskompetenzen erweitern möchten, wäre es wertvoll und unangenehm, sich dabei auf Video aufzunehmen, daraus spezifische Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten und mit Ausdauer daran zu feilen.
Überall, wo die Leistung klar messbar ist – zum Beispiel im Sport oder in der klassischen Musik–, folgt das Üben einer gewissen Struktur. Übergeordnete Fertigkeiten werden in Teilfertigkeiten zerlegt, die jeweils intensiv geübt werden.
Freude, spielerisches Entdecken, Kreativität und Begeisterung: All das soll in der Schule Platz haben und einen wichtigen Stellenwert besitzen. Bestimmte Grundfertigkeiten müssen aber einfach trainiert und automatisiert werden. Sonst sind kreative Leistungen nicht möglich. Wer beispielsweise ständig über die Rechtschreibung nachdenken und sich jedes Mal fragen muss, ob man ein Wort gross- oder kleinschreibt, kann schlecht die Handlung des Aufsatzes weiterspinnen. Wenn es um den Aufbau solcher Fertigkeiten geht, ist Üben notwendig und nicht altmodisch.
Es ist spannend, dazu einen Blick in das Gehirn zu werfen. Dabei wird deutlich: Wenn wir etwas Neues lernen, wird vor allem der präfrontale Kortex, der Sitz unseres bewussten Denkens, aktiviert. Dieser Teil des Gehirns arbeitet seriell: Eins nach dem anderen. Wir können nicht gleichzeitig über zwei Sachen nachdenken.
Übung und Automatisierung sind keine Gegenspieler von Kreativität und Flexibilität.
Wenn wir etwas so lange üben, bis es automatisiert ist, übernehmen andere Bereiche des Gehirns diese Aufgabe. Ab dieser Stufe können wir die Aufgabe ohne bewusstes Nachdenken lösen. Der präfrontale Kortex wird entlastet und kann sich einer anderen, zusätzlichen Aufgabe zuwenden: Das Kind kann sich nun die Schuhe binden und gleichzeitig mit Ihnen plaudern. Es schreibt die Nomen gross, ohne sich bei jedem Wort zu fragen, ob man der/die/das davorsetzen kann – und kann sich stattdessen auf seine Geschichte konzentrieren. Es kann mit den Augen auf dem Notenblatt verweilen und das Stück interpretieren, anstatt andauernd auf die Klaviertasten zu schielen, um den richtigen Ton zu treffen.
Halten wir also fest: Übung und Automatisierung sind keine Gegenspieler von Kreativität und Flexibilität, sondern deren Voraussetzung. Es ist erfreulich und kindgerecht, dass die Schule von unnötigem Drill weggekommen ist und dem spielerischen Lernen und Entdecken mehr Raum gibt. Aber wir sollten das Üben und Schleifen – dort, wo es notwendig ist – nicht verteufeln.