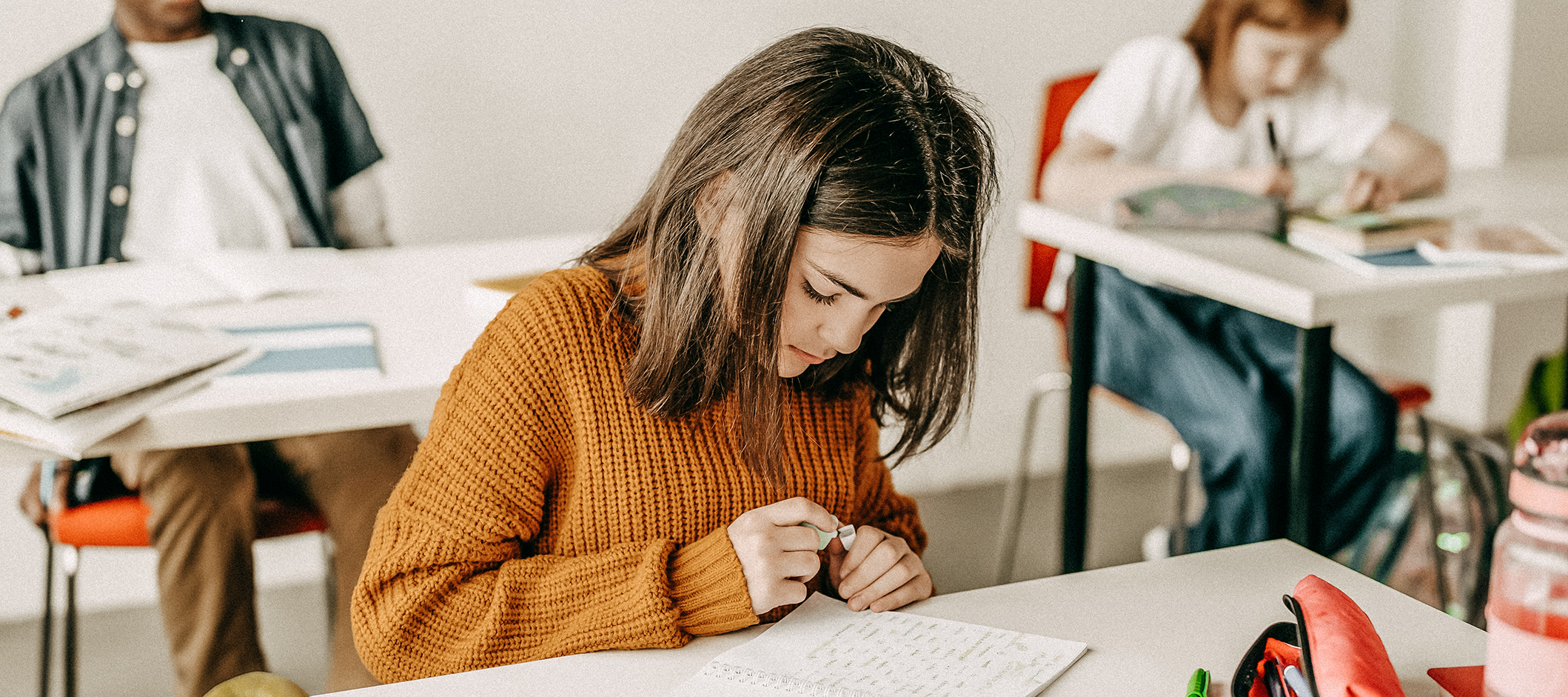In der Schule steht das Kind im Zentrum, nicht die Eltern

Grundsätzlich ist es immer gut, wenn Eltern den Austausch mit einer Lehrperson suchen – solange sie dabei nicht ihre Kompetenzen überschreiten.
Seit einer Stunde sitzt der Erstklässler jetzt schon an den Hausaufgaben und schreibt neue Buchstaben. Immer wieder fliessen Tränen. «Weil das alles so viel ist», wie er sagt. Die Mutter ist sauer auf die Lehrperson und schreibt dieser am Nachmittag eine wütende E-Mail: «Sie können doch einem kleinen Kind nicht so viele Hausaufgaben zumuten!» Die Lehrerin meldet sich prompt. Aus ihrer Antwort wird klar: Das Kind hat in der Schule etwas falsch verstanden und viel mehr Aufgaben erledigt als nötig.
Viele Eltern wollen heute am liebsten alle Schwierigkeiten für ihre Kinder lösen und ihnen alle Probleme aus dem Weg räumen, aber das ist gar nicht ihre Aufgabe.
Maja Kern, Dozentin PH Luzern
«Diese Situation ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrperson besser nicht ablaufen sollte», sagt Maja Kern, die als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Luzern arbeitet. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die Kooperation von Schule und Familie, die sie für unausweichlich hält. «Denn Eltern und Schule teilen sich schliesslich die Verantwortung für das Kind», sagt sie.
Unterschiedliche Perspektiven
Angela Aegerter, Dozentin an der PHBern, spricht von einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, «bei der grundsätzlich beide Seiten davon ausgehen können und sollen, dass sie jeweils nur das Beste für das Kind wollen».
Doch wie bei anderen Partnerschaften steckt auch in der Beziehung zwischen Eltern und Lehrperson viel Potenzial für Konflikte. «Die Eltern haben natürlich vor allem die Interessen und das Wohl ihres Kindes im Blick. Die Lehrperson aber ist um das Wohl der ganzen Klasse oder gar der ganzen Schulgemeinschaft bemüht», sagt Maja Kern.
Hinzu kommt, dass die Eltern in der Schule nicht dabei sind. Empört sich das Kind über das ungerechte Verhalten einer Lehrperson, ist das seine Wahrnehmung. «Natürlich sollten die Eltern so etwas ernst nehmen und genau nachfragen, was los war. Aber man darf eben auch nicht immer alles für bare Münze nehmen», sagt Maja Kern. Das zeigt auch das zu Anfang beschriebene Beispiel mit den Hausaufgaben.
Ihr Rat an Eltern: Immer daran denken, dass das Kind im Zentrum steht, wenn es um schulische Angelegenheiten geht. «Viele Eltern wollen heute am liebsten alle Schwierigkeiten für ihre Kinder lösen und ihnen alle Probleme aus dem Weg räumen, aber das ist gar nicht ihre Aufgabe», sagt Maja Kern.
Im Beispiel mit den Hausaufgaben wäre es ihrer Meinung nach deshalb ein guter Weg gewesen, wenn das Kind am nächsten Tag in der Schule selbst angesprochen hätte, wie lange es dafür gebraucht hat. «Erleben Eltern, dass es häufig sehr viele Hausaufgaben gibt und das Kind auch darunter leidet, dürfen sie natürlich auch selbst den Kontakt mit der Lehrerin oder dem Lehrer suchen.»
Regelmässiger Kontakt hilft
Auch Angela Aegerter findet, dass Eltern sich grundsätzlich immer dann bei einer Lehrperson melden können, sobald sie besorgt über etwas sind oder spüren, dass sich das Verhalten des Kindes verändert hat. «Das dürfen durchaus auch wichtige positive Entwicklungsschritte sein und nicht immer nur Probleme», so die Expertin. Denn ein guter regelmässiger Kontakt helfe dabei, Vertrauen aufzubauen. «Und wenn einer Lehrperson der Kontakt wirklich mal zu viel wird, ist es auch an ihr, dies zu äussern», so Aegerter.
Wenn ein Kind sieht, dass die Eltern gut mit der Lehrperson kooperieren, hat das positive Auswirkungen auf die Schüler.
Sie beobachtet, dass sich Eltern heute generell mehr für die Schule interessieren und Schulen auch versuchen, dem gewachsenen Informationsbedürfnis nachzukommen – weil beide Seiten davon profitieren. So konnte in mehreren Forschungsprojekten gezeigt werden: Wenn ein Kind sieht, dass sich die Eltern für die Schule interessieren und dabei gut mit der Lehrperson kooperieren und an einem Strang ziehen, dann hat das nachweislich positive Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler.
Eltern verlangen zu viel von der Schule
Dass dies noch nicht an allen Schulen gelingt, zeigt ein Ergebnis einer Befragung der Mercator-Stiftung zum Thema «Welche Schule will die Schweiz?». Hier gaben fast 70 Prozent der befragten Eltern an, Schulen müssten den Eltern gegenüber transparenter werden und mehr Information bereitstellen. Allerdings sagten ebenso viele Befragte, dass viele Eltern in der Eltern-Schule-Beziehung zu viel von den Schulen verlangen würden.
Anders als das viele Eltern noch von ihrer eigenen Schulzeit her kennen, versuchen Lehrpersonen heute meist, auch die Schüler in die Eltern-Lehrer-Kommunikation einzubeziehen und sie wann immer möglich an Gesprächen teilhaben zu lassen. «Schülerinnen und Schüler sollen mit zunehmendem Alter Verantwortung übernehmen und ihre Perspektive einbringen dürfen. Ihre Erfahrungen, Meinungen und Bedürfnisse sind für die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule zentral», sagt Angela Aegerter.
Bei Konflikten allerdings sollten sich Eltern wie Lehrperson gut überlegen, zu welchem Zeitpunkt des Gesprächs sie ein Kind dabeihaben wollen und wann nicht. «Falls das Kind nicht dabei ist, sollte man ihm aber immer Bescheid sagen, dass ein Gespräch stattfindet, worum es gehen wird, und ihm danach auch mitteilen, was dabei herauskam», so Maja Kern.
Eltern sollten ihre Grenzen kennen
Aber nicht immer ist ein vorausgehender Konflikt etwa zwischen verschiedenen Schülern oder zwischen Schüler und Lehrperson Anlass für ein Gespräch. Viele Konflikte entstehen auch erst während der Unterhaltung mit den Eltern. «Das passiert häufig dann, wenn Eltern ihre Kompetenzen überschreiten», sagt Maja Kern. So könnten Eltern beispielsweise nicht entscheiden, welche Lehrperson ihr Kind unterrichtet, neben wem das Kind sitzt, oder sich in die Notengebung einmischen.
«Wenn sich ein Kind falsch bewertet fühlt und darunter sehr leidet, kann man sich darüber natürlich trotzdem mit der Lehrperson unterhalten. Aber als Elternteil muss mir einfach klar sein, wo hier meine Grenzen sind», sagt Maja Kern. Denn man könne weder grundsätzlich die pädagogischen Fähigkeiten infrage stellen und der Meinung sein, dies als Eltern selbst viel besser beurteilen zu können, noch dürften Eltern aus dem Blick verlieren, worum es in dem Gespräch tatsächlich geht: nämlich um das Kind.
«Oft stehen dann aber die enttäuschten Vorstellungen der Eltern im Mittelpunkt, weil es in der Schule vielleicht nicht so läuft, wie sie sich das gewünscht hätten. Doch es geht in der Schule nun mal nicht darum, was die Eltern wollen, sondern was gut für das Kind ist», sagt Maja Kern.
Nicht am Elternabend
Und egal, worüber man den Kontakt mit der Lehrperson suchen möchte, für das Gelingen ist auch das Wie und Wann entscheidend. «Per E-Mail kann man gut kurz mal rückmelden, wenn ein Kind an einem Projekt besondere Freude hatte», sagt Angela Aegerter. Denn gerade solche positiven Botschaften tragen dazu bei, dass sich ein gutes Verhältnis entwickeln kann. Eine Mail dagegen wie im Anfangsbeispiel dazu zu nutzen, um auf die Lehrperson zu schimpfen, ist kein guter Stil. «In einem solchen Fall kann ich einfach schriftlich nach einem Termin für ein Gespräch bitten und kurz sachlich anreissen, worum es gehen soll», sagt Maja Kern.
Eltern sollten stets im Hinterkopf haben, dass eine Lehrperson in der Regel viele Schüler unterrichtet – und sich deshalb auf ein Gespräch kurz vorbereiten muss. «Das ist aber nicht möglich, wenn ich sie in der Pause auf dem Flur abpasse», sagt Maja Kern. Die Lehrperson am Rand des Elternabends zur Seite zu nehmen, um ein individuelles Problem zu besprechen, hält sie ebenfalls für keine gute Idee. Der Grund: «Am Elternabend ist die Lehrperson für alle Eltern da.»
Die Stiftung Mercator Schweiz hat gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Sotomo Ende 2022 landesweit rund 7700 Erwachsene – ein Drittel davon Eltern von schulpflichtigen Kindern – gefragt, wie deren ideale Schule aussieht. Am wichtigsten ist den Befragten demnach, dass die Kinder gern zur Schule gehen, Freude am Lernen haben und in ihrem eigenen Tempo sowie individuell gefördert lernen können. Diesen Wunschvorstellungen stehen Dinge wie Prüfungen und Hausaufgaben als wichtigste Belastungsfaktoren gegenüber.
Mercator ist eine private, unabhängige Stiftung, die Handlungsalternativen in der Gesellschaft aufzeigen möchte, unter anderem im Bereich Bildung und Chancengleichheit.