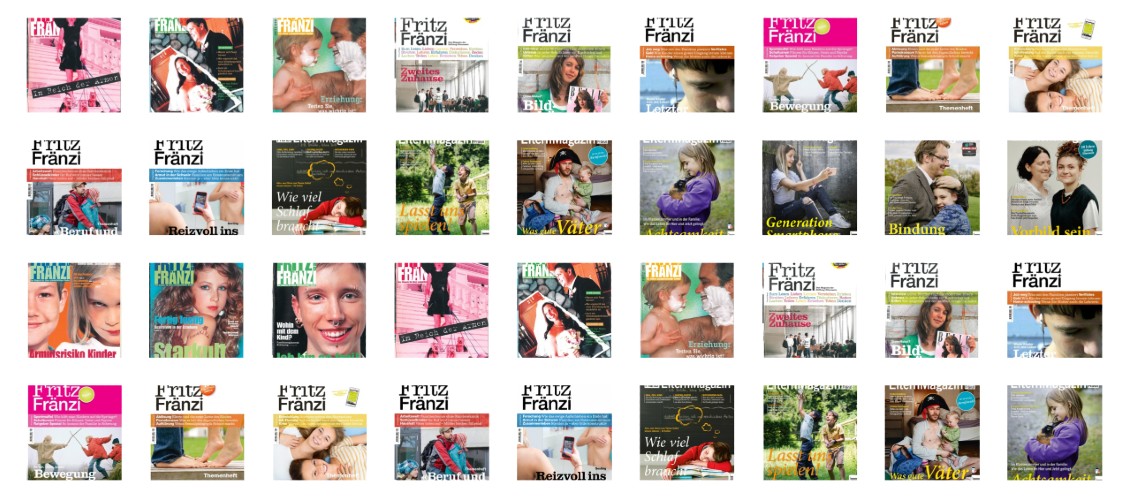Zwischen Stuhl und Bank

Das neue Jahrtausend hat der Volksschule tiefgreifende Umwälzungen beschert. Wo steht sie nach PISA, Lehrplan 21 und Co. und welche Herausforderungen erwarten sie in Zukunft? Wir haben nachgefragt.
Rund 10 00 Stunden verbringt ein Kind bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit in der Schule. Es ist also nicht übertrieben, zu behaupten, die Schule sei für das Kind eine zweite Heimat – wie das Elternhaus wird auch sie seinen Lebensweg prägen. Dies im besten Fall so, wie es sich die Volksschule selbst zum Ziel gesetzt hat: Indem sie dem Kind unabhängig von seiner Herkunft eine Grundbildung ermöglicht, die es auf die gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet.
Auf den «PISA-Schock» folgt Vermessung
Die Frage, was es dafür braucht, ist Gegenstand einer Debatte, die der Volksschule zahlreiche Reformen eingetragen hat. «Für viele dieser Neuerungen hatte die erste PISA-Studie den Anstoss gegeben», sagt Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm. Manche erinnern sich: 2001 veröffentlichte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD erstmals die Resultate des Programms zur internationalen Schülerbewertung, an dem 180 00 15-Jährige aus 32 Ländern teilgenommen hatten. Die Erhebung prüfte Kompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaft und ermittelte, wie gut es den teilnehmenden Staaten gelinge, Kinder auf die Anforderungen der Gesellschaft vorzubereiten. Die Resultate waren für die Schweiz nicht eben schmeichelhaft: Sie schaffte es nur ins Mittelfeld.

Lesen Sie den Artikel «Familie im Wandel»
Auf den «PISA-Schock» folgten unter anderem die Harmonisierung kantonaler Schulsysteme, nationale Bildungsziele, die verbindliche Grundkompetenzen vorgeben, oder standardisierte Leistungstests, die diese Grundkompetenzen klassen- und schulübergreifend prüfen. Was zur Verbesserung der pädagogischen Qualität gedacht war, habe eher zu einer «Testkultur» geführt, die ihr Unbehagen bereite, sagt Erziehungswissenschaftlerin Stamm. «In vielen Kantonen werden schon Kindergartenkinder anhand mehrseitiger Kataloge beurteilt. Stehen ein paar Kreuzchen am unerwünschten Ende der Skala, fühlen sich Eltern oft verpflichtet, mit dem Kind zu üben», moniert sie. «In der Primarschule folgen weitere Standortbestimmungen, von denen es heisst, sie seien stärkenorientiert, aber faktisch sind es Tests.»
Zankapfel und Hoffnungsträger: der Lehrplan 21
Dieser Leistungsdruck sei problematisch. Er führe dazu, dass Kinder nur noch auf den Mindestnotenschnitt oder Prüfungen hin büffelten, so Stamm: «Dieser Fokus aufs Produkt lenkt vom selbständigen Denken ab. Er führt dazu, dass viele junge Menschen nicht wissen, was sie interessiert, sondern einfach das tun, was den Erwartungen entspricht.» Eigeninitiative oder Selbst-organisation blieben dann oft auf der Strecke. Der Lehrplan 21 sei in diesem Zusammenhang ein Schritt in die richtige Richtung, da er solchen Kompetenzen zumindest auf dem Papier mehr Gewicht einräume. «Ich hoffe, dass dies auch vermehrt in der Praxis der Fall sein wird», sagt Stamm.
Die Schweiz schaffte es im PISA-Ranking nur ins Mittelfeld. Das war ein Schock
Das Neue am Lehrplan 21 ist seine überregionale Ausrichtung, aber auch die Orientierung an Kompetenzen, von denen viele über das Kognitive hinausgehen. So gehören beispielsweise der Umgang mit Vielfalt, Selbstreflexion oder konstruktive Konfliktlösung zu den überfachlichen Kompetenzen, die Kinder an der Volksschule erwerben sollen. Der Lehrplan 21 ist Hoffnungsträger und Zankapfel zugleich. «Mit dieser ideologisch überfrachteten Kompetenzorientierung hat sich die Schule selbst ein Ei gelegt», findet etwa Allan Guggenbühl, Jugendpsychologe und ehemaliger Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich. «Mich stört, dass wir dabei von Soll-Erwartungen aus der Erwachsenenwelt ausgehen, die wir teilweise nicht einmal selbst erfüllen können. Wer kann von sich etwa behaupten, dass er Konflikte konstruktiv austrägt, Kritik ohne viel Aufhebens annimmt und immer sachlich argumentiert? Es ist nicht falsch, solche Erwartungen zu hegen – problematisch wird es, wenn sie zu Qualifikationen werden, die für den Schul-erfolg relevant sind.» Und überhaupt, findet Guggenbühl: Wer behalte bei über 350 Kompetenzen noch den Überblick?
Neue Schwerpunkte setzen
Man könne durchaus argumentieren, es seien zu viele, findet Beat A. Schwendimann, Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer: «Aber die Richtung stimmt.» In Zeiten von Automatisierung und Algorithmen sei es nötig, dass die Schule neue Schwerpunkte setze. «Sie muss fördern, was Maschinen nicht können», sagt Schwendimann, «Kommunikation, Empathie, kreative Lösungsansätze, die Fähigkeit, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Das sind Fertigkeiten, nach denen die Zukunft verlangt, und da ist der Lehrplan 21 mit den überfachlichen Kompetenzen auf einem guten Weg.»
Gemäss Lehrplan 21 sollen Lehrpersonen jedes Kind dort abholen, wo es aufgrund seines Entwicklungsstandes steht.
Nicht alle Schulreformen der letzten Jahre zielen auf Leistungssteigerung ab. Viele sind auch Ausdruck eines gestiegenen Bewusstseins dafür, dass Kinder besser lernen, wenn sie mit Blick auf ihre persönlichen Stärken und Schwächen gefördert werden. Entsprechend steht die Schule der Zukunft, so sieht es der Lehrplan 21 vor, im Zeichen der Individualisierung. Lehrpersonen sollen demnach jedes Kind dort abholen, wo es aufgrund seines Entwicklungsstands steht, und seinen ganz persönlichen Lernprozess entsprechend gestalten. Individualisierung bedeutet ausserdem, Kindern einen Teil der Lernverantwortung zu übergeben, etwa, indem man sie gewisse Lernziele selbst setzen und in Eigenregie umsetzen lässt. Die individualisierte Schule sieht sich ausserdem als inklusive Schule. Das heisst: Alle Kinder und Jugendlichen – auch solche mit besonderem Förderbedarf – besuchen gemeinsam die Regelklasse.

Während die einen monieren, solche Paradigmenwechsel glichen einem Luftschloss, gehen sie anderen zu wenig weit. «Der Lehrplan 21 ist wie eine kleine Ummöblierung in einem Haus, das einen Totalumbau nötig hätte», findet Dani Burg, Sekundarschullehrer im aargauischen Niederlenz und ehemaliger Schulleiter. Die Kompetenzenorientierung ermögliche zwar, sich etwas vom Lernstoff zu lösen, aber das Grundsystem werde nicht infrage gestellt: «Dieses Reinstopfen von Inhalten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wiedergegeben werden müssen und danach vergessen gehen.» Die Heterogenität der Gesellschaft habe sich akzentuiert und die Schule werde dieser Realität noch immer nicht gerecht.
Kritik am Schulsystem, wie sie auch der 2020 verstorbene Kinderarzt Remo Largo, Hirnforscher Gerald Hüther oder der Philosoph Richard David Precht in Bestsellern äusserten, befeuert die Debatte über Sinn und Zweck unserer Bildungsinstitutionen. Diese schüre mitunter auch falsche Erwartungen, sagt Bildungsforscher Urs Moser von der Universität Zürich. So würden beispielsweise Lernlandschaften oder Projektunterricht oft als Allerheilmittel stilisiert, während man Frontalunterricht oder Hausaufgaben als Grund allen Übels betrachte. «Dabei sind das alles nur Methoden», sagt Moser, «und wir wissen: Keine Methode wirkt in Reinkultur.» Auch der populäre Begriff des selbstorganisierten Lernens sei mit Missverständnissen behaftet. «Selbstorganisiertes Lernen ist keine Methode, sondern ein pädagogisches Ziel», sagt Moser. «Die Schule kann Selbständigkeit nicht voraussetzen, sie muss darauf hinarbeiten.» Dies bedeute nicht nur, Kinder eigene Erfahrungen machen zu lassen, es verlange von der Lehrperson ein Gespür für Lenkung im richtigen Moment.
Chancengerechtigkeit als Dauerbrenner
Dies bestätigt Erziehungswissenschaftlerin Stamm: «Wenn Kinder Projekte in Eigenregie umsetzen, sind viele von ihnen auf intensive Begleitung angewiesen. Sie brauchen im Hintergrund ein wachsames Auge, das Unterstützungsbedarf rechtzeitig erkennt.» Das gelte umso mehr für Kinder aus sozial schwächer gestellten Familien. Die dringendste Aufgabe der Schule sieht Stamm darin, diese nicht noch weiter ins Hintertreffen geraten zu lassen: «Wir haben es mit einer erheblichen Anzahl von Kindern zu tun, die ihr intellektuelles Potenzial nicht verwirklichen können, weil die Bedingungen zu Hause nicht stimmen. Massnahmen gegen diese Ungerechtigkeit haben nicht die Priorität, die sie verdienen.» Zwar hätten es Kinder aus bildungsfernen Schichten in allen deutschsprachigen Ländern schwer, aber Studien zeigten, dass in der Schweiz die soziale Vererbung von Bildung besonders ausgeprägt sei. «Hier», sagt Stamm, «liegt für die Schule von morgen die grösste Herausforderung.»
Margrit Stamm: «In der Chancengleichheit liegt für die Schule von morgen die grösste Herausforderung.»
Die Politik setzt im Hinblick auf Chancengerechtigkeit grosse Hoffnungen in Tagesschulen: Man hofft, dass Kinder aus benachteiligten Familien Defizite zumindest ein Stück weit ausgleichen, wenn sie im schulischen Umfeld lernen, Hausaufgaben machen und ihre Freizeit verbringen können. Neuere Studien wie etwa der Universität Bern aus dem Jahr 2017 haben dieser Hoffnung einen Dämpfer versetzt: Sie liefern keinen Hinweis darauf, dass Ganztagesstrukturen Bildungsungleichheiten reduzieren, und betonen in diesem Zusammenhang, dass es nicht reicht, wenn Kinder nur gehütet werden, aber keine gezielte pädagogische Förderung erfahren.
Immer wichtiger sind Tagesschulen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren sieht für alle obligatorischen Schulen «ein bedarfsgerechtes Angebot an Tagesstrukturen» vor. Deren Benutzung bleibe jedoch freiwillig und für die Erziehungsberechtigten kostenpflichtig. In den vergangenen Jahren wurde das Angebot an Tagesstrukturen oder -schulen – Bezeichnungen variieren nach Kanton – kontinuierlich ausgebaut. Eine Umfrage auf kantonaler Ebene aus dem Schuljahr 2019/20 zeigt jedoch, dass die Umsetzung insgesamt betrachtet eher schleppend verläuft: Ausserhalb der französischsprachigen Schweiz, wo Tagesschulen Standard sind, finden sich Angebote mehrheitlich in bevölkerungsreichen, durch grosse Städte dominierten Kantonen wie Zürich, Bern oder Basel-Stadt.
Wie gelingt Schule?
Auf dem Weg zu einer kindgerechten Schule hat sich viel getan, ist Psychologe Fabian Grolimund überzeugt. Um ins Ziel zu gelangen, brauche es Engagement auf allen Ebenen.
Fabian Grolimund über…… die zukunftsorientierte Schule
Die Schule versteht sich heute als Lern- und Lebensort, und viele der jüngsten Reformen stehen im Zeichen einer kindgerechten Schule. Problematisch ist, dass deren Gelingen stark vom Engagement einzelner Lehrpersonen abhängt, die aus Überzeugung handeln, aber wenig Unterstützung erfahren. Man will viel von der Schule, ist aber auf politischer Ebene nicht bereit, zu investieren. So werden im Namen der Inklusion etwa Sonderschulen geschlossen, öffentliche Schulen aber nicht ausreichend auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen vorbereitet. Auch Individualisierung wird nicht zu Ende gedacht: Lehrkräfte sollen Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend fördern, gleichzeitig wird bei Prüfungen erwartet, dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche können. Es fehlt weitgehend an Beurteilungsformen, die echte Individualisierung ermöglichen – und an Lehrmitteln, die auf unterschiedliche Leistungsniveaus ausgerichtet sind. Damit eine zukunftsorientierte Schule nicht auf halbem Weg stecken bleibt, braucht es die Einsicht der Politik, dass sie nicht zum Nulltarif realisierbar ist.
… individualisierten Unterricht
In der Schweiz hat die Bevölkerung grossen Einfluss auf das Schulsystem, konnte beispielsweise über den Lehrplan abstimmen. Auch haben Schulen und Lehrpersonen hierzulande mehr Gestaltungsspielraum als beispielsweise in Deutschland. Diesen gilt es zu nutzen, denn er bietet Schulen die Chance, sich an ihre individuellen, durch Standort, Schüler- und Lehrerschaft gegebenen Umstände anzupassen und ein eigenes Profil zu entwickeln.
Je mehr sich eine Schule mit ihren Mitgliedern und deren Bedürfnissen auseinandersetzt, desto aktiver beschreitet sie diesen Weg. Was macht eine gute Schule aus? Eine gute Schule stellt sich diese Frage selbst und entwickelt eine Vorstellung davon, welches die nächsten Schritte auf dem Weg dorthin sind. Dabei ist es ratsam, sich thematisch nicht zu verzetteln, sondern sich auf einen inhaltlichen Schwerpunkt zu einigen. So kann beispielsweise individualisierter Unterricht das Fünfjahresziel sein, auf das Schulleitung und Lehrpersonen gemeinsam hinarbeiten – im Bewusstsein, dass dafür ein stetiger Entwicklungsprozess nötig ist.
… soziale Kompetenzen
Die Schule wird immer individueller, die dort gelebte Vielfalt grösser. Entsprechend sind Lehrpersonen darauf angewiesen, dass ein Kind in der Lage ist, sich in eine Gemeinschaft zu integrieren: dass es sich in andere einfühlen und eigene Bedürfnisse auch einmal zurückstellen, dass es Kompromisse eingehen oder Kritik annehmen kann. Damit das gemeinsame Lernen auch in Zukunft gelingt, ist es wichtig, dass Eltern das Thema soziale Kompetenzen nicht an die Schule delegieren, sondern ihren Kindern immer wieder Gelegenheit geben, sich in diesen Fähigkeiten zu üben. Ausserdem ist es hilfreich, wenn Mütter und Väter realistische Erwartungen haben: Die Schule muss nicht perfekt sein, sondern gut genug. Kinder gedeihen auch dann, wenn die Bedingungen nicht komplett optimal sind.