Selbsttest: Bedürfnisorientiertes Zuhören und Reden
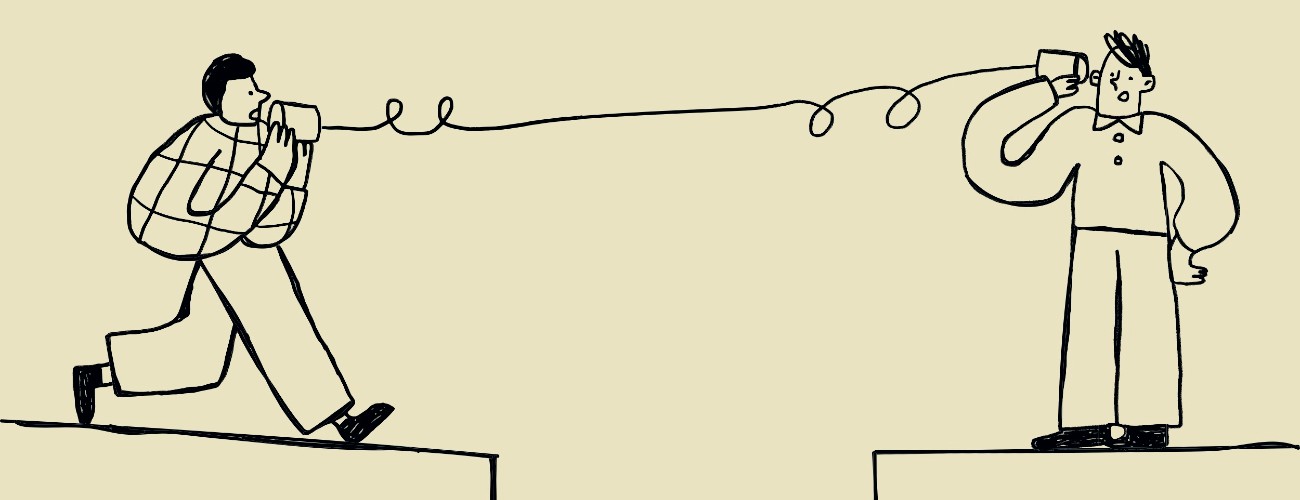
Bild: Rawpixel.com
Schluss mit elterlichen Verhören, stattdessen offene Gespräche und ungeteilte Aufmerksamkeit! Ab heute reden wir über Dinge, die im Alltag sonst keinen Platz finden – ein Selbstversuch in Kommunikation.
«Um sechs bist du zurück, ja?», sage ich zum Siebenjährigen, bevor er aufs Velo springt. «Ja-ha, klar!» Die Haustüre ist fast ins Schloss gefallen, als dem Kind einfällt: «Mama, wo wohne ich eigentlich, wenn ich gross bin?» «Was?», frage ich verdutzt, in Gedanken bereits den Fragenkatalog durchgehend für das in drei Minuten vereinbarte Telefonat. «Wo ich dann wohne», hakt er nach. Mein Kopf schwirrt. Was will das Kind? Und wo liegt noch mal das Handy, das ich gleich brauche? «Wir besprechen das heute Abend», bin ich versucht, den Sohn abzuwürgen.
Da fällt mir mein Selbstversuch ein. Über mehrere Wochen will ich die Kommunikationstechniken der Psychotherapeutin Ulrike Döpfner ausprobieren. «Bedürfnisorientiertes Zuhören und Reden» lautet das Prinzip. Mit den einsilbigen Antworten meiner Kinder, wenn sie aus der Schule kommen und ich im Verhörmodus Eckpunkte abfrage, soll Schluss sein.
Offene Fragen, erstaunliche Wirkung
Die Lösung? Offene Gespräche anregen, Zeit für ungeteilte Aufmerksamkeit einplanen. Damit die Zehnjährige sich nicht mehr beschwert: «Jetzt hör mir doch mal richtig zu, Mama!» Stattdessen bin ich ab sofort aktiv dabei, fasse ihr Gesagtes zusammen und melde zurück, wie ich die Botschaft auffasse – ohne Bewertungen oder Ratschläge hinzuzufügen. Das Kind soll sich richtig verstanden fühlen. Nur so erfahren Eltern, was den Nachwuchs wirklich bewegt, sagt Döpfner.
In der Praxis funktioniert dies tatsächlich gut. Meine offenen Fragen erzielen erstaunliche Wirkung. Selbst der sonst nicht so redselige Siebenjährige fängt an zu erzählen, wenn es plötzlich heisst: Was hat dich heute zum Nachdenken gebracht? Wer war nett zu dir? Mit wem hattest du am meisten Spass? Ich muss mich allerdings extrem zusammenreissen, um nicht in alte Muster zurückzufallen. Zu verführerisch ist es, zielgerichtet und an Fakten orientiert abzufragen, wenn der Alltag von so viel Organisatorischem überlagert ist. Hinzu kommt: Damit das Ganze nicht wieder Verhörcharakter annimmt, muss auch ich von meinem Arbeitstag erzählen. Mit wem zum Teufel hatte ich heute noch mal am meisten Spass?
Mit wem zum Teufel hatte ich heute noch mal am meisten Spass?
Bewusst versuche ich, mir Zeit zu nehmen für konzentrierte Zweiergespräche abends vor dem Schlafengehen. Typischerweise ist dann das Redebedürfnis der Kinder besonders gross, meine Aufnahmebereitschaft allerdings leider besonders klein. Doch weil die Stundenpläne nicht harmonieren, komme ich zweimal die Woche in den Genuss von Lunch-Dates unter vier Augen – einmal mit der Tochter, einmal mit dem Sohn. Was sich als grosses Geschenk erweist. So viel spannende Einsichten in die Gedankenwelten meiner Kinder erhalte ich sonst das ganze Jahr nicht.
Am meisten Spass macht Kindern wie Eltern der Katalog aus 100 Fragen am Ende von Döpfners Buch. Sie sollen Gespräche zwischen den Generationen anregen, um mehr voneinander zu erfahren. Wir probieren es an einem warmen Sommerabend aus, beim Picknick im Garten. Der Jüngste stellt die erste Frage: «Wie würde dein Traumhaus aussehen?» Die Grosse fabuliert sofort von einem Haus direkt am Meer, «das Schlafzimmer wäre am wichtigsten, es müsste gemütlich sein zum Lesen». Ihr Bruder schwärmt von einem gigantischen Palast mit vielen Zimmern, einer riesigen Leinwand und einem Fussballstadion – «ich wohne da wie ein König und habe Leute, die für mich arbeiten». (Ist das mein Kind, das so sprudelt?) Den Mann zieht es wie die Tochter in ein Haus am Meer «mit Kaminzimmer». (Was willst du denn mit einem Kaminzimmer?) Und auch ich sehe mich am Wasser – in einem kleinen Haus, mit dem Nötigsten ausgestattet. («Warum klein, wenn du es dir aussuchen kannst?», wundert sich der Sohn.)
Erfahren, was wir nicht wussten
Wir diskutieren über vieles an diesem Abend. Ob wir lieber ein Delfin oder ein Hai sein wollen. (Ein Delfin, sind sich alle einig.) Ob es besser ist, das ältere oder das jüngere Geschwisterkind zu sein. («Das Jüngere», finden beide Kinder, «die dürfen alles früher und werden nicht so viel geärgert.») Gemeinsam spinnen wir rum, malen aus. Dabei zeigt sich: Gespräche mit den Kindern sind vor allem dann spannend, wenn wir etwas über sie erfahren, was wir nicht wussten. Wenn wir über Dinge reden, die im Alltag keinen Platz haben. Der Abend ist wohl auch deshalb so gelungen, weil alle Zeit haben und sich ohne To-do-Liste darauf einlassen. Von der Haltung der Eltern hängt alles ab, muss ich mir eingestehen. Sind wir offen und lassen uns nicht von den Anforderungen des Alltags überrollen, funktioniert die Kommunikation hervorragend.
In stressigen Momenten allerdings schlagen die alten Muster und die Verhörtaktik wieder durch. Im besten Fall warnen der Mann und ich uns dann gegenseitig mit Augenrollen. Sehr oft verschwinden die guten Vorsätze im Alltagsrauschen. So wie an jenem Nachmittag, als der Junior unvermittelt fragt: «Wo wohne ich eigentlich, wenn ich gross bin?» Doch diesmal unterdrücke ich den Impuls, ihn auf später zu vertrösten, und antworte stattdessen: «Was glaubst du?» «Vielleicht irgendwo, wo es immer warm ist», sagt das Kind. «Vielleicht aber auch bei dir. Tschü-hüss!» Und weg ist es. Zeitaufwand: 20 Sekunden. Ist aktives Zuhören am Ende gar keine Frage der Zeit? Es ist wie eine Fremdsprache, die geübt werden will: Am Anfang überdenkt man jede Formulierung, irgendwann fliesst es von selbst.
Mehr lesen zum Thema Kommunikation in der Familie:
- Gespräch statt Verhör: Wie rede ich mit meinem Kind?
Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Ulrike Döpfner ist überzeugt, dass sich über Sprache Nähe schaffen lässt und Eltern ihre Kinder besser kennenlernen können. Die Buchautorin sagt, warum Kinder oft knapp antworten, wenn man sie nach der Schule oder ihrem Befinden fragt, und weshalb wir mit Söhnen mehr über Gefühle reden sollten.
- Zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus?
Plötzlich schreit jemand, und Türen werden geknallt. Kommunikation in der Familie ist eine knifflige Sache, zumal Kinder manchmal auf Durchzug schalten. Fünf Beispiele aus dem Alltag – und wie man es besser machen kann.
- Schluss mit starren Rollen – zuhören!
Viele Eltern flüchten sich gegenüber ihren Kindern in Schauspielerei, weil sie Angst haben, die Führung zu verlieren. Dabei würden ihnen Empathie und ein echter Dialog auch helfen, Grenzen zu setzen.

















