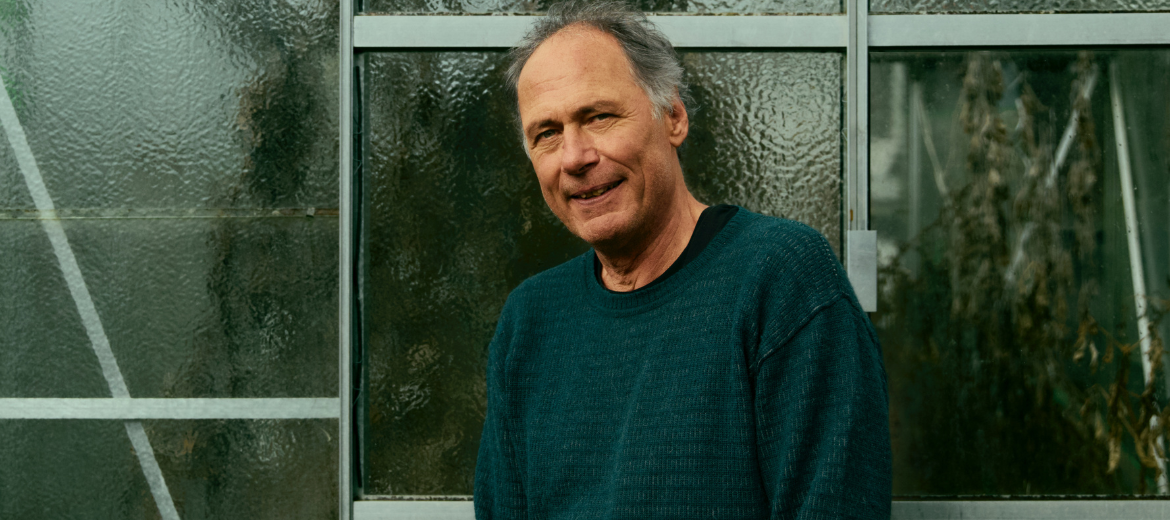Wenn das Geld kaum zum Leben reicht

Bilder: Lea Meienberg / 13 Photo
Mehr als 1,2 Millionen Menschen in der Schweiz sind von Armut betroffen oder bedroht. Unter ihnen sind überdurchschnittlich viele Alleinerziehende und Eltern mit drei oder mehr Kindern. Drei betroffene Familien erzählen aus ihrem Alltag, von Existenzängsten und Verzicht, von ihrem Wunsch nach mehr Verständnis und der Hoffnung auf finanzielle Unabhängigkeit.
Auf der Anrichte liegen die Einkäufe: Reis, Teigwaren, Äpfel, Broccoli, WC-Papier. Auf den Verpackungen prangen die Labels der Billigmarken deutscher Supermarktdiscounter. Grossbuchstaben in knalligen Farben. Einmal pro Woche fährt die 31-Jährige zum Einkaufen über die Grenze, in der Tasche Prospekte mit Sonderangeboten. Nur was Aktion ist, landet im Einkaufswagen. Geht sie bei einer dieser Einkaufstouren auch zum Coiffeur? «Nein, das kann ich mir nicht leisten», sagt Lisa Schnellmann und streicht sich verlegen übers Haar.
«Lisa Schnellmann ist nach den Zahlen des Bundesamtes für Statistik eine von 675 000 Personen in der Schweiz, die unter der Armutsgrenze leben. Das heisst konkret: Der Alleinerziehenden bleiben nach Abzug von Miete und Krankenversicherungen für sich und ihre Kinder rund 1700 Franken monatlich zum Leben. Das sind 55 Franken pro Tag.
«Nur Kinderschuhe kaufe ich neu»
Am Wochenende geht die Familie meist auf den Spielplatz oder spazieren. Das kostet nichts. Minigolf, ein Glace in der Badi, Chilbi: Was für andere Kinder zum normalen wöchentlichen Freizeitprogramm gehört, erleben Ella und Joel nur in Ausnahmefällen. Lisa spart, wo sie kann. Und weiss doch, dass sie ihren Kindern manche Dinge nicht vorenthalten kann, nicht vorenthalten möchte. Zu ihrem 30. Geburtstag wünscht sich Lisa Schnellmann von ihren Freunden drei Eintrittskarten für den Zoo. Joel und Ella sollen dazugehören. «Aber wenn Joel dreimal im Monat zu einem Kindergeburtstag eingeladen wird, ist das hart für mich.» Damit er dabei sein kann, spart seine Mutter den Rest des Monats beim Essen.
Ella ist noch zu klein, um zu verstehen, dass sie anders lebt als ihre Freundinnen. Joel nicht. Wenn er nach dem Ende der Sommerferien erzählt, wo die anderen in den Ferien waren, kann Lisa Schnellmann das kaum ertragen. «Du musst halt sparen, Mami!» Lisa ist noch nie mit ihren Kindern verreist.
«Früher ging es uns gut», erinnert sich Lisa Schnellmann.
Vorwürfe auf der Sozialbehörde

«Ich würde auch gerne in der Badi liegen, wenn andere arbeiten», hört sie eines Morgens eine Nachbarin zu einer anderen sagen. «Kein Wunder, dass die Geschäfte bei uns schliessen müssen, wenn alle nur noch in Deutschland einkaufen», entgegnet diese. Lisa schämt sich, auch wenn sie es besser weiss. «Aber ich wünsche mir, dass auch andere sehen, dass ich nicht einfach nur faul bin. Es kann jeden treffen», sagt sie entschieden.
Das beklemmende Gefühl, den Briefkasten zu öffnen
«Die Existenzängste aufgrund finanzieller Sorgen schlagen ganz klar auf die Psyche», ist sich Melanie Huber sicher. Sie lebt zusammen mit ihrem Partner Thomas und den Kindern Malea, 13, Nick, 9, und Gil, 5, in einer Patchworkfamilie im Kanton St. Gallen. Trotz Vollzeitbeschäftigung reicht Thomas’ Lohn nicht aus. Melanie hat immer wie der depressive Phasen, in denen sie grübelt, wie es weitergehen soll.
Das Wohl der Kinder steht an erster Stelle.
Auch Melanie wünscht sich von anderen mehr Verständnis für ihre Situation: «Wir sind nicht faul, nur weil wir vom Sozialamt unterstützt werden», sagt sie.
Armut hat viele Facetten. Fehlt das Geld für Restaurant, Museums oder Zirkusbesuche, kann Armut in die soziale Isolation führen. Auch die betroffenen Kinder werden aus gegrenzt, wenn sich eine Familie ganz alltägliche Dinge wie einen Kindergeburtstag oder die Klassenreise nicht leisten kann. Zum Schutz der Kinder verheimlichen viele Eltern ihre prekäre finanzielle Situation, weil Armut in unserer Gesellschaft noch immer mit Scheitern assoziiert wird.
Viele suchen aus Scham keine Hilfe
Um trotzdem am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und ihren Kindern ein normales Leben bieten zu können, versuchen viele Betroffene, ihre finanzielle Misere mit Kleinkrediten oder Leasingkäufen zu kaschieren, was auf Dauer erst recht in die Armut führt. Denn ein ohnehin schon enges Familienbudget vermag die teilweise horrenden Zinsforderungen der Kreditgeber nicht zu verkraften. Die Betroffenen geraten in eine Abwärtsspirale, die oft auf dem Betreibungsamt endet.
«Um sozial nicht abgehängt zu werden, geben sie das Geld aus, anstatt es für Steuern oder andere Verpflichtungen zu sparen.»
André Widmer, Leiter der Zuger Schuldenberatungsstelle Triangel.

Armut ist eine gesellschaftliche Herausforderung
Lisa Schnellmann hat sich dazu entschieden, mit ihrem Umfeld offen über ihre finanziellen Schwierigkeiten zu sprechen und Hilfe anzunehmen. Seitdem gehe es ihr besser, sagt sie. Trotzdem gebe es immer noch Leute im Dorf, die ihr Faulheit vorwerfen. Sie würde ein Leben auf Kosten ihres Ex-Partners und des Staates führen, heisse es. «Das tut weh», sagt Lisa Schnellmann. Ihr Ziel sei es, ganz gesund zu werden und bald wieder Teilzeit im Büro arbeiten zu können. «Ich wünsche mir finanzielle Unabhängigkeit, denn ich habe mein Geld immer selbst verdient und noch nie zuvor jemanden um Unterstützung bitten müssen.»
* Alle Namen wurden geändert und sind der Redaktion bekannt.
Zur Autorin:
Wer ist in der Schweiz von Armut betroffen?
Einige Hilfsorganisationen unterstützen von Armut betroffene Familien. Caritas Schweiz beispielsweise lancierte vor einigen Jahren das Projekt «Mit mir»: Freiwillige Patinnen und Paten verbringen ein- bis zweimal im Monat Zeit mit Kindern aus schwierigen familiären Situationen. So können die Kinder ihre Freizeit kreativ gestalten und ihre Eltern werden entlastet.
Ferienlager für Kinder aus wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen!
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi stellt ein einzigartiges Programm zusammen: Spielen, Basteln, Sport, Wanderungen, Lagerfeuer, Programmieren/Roboter bauen, Musizieren, Tanz, Theaterworkshops, gemeinsam kochen, Radiosendungen produzieren. Für Fussballfans gibts ein besonderes Highlight: ein gemeinsamen Training mit dem FC St. Gallen.
Mit unserem Angebot möchten wir von Armut betroffenen Kindern einige unbeschwerte Ferientage schenken, die Integration sozial Benachteiligter fördern und mithelfen, sich auszutauschen und Freundschaften zu schliessen. Detaillierte Informationen zum Programm und zu den Teilnahmebedingungen folgen in unserer März-Ausgabe.
Eine Aktion der Stiftung Elternsein
«Die Gesellschaft muss verstehen lernen, wie Menschen in Armut geraten»
Soziologieprofessor Franz Schultheis sagt, viele von Armut betroffene Kinder und Jugendliche schämten sich für die missliche Lage ihrer Eltern. Dabei müsste sich die Gesellschaft schämen, dass es dieses Phänomen in solch einem reichen Land überhaupt gibt.
Herr Schultheis, warum wird Armut in unserer Gesellschaft stigmatisiert?
Was löst eine solche Ausgrenzung bei den Betroffenen aus?

(Bild: zVg)
Warum verheimlichen so viele Betroffene ihre Situation?
Wie wirkt sich die Stigmatisierung auf die Kinder betroffener Familien aus?
Ist Armut «vererbbar»?
Betroffene Minderjährige sind auch in der Schule benachteiligt.
Wie kann die Gesellschaft armutsbetroffene Minderjährige unterstützen?
Was kann jeder Einzelne gegen die Ausgrenzung Betroffener tun?
Weiterlesen:
- «Frau Fredrich, wie leben arme Kinder in der Schweiz?»
Bettina Fredrich von Caritas Schweiz über ein unsichtbares Phänomen und prekäre Lebensverhältnisse in einem Staat, der Familien besser unterstützen sollte.
- Wieviel Geld braucht mein Kind in den Ferien? Und: Möchte Ihr Kind sein Feriengeld aufbessern, ist jetzt höchste Zeit, nach einem Ferienjob zu suchen!
- Jahresrückblick der Stiftung Elternsein Alle aktuellen Infos und Projekte des Herausgebers des ElternMagazins Fritz+Fränzi …