Muss ich denn immer laut werden?

In den meisten Familien gehört es zum Alltag: Eltern schimpfen mit ihren Kindern, mal mehr, mal weniger. Auslöser sind meist Stress und Überforderung. Doch Grenzen und Regeln lassen sich durch Anbrüllen nicht durchsetzen. Und zu viele Wutausbrüche schaden der Entwicklung des Kindes.
Manchmal werde ich laut. Unangenehm laut. Ich brülle meine Kinder an, schmeisse Dinge auf den Boden, knalle Türen zu. Vor Kurzem habe ich sogar mit dem Fuss aufgestampft. «Wie das Wutmonster in diesem Bilderbuch», schoss es mir durch den Kopf. Ich habe mich sofort ziemlich dumm gefühlt.
Was meinen Ausbruch ausgelöst hatte, war banal: Es ging um einen Berg Legosteine auf dem Fussboden. Meine Bitten, Aufforderungen und Ermahnungen dazu verhallten ungehört. Dabei war schon meine erste Ansage eindeutig gewesen: Ich brauchte noch eine halbe Stunde Ruhe, um ein paar wichtige Mails zu beantworten. Meine Kinder sollten in dieser Zeit das Spielzeug wegräumen, weil später Besuch kommen würde. Nach dem mütterlichen Inferno verschwand die 12-Jährige beleidigt in ihrem Zimmer, ihr jüngerer Bruder versteckte sich weinend in seinem Bett. Und ich fühlte mich schlecht.
Elterliches Schimpfen bewirkt keine Verhaltensänderung bei den Kindern.
Schimpfen bringt familiären Unfrieden
Muss das sein?, frage ich mich. Was macht dieses Schimpfen mit den Kindern? Was sagt es über die Beziehung zu unseren Söhnen und Töchtern – über uns selbst? Erziehen ohne Schimpfen – geht das überhaupt?
Auf meiner Suche nach Antworten stosse ich schnell auf den Bestseller «Erziehen ohne Schimpfen» von Nicola Schmidt. Die Erziehungsexpertin glaubt, dass Eltern mit Schimpfen jedenfalls nicht das erreichen, was sie erreichen möchten: eine Verhaltensänderung bei ihren Kindern. «Alle Studien weisen darauf hin, dass Schimpfen, Schreien oder gar Strafen nicht funktionieren», schreibt Nicola Schmidt. «Wenn wir unseren Kindern soziale Regeln beibringen wollen, müssen wir es anders angehen.»

Zeitgleich mit ihrem Buch sind zwei weitere Erziehungsratgeber erschienen: «Die Schimpf-Diät» von Linda Syllaba und Daniela Gaigg sowie «Mama, nicht schreien» von Jeannine Mik und Sandra Teml-Jetter. Alle Autorinnen sind Mütter und stellten sich irgendwann dieselben Fragen, die auch ich mir stelle.
Verbale Prügel
«Psychische Gewalt ist die häufigste Form von Gewalt gegen Minderjährige», sagt der Schweizer Psychologe und Kinderschutzexperte Franz Ziegler in einem Interview, das er vor einiger Zeit dem ElternMagazin Fritz+Fränzi gegeben hat. Laut Zieglers Definition beginnt verbale Gewalt bereits mit einem Nebensatz wie «Kapierst du das eigentlich nie?». Eltern, die ständig etwas sagen wie «Lern du erst einmal vernünftig rechnen, so blöd wie du kann man doch gar nicht sein», unterwandern die gesunde Entwicklung eines Kindes. «Ein Kind kann unter diesen Umständen kein gesundes Vertrauen in sich selbst und in andere gewinnen. Das ist ja klar. Es hört permanent: Du bist nichts und du wirst auch nichts werden», sagt Franz Ziegler. Seine Argumentation teilen auch die Autorinnen der drei Schimpf-Diät-Bücher. Sie berufen sich auf verschiedene Studien wie die der amerikanischen Universität Pittsburgh. Die Psychologen dort haben jahrelang über 1000 Familien begleitet und ihren Umgang mit ihren Kindern dokumentiert. Das Ergebnis: 90 Prozent der Eltern schimpften mit ihren Kindern, 50 Prozent taten dies auf verletzende Weise.
«Wir wünschen uns doch heute kreative Kinder mit einem guten Selbstwertgefühl. Kinder, die Nein sagen zu Drogen und zu falschen Freunden. Kinder, die sich selbst bejahen. Aber der Selbstwert kann nicht wachsen, wenn man immer wieder seelisch verletzt wird», sagt Nina Trepp, Familienberaterin aus Bern. Die 39-Jährige hat Soziale Arbeit studiert und viele Jahre als Schulsozialarbeiterin gearbeitet, inzwischen ist sie selbständig als «artgerecht»-Coach und diplomierte Körperzentrierte Psychologische Beraterin.
Um Zurechtweisung kommen Eltern nicht herum. Entscheidend ist, wie diese geschieht.
Schimpfen kann einem Kind also so nachhaltig schaden wie körperliche Gewalt. Es sind verbale Prügel. Aber wie soll es anders gehen? Wie bringe ich ein Kind dazu, mitzumachen, wenn es bockig ist?
Kinder bringen ihre Eltern oft zur Weissglut. Häufig unabsichtlich, manchmal aber auch gezielt. Kinder experimentieren. Ihre Erziehungsberechtigten reagieren darauf. Sie müssen vermitteln, wann eine Grenze überschritten wurde. Wie soll ein Kind sonst lernen, dass eine bestimmte Verhaltensweise andere verärgert? Zu Familienberaterin Nina Trepp kommen viele Eltern, die sich genau diese Fragen stellen.
Online-Dossier
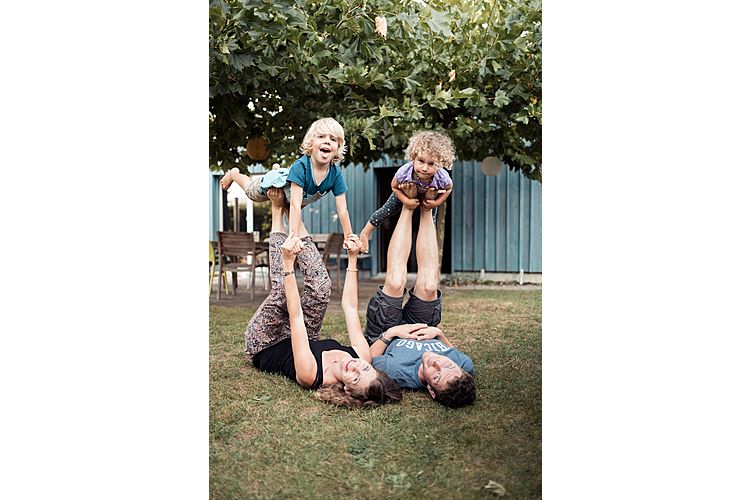
Die Situation kritisieren, nicht das Kind
«Viele Eltern sind verzweifelt, weil sie weniger schreien und schimpfen wollen, aber keinen anderen Kanal für ihren Frust finden.» Nina Trepp vermittelt, dass es nicht darum geht, dass Eltern keine Wut mehr fühlen oder zeigen dürfen. Sie erklärt das am Beispiel eines wiederkehrenden Missgeschicks, etwa eines Glases, das umgestossen wird. «Da müssen Eltern dann nicht jedes Mal ‹Ist nicht schlimm, alles in Ordnung› säuseln, wenn sie innerlich explodieren.» Die Unterdrückung dieses elterlichen Wutgefühls ist nicht sinnvoll: Kinder spüren, dass ihre Eltern nicht authentisch handeln, dass sie etwas anderes fühlen, als sie zeigen. Das verwirrt und verunsichert sie. Nina Trepp rät den Eltern, ihre Wut zu verbalisieren, aber nicht auf das Kind, sondern auf die Situation zu richten. «Mein Gott, nun stell das Glas endlich weiter weg, damit du es nicht ständig umstösst» ist okay. «Schon wieder umgestossen, was bist du doch ungeschickt!» tabu.
Ein Kind will eigentlich kooperieren, kann aber gerade nicht, weil eine andere Kraft in ihm stärker ist.
Der Unterschied ist wesentlich: Die erste Aussage zeigt nur, dass man genervt ist. Die zweite wertet das Kind ab, vermittelt ihm ein Gefühl von Minderwertigkeit.
«Um Zurechtweisungen kommen Eltern nicht herum», sagt Kinder- und Jugendpsychologe Guy Bodenmann, Professor für Klinische Psychologie mit Schwerpunkt Kinder, Jugendliche und Paare/Familien an der Universität Zürich. Kindern muss mitgeteilt werden, wenn sie eine Grenze überschritten haben. Wichtig ist laut Guy Bodenmann dabei das «Wie» der Zurechtweisung: Wie ist die Sprache, Gestik, Mimik? Drücken sich die Eltern altersgemäss und verständlich aus? Wurde klar signalisiert, was die Eltern vom Kind erwartet haben? Davon hängt ab, welchen nachhaltigen Eindruck die Zurechtweisung beim Kind hinterlässt.
Schuld ist tragisch, Verantwortung ist magisch
Die Zurechtweisung ist zudem kontextabhängig. Bei einer Gefahr im Strassenverkehr beispielsweise kann ein barscher Zuruf mitunter Leben retten. Aber auch dann ist eine Formulierung wie «Was bist du für ein doofes Kind. Ich habe dir das schon hundert Mal gesagt, aber du kapierst das nicht» eine Persönlichkeitsverletzung. Solche Aussagen bezeichnet Guy Bodenmann als «dysfunktionales Schimpfen».
Und was, wenn das nicht gelingt? Wir lauter geworden sind, als wir es sein wollten? Und vor allem beleidigend? Kann dann eine Entschuldigung die bösen Worte ungeschehen machen? Trotz bester Vorsätze passiert das schliesslich den meisten von uns. «Ich empfinde eine Aussage des Pädagogen Jesper Juul da als sehr hilfreich», sagt Familienberaterin Nina Trepp. «Schuld ist tragisch, Verantwortung ist magisch.» Wenn Eltern sich für ihre Fehler entschuldigen, falle ganz viel Belastung weg. Den Kindern gehe es besser, weil sie sich wertgeschätzt fühlten. Ausserdem wachse bei Kindern und Eltern das Verständnis füreinander und für die Streitauslöser.

In vielen, vielleicht sogar in den meisten Fällen heisst der Auslöser «Stress» beziehungsweise «Dauerstress». Die Eltern sind müde, angespannt, mit den Gedanken bei unerledigten Aufgaben – und dann macht auch noch das Kind nicht das, was es in den Augen der Eltern soll. Obwohl die Lebensumstände sicherer geworden sind und der existenzielle Stress abgenommen hat, ist der Stresslevel gestiegen. «Der Zeitdruck, der Leistungsdruck, das Multitasking haben erheblich zugenommen», sagt Guy Bodenmann. «Und dieser Mikrostress ist für uns vom Gefühl her noch verheerender.» Für die Alltagsbelastungen gebe es von der Aussenwelt beinahe kein Verständnis. Die Reaktion darauf ist oft: «Hey, ich habe auch viel um die Ohren.» Daraus resultiere, so Bodenmann, bei vielen das Gefühl, ein Versager zu sein.
Wenn man als Vater oder Mutter also ständig zu laut und verletzend wird, sagt das oft mehr über einen selbst aus als über seine Kinder. Wenn ich rekapituliere, wann zwischen mir und meinen Kindern Streit ausbricht, sind das fast immer Momente, in denen ich das Gefühl habe, Alltagsabläufe nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Ich höre mich dann manchmal Sätze sagen, die ich aus meiner Kindheit kenne und die ich eigentlich ablehne. So als ob in diesen Stressmomenten mein rationales Lösungswissen von alten Mustern überlagert wird.
Jesper Juul hat die These aufgestellt, dass Eltern zwanzig Fehler pro Tag im Umgang mit ihren Kindern machen können, ohne dass diese Schaden nehmen. Guy Bodenmann sagt: «Ein Kind, das in einem Klima von Liebe und Wohlwollen aufwächst, verkraftet es, wenn die Eltern auch mal aus der Haut fahren.» Ein Schlüsselfaktor dabei sei der Umgang mit Zeit in der Familie. «Es geht darum, wie viel Zeit ich meinen Kindern und meiner Partnerschaft insgesamt zur Verfügung stelle. Und es geht darum, den richtigen Augenblick zu nutzen und für mein Kind da zu sein, wenn es mich braucht. Es gibt Momente, da muss ich sofort verfügbar sein und meinem Kind Aufmerksamkeit schenken.»
Eine Frage der generellen Haltung
Die Lösung lautet also: Den Druck aus dem Alltag nehmen. Achtsamer mit sich selbst sein. Zeit für ein bewusstes Miteinander einplanen. Das ist natürlich leichter gesagt, als es in der Praxis umgesetzt werden kann. In den Anti-Schimpf-Ratgebern gibt es daher Programme zur Stressreduktion und Tipps, wie man sich im Alltag entlasten kann.
Die Wahrheit ist aber auch: Es geht nicht nur darum, wie entspannt Eltern ihren Erziehungsauftrag wahrnehmen. Es geht auch um die generelle Haltung gegenüber Kindern. Viele Eltern organisieren wie ich ihren Alltag nach einem straffen Zeitplan. Das Berufsleben mit Kindern funktioniert sonst nicht. Wenn mein Job-Ich auf mein Mutter-Ich trifft, kommt es allerdings zu Komplikationen. Ich erwarte oft, dass meine Kinder sich in meine Zusammenreissen-und-Weitermachen-Haltung einfügen und wie kleine Erwachsene agieren. Tun sie aber nicht. Warum sollten sie auch?
Daraus folgt aber nicht, dass ein Kind unsozial ist oder Probleme mit Regeln hat, sagt Nicola Schmidt. Ein Beispiel: Das Kind soll helfen, hilft aber nicht. Die «artgerecht»-Gründerin erklärt: «In dieser Situation sollen wir daran denken: Ein Kind will eigentlich kooperieren. Aber momentan ist eine andere Kraft stärker, vielleicht ist es müde oder einfach zu träge. Wir können das Kind nun unter Druck setzen, indem wir schimpfen.» Das, so die Familienberaterin, hilft aber höchstens, den elterlichen Druck abzubauen. Nicola Schmidt findet es sinnvoller, Verständnis für das müde Kind zu zeigen. Und sie ist überzeugt, dass Kinder, die sich so ernst genommen fühlen, dann auch eher kooperieren.
Und wenn wieder ein Nein kommt? Muss man das vielleicht einfach akzeptieren.
Wenn meine Kinder mich ansprechen und etwas von mir wollen, sage ich ziemlich oft: «Kann das kurz warten? Ich brauche noch einen Moment.» Das gleiche Recht sollte ich den Kindern zusprechen, meint Familiencoach Nicola Schmidt. Eltern sollten sich selbst bewusst machen, wie dringlich ein Anliegen ist und ob man beispielsweise ein Gespräch oder einen Auftrag verschieben kann, bis das Kind eine Spielpause macht.
Ich beherzige das in den Wochen nach dem letzten heftigen Streit. Als der nächste Besuch ansteht, plane ich Zeit und Aufgaben zusammen mit den Kindern. Ich stelle den Timer auf 30 Minuten. So lange sitze ich am Computer, so lange sollen die beiden ihre Sachen wegräumen. Die Kinder dürfen währenddessen ein Hörbuch hören, was ihre Effektivität stark einschränkt. Meine übrigens auch, denn die Geschichte ist gut. Am Ende der vereinbarten Zeit sieht ein Teil des Bodens immer noch aus wie eine Legolandschaft. Ich habe meine Arbeit nicht ganz fertig. Aber als der Besuch in unserem Chaos eintrifft, ist die Stimmung gut.

6 Tipps für eine Erziehung ohne Schimpfen
- Statt zu schimpfen: «Was bist du nur schon wieder für ein Faulpelz!», sagen wir, was wir sehen: «Deine Kleider von gestern Abend liegen noch überall herum.» Wenn das Kind nicht reagiert, können wir noch hinterherschicken, was wir uns wünschen: «Ich möchte, dass es hier ordentlich aussieht, wenn gleich Besuch kommt. Bitte bring deine Sachen weg.»
- Statt uns zu ärgern: «Jetzt hör auf, im Supermarkt herumzurennen!», bieten wir den Kindern eine Alternative: «Du kannst für uns fünf Zitronen aussuchen.»
- Statt zu nörgeln: «Nie hilfst du mir», sagen wir, was uns wirklich helfen würde: «Wenn du jetzt vier Teller und vier Gläser auf den Tisch stellst, können wir früher essen. Das wäre mir eine grosse Hilfe.»
- Statt zu rufen: «Kleckere nicht!», sagen wir, was wir wollen und was nicht: «Ich möchte, dass du über deinem Teller isst, damit die Sauce nicht auf deine Hose tropft.»
- Statt zu bestimmen: «Du ziehst jetzt die Hose an und basta!», lassen wir dem Kind eine Wahl: «Ohne Hose kannst du nicht auf die Strasse. Welche möchtest du, die blaue oder die rote?»
- Statt auszurasten und zu brüllen, ziehen wir rechtzeitig eine Grenze: «Mir ist das hier zu laut. So geht das nicht.» Und dann halten wir das Auto an oder steigen aus dem Bus aus oder verlassen das Café.
Literatur
Nicola Schmidt: Erziehen ohne Schimpfen.
Gräfe und Unzer 2019, 176 Seiten, ca. 24 Fr.
Linda Syllaba und Daniela Gaigg: Die Schmipf-Diät.
Beltz 2019, 268 Seiten, ca. 25 Fr.
Jeannine Mik und Sandra Teml-Jetter: Mama, nicht schreien.
Kösel 2019, 224 Seiten, ca. 25 Fr.

Lesen Sie mehr zum Thema Erziehen ohne Schimpfen:
- «Die Wut auf meinen Ex-Mann überträgt sich manchmal auf die Kinder»
Susanna*, 43, lebt mit ihren Söhnen Marco, 12, und Dominik, 9, in der Nähe von Chur. Die Lehrerin hat sich vor zwei Jahren vom Vater der beiden Jungen scheiden lassen. - «Meine Wutausbrüche hatten viel mit meiner Kindheit zu tun»
Dominique Eichenberger lebt mit ihrem Mann Jan und den beiden Kindern Yannick, 5, und Sophie, 3, in der Nähe von Bern. Vor zwei Jahren hat die 30-jährige Pflegefachfrau eine Familienberatung begonnen, weil sie das Gefühl hatte, bei der Erziehung von Yannick zu oft laut und grob zu werden. Auch ihr Mann hat sich beraten lassen. - «Bevor ich komplett ausraste, ziehe ich mich zurück»
Karin Lerchi, 50, ist selbständige Catering-Unternehmerin. Die alleinerziehende Mutter lebt mit ihrer 13-jährigen Tochter Alva in Zürich. Wegen Corona ist ihre berufliche Situation angespannt. Gleichzeitig fordert der Teenager Freiheiten – das provoziert Konfliktsituationen. - «Strafen bewirken keine Verhaltensänderung»
Lisa Briner und Noé Roy sind beide 28 Jahre alt. Die Buchhalterin und der Produktmanager leben mit ihren Töchtern Amélie, 4, und Inès, 2, in Bern. Sie sind jung Eltern geworden und wussten, dass sie den autoritären Erziehungsstil ihrer eigenen Elternhäuser nicht übernehmen wollten.



















