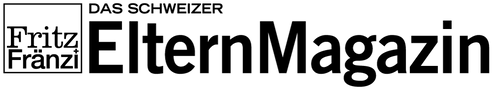Jeden Tag schulfrei
Stress mit Hausaufgaben, Notendruck und Pausenplatz-Kabbeleien: All dies kennen die drei Kinder der Familie Gantenbein nicht. Sara, Olivia und Nalin aus Herisau AR haben noch keinen einzigen Tag in einer Schule verbracht. Ihre Eltern sind die Pioniere des sogenannten Unschooling: des freiwilligen Lernens nach Lust und Laune.
Halb zehn Uhr morgens. In den Schweizer Schulen rückt die grosse Pause näher – und damit auch das Gewusel, Geschrei und Geschnatter auf den Pausenplätzen. In der grossen Küche der Familie Gantenbein dagegen ist es mucksmäuschenstill. Die drei Kinder sitzen an ihren Schreibpulten und lernen. Der 11-jährige Nalin bastelt aus Karton einen Bandrechen für seinen Traktor. Auf einer Skizze hat er aufgezeichnet, wie er aussehen soll. Olivia, 13, bearbeitet Karteikärtchen; sie lernt mit Hilfe eines Lehr- und Arbeitsbuches Chinesisch. Ihre drei Jahre ältere Schwester Sara schreibt an ihrem Roman. Auf Seite 98 sei sie bereits. Auch sie liebt und lernt fleissig Sprachen: Französisch, Englisch und Spanisch. Nalin, Olivia und Sara sind Unschooler. Sie werden weder in die Schule geschickt noch zu Hause unterrichtet. Jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Lernen im besonderen Kontext beziehungsweise Unschooling bedeutet, dass die Kinder lernen, wofür sie sich selbst interessieren, in diesem Moment, an diesem Tag; ohne fixe Unterrichtszeiten, ohne definierte Lernstoffe oder Hausaufgaben. «Kinder sind kleine Lernmaschinen, sie tragen von Geburt an den Wunsch in sich, zu lernen», sagt die Mutter, Doris Gantenbein, 43. Doch früh werde dies kaputtgemacht, weil man als Eltern, Erzieher oder Lehrer die inneren Lebensprozesse des Kindes nicht respektiere und meine, man müsse von aussen her auf das Kind einwirken und es in eine bestimmte Richtung lenken. So werde die angeborene Begeisterung des Kindes, mit Freude zu lernen, zerstört und das Kind lerne immer weniger gern, bis es schliesslich Lernen als Zwang empfinde.
«Kinder brauchen keine Erziehung und auch keine perfekten Eltern. Sie brauchen Beziehung.»
Ihr Mann Bruno, 57, arbeitet in einer Unternehmensberatung und hat sich auf Organisationsentwicklung spezialisiert. «Schule setzt auf Gleichförmigkeit und Standardisierung, was so ziemlich das Gegenteil von unserer Lebensphilosophie ist», sagt er. «Freiheit und Selbstbestimmung sind Werte, die zentral für uns sind.» In einem normalen Schulalltag hätten diese keinen Platz. Insofern sei ihr Entscheid, die Kinder nicht in die Schule zu schicken, nur die logische Konsequenz ihrer Lebenshaltung. Der Kernpunkt ihrer Lebensphilosophie ist «das Wahren der Einzigartigkeit, welche in jedem Menschen innewohnt und sich ausdrücken möchte». «Wir wollten unsere eigenen Kernkompetenzen aber nicht einfach an eine externe Schule delegieren, sondern die Verantwortung für die Bildung unserer Kinder eigenverantwortlich übernehmen», schreiben die Gantenbeins in ihrem Buch (vgl. Box am Ende des Textes). «Zudem wollten wir unsere Kinder nicht einfach wegschicken, sie von uns trennen und sie gar jeden Morgen aus dem Schlaf wecken (...). Das kam uns naturwidrig vor.»

Grosse Passion: Sara (links) und ihre Schwester trainieren jeden Tag im nahe gelegenen Eislaufstadion.
Ihnen war auch nicht bewusst, dass es diese Art von Bildung schon gab – etwa in den USA, wo der Pädagoge John Holt in den 70er-Jahren das Unschooling begründete. Auch nicht, dass sie soeben ein Haus in einem bildungsfreundlichen Kanton gekauft hatten. Tatsächlich ist in manchen Schweizer Kantonen wie etwa dem Aargau oder Appenzell Ausserrhoden die private Schulung möglich, aber bewilligungspflichtig. Vollends prüfungsbefreit sind sie nicht: Jedes Jahr müssten die Kinder Tests absolvieren, eine Art Lernerfolgsmessung. Diese hätten sie jeweils mit «sehr guten Noten» abgeschlossen, sagt Doris.
«Das staatliche Schulsystem schränkt das Kind ein»
Hierzulande gelten die Gantenbeins als Pioniere des Freilernens und coachen auch Familien, die sich für selbstbestimmtes Lernen «sowie den respektvollen Umgang mit Kindern », wie Doris sagt, interessieren. In der Tat findet dieser Lebensstil eine winzig kleine, aber wachsende Anhängerschaft. Bruno schätzt die Zahl in der Schweiz auf mittlerweile fünfzig Familien, im Raum Herisau sind es knapp zehn. Meist sind es Akademiker, Künstler, Bildungsbürger, die ihre Kinder nicht mehr traditionell unterrichten lassen wollen. Sogar ehemalige Lehrer wie Doris Gantenbein selbst gehören dazu. Sie arbeitete als Primarlehrerin – und zwar mit viel Freude im Zusammensein mit Kindern, wie sie selber sagt. «Ich merkte jedoch rasch, dass der Lehrplan kaum Raum für die unterschiedlichen Individuen zuliess und dass es letztlich nie um das Kind selber, sondern immer nur ums Einhalten der Lehrpläne ging», erzählt sie am Küchentisch, während Sara weiter an ihrem Roman schreibt, selbstvergessen und konzentriert. «Kinder sind so verschieden, haben verschiedene Talente und Interessen und entwickeln sich einfach nicht alle gleich.»
«Kinder sind die wahren Lehrmeister, weil sie noch so nahe an der natürlichen Entfaltung sind.»
Einer von vielen frustrierenden Momenten in ihrem Lehrerinnendasein war, als einer ihrer Schüler eine Klasse repetieren musste, weil er grosse Mühe mit Rechnen hatte, aber musisch hochbegabt gewesen war. «Das hat mir fast das Herz gebrochen», erinnert sie sich. In intensiver Auseinandersetzung mit alternativen Schulen, die nach dem Prinzip der nichtdirektiven Erziehung funktionieren, sind sie und ihr Mann zum Schluss gekommen, ihren künftigen Kindern ein anderes Lernen zu ermöglichen, als es in den öffentlichen Schulen stattfindet. Das staatliche Schulsystem schränke das Kind ein und fokussiere viel zu sehr auf Defizite statt auf Stärken, sagt Bruno Gantenbein. «Die Kinder verlieren die Freude am Lernen, denn wer mag schon im Dreiviertelstundentakt einen vom Lehrer vorgegebenen Stoff büffeln?» Die normierten Erwartungen, das System Belohnung und Bestrafung sowie der sinnlose Leistungsdruck seien etwas, dem sie ihre Kinder nicht aussetzen wollten. «Wir wollten unsere Kinder in einem integralen Bewusstsein aufwachsen lassen, nicht in einem rein mentalen Bewusstsein, wie es unsere Gesellschaft diktiert.»
Mentales Bewusstsein, damit bezieht sich Bruno Gantenbein auf die Studien des Kulturanthropologen Jean Gebser. Dieser sieht im integralen Bewusstsein ein neues Zeitalter aufsteigen. Im Gegensatz zum heute vorherrschenden mentalen Bewusstsein, das sich in Individualismus, Trennung und gegenseitigem Wettbewerb verliert. «Unsere Werte sind andere», sagt Bruno Gantenbein. «Selbstbestimmung, Kreativität, Gelassenheit.» Kurz: Die Gantenbeins waren der Auffassung, dass die Schule nicht der richtige Weg und Ort für eine «optimale Lernbiografie» ihrer Kinder ist. Seine eigene Schulzeit habe er als leidige Pflichtübung erlebt, erinnert sich Bruno Gantenbein. «Ich war lieber draussen». Mit 20 sei er selbst zum Unschooler geworden: «Zu jemandem, der auf seine Intuition hört und ihr nachgeht.» Am wohlsten fühle er sich in der Gesellschaft von Künstlern und Freigeistern: «Die gehen ihre eigenen Wege und realisieren ihre Träume. Das sind ganze Menschen.»

Der Gärtner im Haus: Nalin mäht den Rasen mit Sorgfalt und Begeisterung.
Auch wenn sie es nicht explizit erwähnen: Schiefe Blicke hat die Familie sehr wohl ertragen müssen. Vor 14 Jahren zu entscheiden, sich dem gängigen System zu entziehen, dazu gehört viel Mut. «Man hat uns so ziemlich alles unterstellt, von religiösen bis hin zu sektiererischen Motiven», weiss Bruno. Er sagt es mit dem Lächeln all jener, die wissen, wie es ist, gegen den Strom zu schwimmen. Heute schätzen es beispielsweise die Grosseltern sehr, dass sie ihre Enkel jederzeit besuchen kommen können, weil sie keinen durchgetakteten Tagesablauf haben. «Sie sind dann jeweils ganz erleichtert, wenn sie sehen, wie viel unsere Kinder bereits können», lächelt Doris.
Doris Gantenbein ist 24 Stunden am Tag für ihre Kinder da
Nalin ist frustriert. Über eine Stunde hat er konzentriert an seinem Bandrechen gebastelt. Doch es will einfach nicht zu dem werden, was er sich vorgestellt hat. Der Elfjährige lässt seine Arbeit fallen, Missmut im Gesicht. Seine Mutter fragt, ob sie helfen soll. Nalin hat die Nase voll und geht nach draussen, fährt mit dem Traktor herum und mäht wenig später in bester Laune den Rasen. Ganz akkurat, sogar die Ränder um die Pflanzen werden peinlich genau geschnitten, und zwar mit einem Handmäher, den er sich aus seinem mit kleinen Arbeiten in der Nachbarschaft der Freundesfamilien selbst verdienten Geld gekauft hat. In der Zwischenzeit versucht sich Doris Gantenbein am Projekt ihres Sohnes. «Aber Mama, wieso machst du das für Nalin?», fragt Sara. «Kann er das nicht selber?» Das sei jetzt aber eine wirklich schwierige feinmotorische Arbeit, findet die Mutter, sie helfe ihm gerne dabei.

Klare Haltung: Sara mit ihrer Mutter Doris Gantenbein. Die 16-Jährige treibt wie ihre Geschwister jeden Tag Sport.
Doris Gantenbein ist immer für ihre Kinder da, 24 Stunden am Tag. Hat sie überhaupt Zeit für ein Hobby, Zeit für sich? «Das brauche ich nicht», sagt sie mit einem engelsgleichen Lächeln. «Die Kinder, meine Familie und unsere gelebte Philosophie sind die Quelle meiner Kraft.» Wenn sie Zeit für sich brauche, dann stehe sie frühmorgens auf, vorzugsweise, wenn die anderen noch schlafen. In diesen Stunden widmet sie sich ihren eigenen Interessen, liest, schreibt, treibt Sport oder erledigt Hausarbeiten, «um danach wieder voll und ganz für die Kinder da sein zu können». Früh aufstehen ist bei Gantenbeins Kinder kein Thema. Wecken? Gibt es nicht. Gefrühstückt wird in der Regel um halb acht Uhr. Auch Bettzeiten kennen die Kinder nicht. «Sie gehen ins Bett, wenn sie müde sind», erzählt die Mutter. Und das sind sie, denn ihr Tag ist reich bepackt: von Chinesisch- und Spanischlernen über Sudoku, Rechnen, Basteln, Zeichnen, Trampolinspringen, Instrumentespielen, Klettern, Rasenmähen, Bücherschreiben und zwei bis drei Stunden Sport am späten Nachmittag. Die Bettzeiten richteten sich auch ein wenig nach den Jahreszeiten: «Im Sommer sind sicher zwischen 21 und 22 Uhr alle im Zimmer, im Winter früher», sagt Doris. Nie hätten sie Mühe gehabt, dass die Kinder nicht ins Bett gehen wollten.
«Wir wollten unsere Kinder nicht einfach von uns trennen, das kam uns naturwidrig vor.»
Sara wird im November 16 Jahre alt. Ihre obligatorische Schulzeit hat sie bereits hinter sich. Was jetzt? Eine sehr weltliche Frage, wie man an der Reaktion der Eltern ansieht. «Sara muss jetzt herausfinden, was sie tun möchte», sagt der Vater. «Wir lassen ihr die Zeit und haben keine Erwartungen.» Er sei sicher, dass die Kinder ihren Weg machen. «Es braucht immer wieder viel Vertrauen und Geduld», sagt Doris Gantenbein. «Wir denken jedoch nicht in Schuljahren, sonden schauen den Menschen an.» Am allerliebsten möchte Sara etwas mit Eiskunstlaufen machen. Sara kann sich aber auch vorstellen, die Matura zu machen. Dass sie wertvolle Zeit verstreichen lasse, dieses Argument zieht bei Gantenbeins nicht. «Sara bildet sich von morgens früh bis abends spät», erklärt die Mutter. «Noten und Zeugnisse verlieren mehr und mehr an Bedeutung, sie sind kein Indiz für eine Begabung.» Zumindest sei das bereits in vielen grossen Unternehmen so. Der Vater ist überzeugt, dass ganzheitliche Kinder «mit Handkuss» eingestellt würden, gerade weil sie nicht einfach einen vorgegebenen Weg einschlügen. «Der Apple-Begründer Steve Jobs und all die berühmten Leute, die etwas bewirkt haben auf dieser Welt, das waren auch keine, die dem Mainstream blindlings folgten.» Kritiker des Unschooling sagen, in der Volksschule gehe es nicht nur darum, sich Bildung anzueignen. Die Kinder lernten durch den Kontakt mit Gleichaltrigen auch, sich mit anderen Lebensstilen auseinanderzusetzen. Ob sie es nicht deshalb einmal ausprobieren wollen? «Von meinen Freundinnen, Nachbarskindern und Brieffreunden höre ich genug, wie es in der Schule so läuft», sagt Sara. «Und das klingt jeweils nicht sehr verlockend.»

«Mögen alle Wesen glücklich sein»: der Segensspruch der Gantenbeins bei den Mahlzeiten.
Ihr Bruder Nalin drückt es so aus: «Schule ist blöd. Zumindest sagen das meine Kollegen. Sie müssen immer das machen, was die Lehrperson sagt.» Olivia, die Schüchternste, geniesst an ihrem Leben ohne Schule, dass sie «einfach Zeit hat für all das, was mich wirklich interessiert». Die Kinder haben viele Freundinnen und Freunde. «Viele finden es cool, dass ich gar nie zur Schule gehen musste. Die meisten Freunde habe ich durch meine Hobbys kennengelernt. Wir gehen auch manchmal zusammen in die Stadt oder ins Kino», sagt Sara. Mittlerweile ist Essenszeit. Der Freiheitsbegriff der Gantenbeins schliesst auch ein, dass für ihr Wohlbefinden keine Tiere leiden sollen. Deshalb ernähren sie sich zu Hause ausschliesslich vegan. Doch heute schmeckt den Kindern Mamas Essen nicht so wie sonst, weil der Backofen kaputt gegangen ist und der Kartoffelgratin – Saras Lieblingsessen – nicht so cremig ausfällt. Es ist das erste (und letzte) Mal, dass die Kinder die Nase rümpfen an diesem Tag. «Eine Ausnahmesituation », wird Doris Gantenbein später sagen. «Unsere Mahlzeiten laufen immer ausgesprochen friedlich und harmonisch ab».
Doris Gantenbein über Unschooling
Unschooling ist ein vom Kind geleitetes Lernen im normalen Wohn- und Lebensumfeld der Kinder, zusammen mit ihren Eltern oder den nächsten Bezugspersonen, ohne jeden Versuch, die traditionelle Schule und ihre Lehrpläne nachzuahmen. Es gibt weder einen geplanten Unterricht noch bestimmte Zeiten für schulähnliche Aktivitäten. Themen werden behandelt, wenn das Interesse des Kindes es verlangt. Die Eltern sind weniger Lehrer, vielmehr Unterstützer und Begleiter. www.pro-lernen.ch
Die Gantenbeins haben ein Buch geschrieben: «Das Wahren der Einzigartigkeit» (Ataraxis, 2015, 343 Seiten, Fr. 27.90, E-Book Fr. 10.90). Aus diesem Buch stammen die grünen Zitate in dieser Reportage.
Weiterlesen:
- Der Kanton Appenzell ist besonders liberal bei der Bewilligung für «Homeschooling». Das Interview mit Walter Klauser, Amtsleiter Volksschule Kanton Appenzell Ausserrhoden.