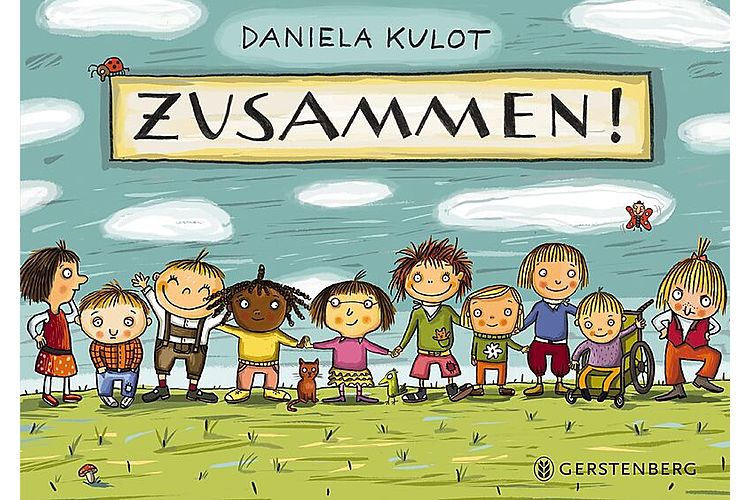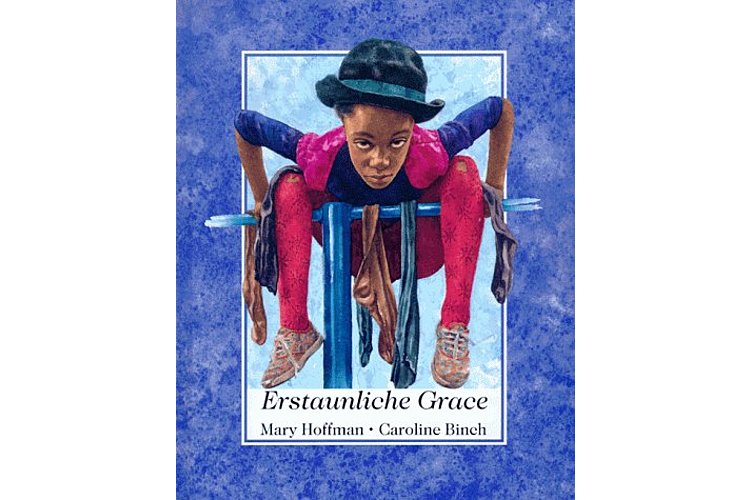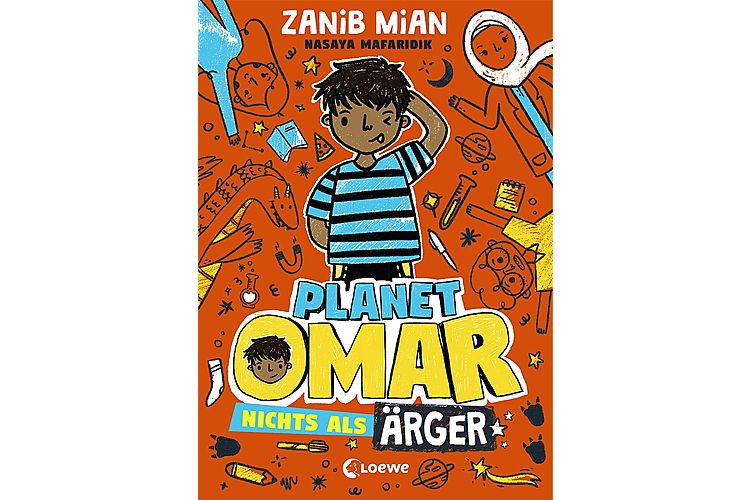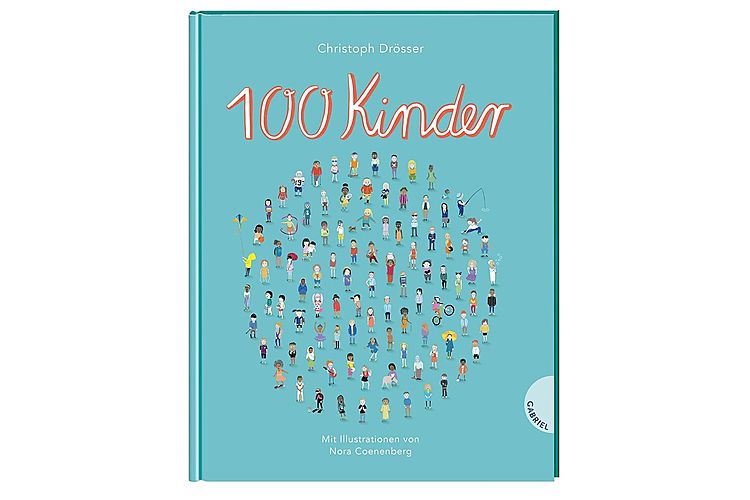Die Anlaufstellen in der Schweiz verzeichnen immer mehr Fälle von Rassismus. Viele davon betreffen Kinder. Zwei Familien berichten aus ihrem Alltag und erzählen, wie sie mit Anfeindungen umgehen.
Es poltert gewaltig im Haus von Familie Huber in der Nähe von Zürich. Kein Wunder, schliesslich rennen acht Bubenfüsse die Treppe hoch. Dann steht das Quartett in der Küche und verlangt nach Zvieri. Cornelia Huber lacht und schiebt ihren Sohn sanft zur Seite. «Dann schauen wir mal, was wir dahaben.»
Lukas runzelt die Stirn und fährt sich mit der Hand durch den dunklen Haarschopf. Der Zwölfjährige wusste immer, warum er nicht so aussieht wie seine Eltern Cornelia und Robert. Sie haben Lukas als Baby adoptiert. Geboren wurde er in Zürich, seine leiblichen Eltern stammen aus der Slowakei. Darüber, welchen Hautton sie haben, kann spekuliert werden. «Anfangs haben wir uns einfach nur gefreut, ein Baby zu haben», erzählt Cornelia Huber. «Sein Aussehen und dessen Wirkung fiel uns erst auf, als die Leute begannen, nach seiner Herkunft zu fragen.»
Das passiert heute noch regelmässig. «Schon im Kindergarten bin ich gefragt worden, welche Sprache ich zu Hause spreche. In der Schule auch immer wieder. Was soll ich da sagen? Ich rede Schweizerdeutsch», erzählt Lukas. Ähnlich geht es seinen Freunden Arian und Dorian. Die zwölfjährigen Zwillinge kamen in der Schweiz zur Welt, ihre Eltern stammen aus Sri Lanka. «Die ewige Frage danach, wo ich herkomme, nervt», sagt Dorian. «Aber rassistisch finde ich sie eigentlich nicht.»
Kinder möchten nicht «anders»sein
Das sieht
Judith Jordáky von der Zürcher Anlaufstelle Rassismus ZüRAS anders: «Die Frage «Woher kommst du?» ist rassistisch, weil sie ausgrenzend ist. Sie suggeriert, dass man nicht dazugehört.» Auch die Frage nach der Muttersprache gehöre demnach nicht mit dem Kind, oder gar in Gegenwart von anderen, thematisiert, so Jordáky. «Gerade Kinder sind sehr sensibel und möchten nicht ‹anders› sein. Stattdessen sollte man sich bemühen, zu vermitteln, dass Vielfalt nicht nur völlig in Ordnung ist, sondern auch total normal.»
575 Rassismusvorfälle wurden 2019 von 22 Beratungsstellen in der Schweiz erfasst. 352 davon wurden laut Auswertungsbericht der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus EKR und dem Verein humanrights.ch ausgewertet. Das sind mehr als doppelt so viele als noch vor zehn Jahren – wobei berücksichtig werden muss, dass sich in dieser Zeit die Zahl der Anlaufstellen fast verdreifacht hat. Knapp jeder achte Fall betrifft Kinder bis und mit 16 Jahre. 11 Prozent der gemeldeten Vorkommnisse finden in Bildungsstätten wie Schule oder Kita statt.
Davon kann auch Luana ein Lied singen. «Gaggihaut» wurde sie schon genannt auf dem Pausenplatz. Oder «Schäflihaar». Das erzählt ihre Mutter Biljana Dzemaili. Luana selbst möchte nicht über diese Vorkommnisse sprechen. «Das muss nicht jeder wissen!», sagt sie trotzig, und fläzt sich auf das Sofa zu Hause im Aargauischen. An der Wand über ihr hängt eine Zeichnung. Drei Sonnen, angeschrieben mit «Mama», «Papa» und «Luana». Der Vater des achtjährigen Mädchens stammt aus dem Senegal. Ihre Eltern haben sich kurz nach Luanas Geburt getrennt. Heute wohnt ihr Papa in der Nähe, sie haben regelmässig Kontakt. Bereits während der Schwangerschaft irritierten Biljana manche Kommentare von Bekannten. «Sprüche wie: ‹Das war aber nicht geplant, oder?› waren noch harmlos», erzählt sie. Später kamen Bemerkungen wie: «Als Alleinerziehende mit einem farbigen Kind findest du doch keinen Mann mehr.» Biljana nimmt sie gelassen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie Vorurteile dank ihrer serbo-kroatischen Wurzeln bereits gewöhnt ist. «Ich lasse mich nicht in eine Opferrolle drängen. Diese Haltung möchte ich auch meiner Tochter mitgeben: Du bist gut so, wie du bist. Lass niemand anderen bestimmen, wie du sein sollst. Mach dein eigenes Ding.»
Bei 38 Prozent der gemeldeten Rassismusvorfällen im Jahr 2019 handelte es sich um Diskriminierung gegenüber dunkelhäutigen Menschen. Eine Erfahrung, die auch Lukas immer wieder macht: «Wasch dich mal, du bist dreckig», oder «Wie ist es eigentlich in Afrika?» Er versucht, wegzuhören. Auch wenns weh tut. Jemanden zu «verpetzen» käme für ihn nie in Frage. «Es ist ja eigentlich nichts passiert.» Ein «Nichts», das dazu führt, dass Lukas lieber aussehen würde wie sein Freund Sven. Blond, blauäugig, hellhäutig. «Normal eben. Dann würden mich die Leute nicht so anstarren.»
Folgen für die Chancengleichheit
Eine Aussage, die nicht nur Lukas’ Eltern traurig macht, sondern auch Sven. «Es ist schon komisch, dass ich oft anders behandelt werde als er», sagt der Elfjährige. Auch in der Schule? Eine Studie der Universität Mannheim aus dem Jahr 2018 deutet auf Erschreckendes hin. Lehramtstudentinnen und -studenten bekamen Diktate zur Korrektur vorgelegt, eines stammte von «Murat», eines von «Max». Beide wiesen die identischen Fehler an den gleichen Stellen auf. «Murat» wurde im Schnitt um eine halbe Note schlechter benotet als «Max». Ein Fakt mit weitreichenden Folgen für die Chancengleichheit, schreiben die Macher der Studie. Denn: Wer sich von Anfang an mit tieferen Erwartungen konfrontiert sieht, versucht oft gar nicht erst, besser zu sein.
Der Austausch ist wertvoll
Ein Problem, das Lukas nicht hat. Er ist beliebt und wurde bisher von den Lehrpersonen gleichwertig und fair behandelt. Vielleicht wegen seines Schweizer Namens. Vielleicht auch, weil seine Eltern immer «mehr Präsenz markiert haben, als wenn wir ein hellhäutiges Kind hätten», wie Cornelia Huber sagt. Sie und ihr Mann Robert haben immer darauf geachtet, als Eltern von Lukas sichtbar zu sein. Sowohl in der Nachbarschaft, als auch in der Schule. Unterstützung und Entlastung erhält die Familie auch vom Schweizerischen Adoptivelternverein SAEV, bei dem sie Mitglied ist. «Der regelmässige Austausch untereinander zu Themen wie Herkunft, Erziehung oder Hautfarbe ist wertvoll. Wir können uns auch jederzeit an die Fachstelle für Pflege- und Adoptivkinder PACH wenden und werden dort kompetent beraten», so Cornelia Huber.
Im Lehrplan kamen die Themen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit als solche bisher eher am Rande vor. Aber viele Lehrpersonen nehmen sich ihm je länger je häufiger an. «Ich unterrichte Klassen mit sehr hohem Migrationsanteil», sagt Michelle Kernahan, Fachlehrerin und Lehrerin für Integrative Förderung an der Sekundarschule Kriens LU. «Rassismus ist da immer wieder ein Gesprächsthema. Auch wenn – oder gerade weil – es wahnsinnig schwierig ist, einzuordnen, was rassistisch ist und was nicht. Kids untereinander dürfen einander viel mehr an den Kopf werfen als Aussenstehende.» So sei sogar das «N-Wort» unter dunkelhäutigen Kindern vollkommen akzeptabel. «Jemand mit heller Hautfarbe dürfte es sich hingegen niemals erlauben.»
Wichtig sei eine offene Gesprächskultur, sagt die Lehrerin. «Wenn jemand sich angegriffen fühlt, wird das angesprochen und ernstgenommen.» Eine Einstellung, welche in den Köpfen vieler Leute noch nicht angekommen sei, meint Judith Jordáky von ZüRAS: «Was zählt, ist, wie etwas bei dem oder der Betroffenen ankommt. Es ist egal, ob man «es nicht so gemeint hat». Wenn eine Bemerkung oder eine Aussage jemanden stört oder verletzt, spielt es keine Rolle, wo auf dem «Rassismus-Spektrum» sie sich bewegt.»
Nicht in die Opferrolle fallen
«Gaggihaut». «Schäflihaar.» Biljana Dzemaili versucht, solchen Beleidigungen ihrer Tochter gegenüber ganz pragmatisch zu begegnen. «Ich erkläre ihr, dass Pigmente für ihre Hautfarbe verantwortlich sind. Dass diese ihre Haut vor der Sonne schützt, welche im Land, aus dem ihr Papa kommt, viel stärker brennt als hier.» Wenn sie es für nötig hält, sucht sie das Gespräch mit Lehrpersonen und den Eltern der Kinder, welche Luana beleidigt haben. Wobei sie auch da immer darauf achtet, nicht in eine «generelle Opferhaltung» zu verfallen. «Auch Luana macht mal Seich. Und den kann man nicht damit entschuldigen, dass sie anders aussieht und deshalb ab und zu angegriffen wird.» Lehrerin Michelle Kernahan machte ebenfalls schon die Erfahrung, dass mit der Andersartigkeit auch kokettiert wird. «Es kommt immer wieder mal jemand und sagt: «Sie haben mir nur eine schlechte Note gegeben, weil ich Ausländer bin»», erzählt sie lachend. Schlimm findet sie das nicht. Im Gegenteil. «Es zeigt, dass die Kinder sich des Themas bewusst werden, und nicht bereit sind, alles hinzunehmen. Dass sie versuchen, dabei etwas für sich selbst herauszuholen, ist normal bei Teenagern.»
Judith Jordáky appelliert an Lehrpersonen, das Thema Rassismus konstant im Hinterkopf zu haben, und nicht nur, wenn es aktuelle Vorfälle gibt: «Sie sind Vorbilder und müssen Gleichbehandlung vorleben.» Ins gleiche Horn bläst Dorothee Miyoshi, Mitglied der Geschäftsleitung des Dachverbands der Lehrerinnen und Lehrer Schwiz. «Wir Lehrpersonen unterliegen – und das nicht mit böser Absicht – stereotypen Denkweisen», sagt sie in einem Interview mit dem «Blick». «Diese wiederholen wir ständig und merken nicht, dass uns dabei Rassismus unterläuft.»
Rassismus, kein Randproblem
Wie wenig uns unser – im wahrsten Sinn des Wortes – «Schwarz-Weiss-Denken» bewusst ist, zeigt eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2017: 57 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer halten Rassismus in unserem Land für ein «Randproblem». «Vielleicht, weil er nicht immer auf den ersten Blick erkennbar ist», sagt Biljana Dzemaili. «Aber Luana fällt es zum Beispiel schwer, sich mit ihren Schulbüchern zu identifizieren. Weil niemand darin so aussieht wie sie. Das gleiche gilt für die Werbung.» Kürzlich habe sie nach einer dunkelhäutigen Puppe gesucht, erzählt Biljana. «Ich habe keine gefunden. Als ich den Geschäftsführer des Ladens darauf ansprach, sagte er, ich habe recht – das sei ihm noch gar nie aufgefallen. Er hat mir aber versprochen, eine ins Sortiment aufzunehmen.»
Bei Hubers ist der Zvieri verdrückt, die Buben rennen wieder nach draussen. Lukas ist gerade in die fünfte Klasse gekommen. Nicht mehr lange, und er wird sich mit der Berufswahl beschäftigen müssen. «Es wäre schön, wenn unser Sohn Chancengleichheit hätte. Sei das im Alltag, in der Schule oder bei der Lehrstellensuche», sagt Robert Huber. «Und noch schöner wäre es, wenn seine Hautfarbe irgendwann nicht mehr so eine grosse Rolle spielen würde.» Auch Biljana Dzemaili wünscht sich für Luana eine ausgeglichenere Welt: «Eine, die empathisch ist, und in der die Privilegien besser verteilt sind.» Eine Welt, in der Lukas nicht mehr sagen muss, dass er seine Hautfarbe «nur mittelschön» findet. Eine Welt, in der nicht das halbe Klassenzimmer loslacht, wenn die Klasse der Zwillinge Arian und Dorian den Film «Die schwarzen Brüder» schauen. «Weil eigentlich», sagt der zwölfjährige Dorian, «sind wir doch alle einfach Menschen. Ich weiss nicht, warum das für manche so schwer zu verstehen ist.»
Literatur zum Thema