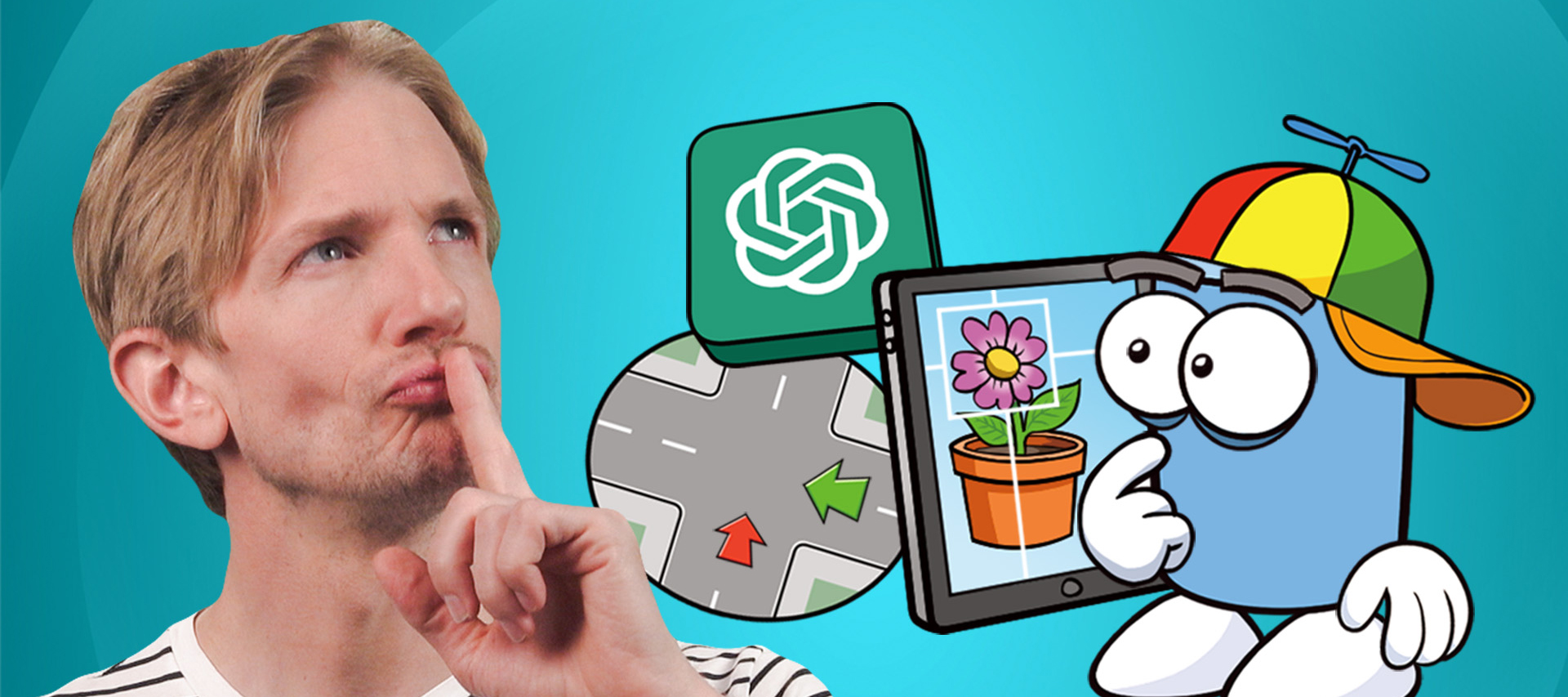«Schick mir ein Foto. Gerne im Bikini!»

Das Internet bietet Pädophilen Idealbedingungen, um unbeobachtet nach Opfern zu suchen. Wie Cybergrooming abläuft und was Eltern zum Schutz ihrer Kinder beitragen können.
Unternahm ein Pädophiler früher Annäherungsversuche bei Kindern, bestand für ihn ein erhebliches Risiko, beobachtet zu werden. Zum Beispiel von Passanten auf der Strasse. Heute bietet das Internet Tätern Idealbedingungen. Es erlaubt ihnen, sich auf der Suche nach Opfern in der Öffentlichkeit unsichtbar zu machen. «Cybergrooming» lautet dazu der englische Fachbegriff, der für die Annäherung pädophil veranlagter Menschen steht, die Kinder über das Web mit sexuellen Absichten ansprechen.
Mühelos stellen sie Fake-Profile ins Netz, mit falschen Fotos, Namen und Hobbys. Meist geben sie sich als Gleichaltrige oder als nur wenig älter aus. Die digitalen Spielplätze der Kinder zählen zu ihrem bevorzugten Revier: Tiktok, Instagram und Games mit Chatfunktion. Die Methoden der Anbahnung sind subtil: Über Wochen bauen sie eine feste Beziehung zu Buben und Mädchen auf, geben sich als empathische Freunde, Tröster und Ratgeber. Haben die Pubertierenden erst einmal Vertrauen gefasst, rücken sie bedenkenlos ihre Handynummer heraus, um miteinander über Whatsapp zu schreiben. Dass der neue «Freund» aus unterschiedlichsten Gründen nicht telefonieren kann, wird nicht hinterfragt.
Mädchen, die sich in sozialen Netzwerken in sexy Posen zeigen, haben nie das Gefühl, so bestimmte Signale auszusenden.
Laut der nationalen Plattform Jugend und Medien des Bundesamts für Sozialversicherungen wurden hierzulande bereits 13 Prozent der 12- bis 13-Jährigen, 23 Prozent der 14- bis 15-Jährigen sowie 33 Prozent der 16- bis 17-Jährigen schon einmal übers Internet von einer Person mit sexuellen Absichten angesprochen.
Ab wann sollten Eltern mit ihren Kindern über dieses Thema sprechen?
Es gibt keine klare Altersempfehlung. Spätestens sobald Kinder ein eigenes Smartphone, Tablet oder einen PC besitzen. Wer alt genug ist, ins Internet zu gehen, ist auch alt genug, mit der Wahrheit konfrontiert zu werden.
Wie konkret sollte man das Problem beim Namen nennen?
Drumherum reden ist nicht zielführend. Ich rate zu folgendem Wortlaut: «Im Internet gibt es Erwachsene, die sich mit Kindern über Sex unterhalten oder verabreden wollen. Das ist nicht in Ordnung.»
Eltern sollten ohnehin alle sechs Monate mit ihren Kindern ein Gespräch über ihr Verhalten im Netz führen, denn die Angebote ändern sich schnell und die Kinder auch. Dabei sollte Cybergrooming eines von vielen Themen sein, die den Schutz betreffen. Der wichtigste Satz: «Ruf mich, wenn dir etwas komisch vorkommt.»
Ja, wenn es zu den gemeinsam getroffenen Vereinbarungen zählt, dass gemeinsam draufgeschaut wird. Ab 10 oder 12 Jahren ist das schwierig, weil Kinder sich für private Nachrichten oder Fotos genieren könnten. Darum ist es wichtig, dass das Kind ein gutes Vertrauensverhältnis zu seinen Eltern besitzt und sie im Notfall anspricht.
Anbahnungen oder formulierte Aufforderungen sind sehr eindeutig. In so einem Fall sollten Eltern Beweise sichern, also Screenshots machen und damit zur Polizei gehen. Doch zuvor muss das Kind entlastet werden, indem ihm versichert wird, dass es keinerlei Schuld an dem Geschehen hat.
Es muss alles geheim bleiben
Wenn die Täter Kindern das Versprechen abringen, mit niemandem über ihre «Freundschaft» zu sprechen, löst das bei den Kindern und Jugendlichen kein Misstrauen aus, sondern geht als Vertrauensbeweis durch. Unaufhörlich loben die Täter ihre Opfer und attestieren ihnen eine grosse geistige oder körperliche Reife. «Wie alt bist du? 12? Du siehst ja wie 20 aus!» Eine solche Anerkennung von einem fremden Freund hat deutlich mehr Gewicht als die gewohnte Bestätigung vonseiten der Eltern. Nach und nach spornen die Täter zum Beispiel Mädchen an, sich noch freizügiger und lasziver zu zeigen, jedoch nicht bei Instagram, sondern direkt – über Whatsapp. Gerne im Bikini oder mit noch weniger an. Von all dem können Eltern nichts ahnen. Auch nicht, dass der falsche Freund durch geschickte Manipulation die Freundschaft in eine Liebesbeziehung umwandelt. Ebenfalls streng geheim. Und wer sich liebt, muss sich natürlich auch mal im «Real Life» sehen. Das ist vielleicht der Punkt, der am meisten erschreckt: Kinder und Jugendliche, die sich dann mit dem «Freund» treffen, wissen ungefähr, was passieren wird, auch wenn sie sich das nicht wirklich in allen Details vorstellen können. Ist die grosse Liebe bei der realen Begegnung nun deutlich älter, insistiert der Täter: «Aber du kennst mich doch! Wir lieben uns doch!» Das Opfer ist oft viel zu paralysiert, um zu gehen.
Die Täter sammeln Munition
Jugendliche sind meist leichte Beute. Wie alle anderen ihrer Peergroup betrachten sie das Internet und seine sozialen Netzwerke als kunterbunte Spielwiese, wo sie sich ausprobieren, mit Looks experimentieren und schauen, wie sie bei anderen ankommen. Gerade Mädchen zeigen sich auf diesen Netzwerken häufig in sexy Posen, weil das Freundinnen oder Vorbilder so machen. Sie selbst haben dabei jedoch keine Sekunde auch nur annähernd das Gefühl, auf diese Weise bestimmte Signale auszusenden. Durch Make-up, Posen und Filter streifen sie ihr Kindsein für diese Zeit wie eine Schlangenhaut ab, um in der Erwachsenenwelt mitzuspielen. Meist folgenlos. Was wäre aber, wenn ein fremder Mensch in ihnen etwas ganz Besonderes sehen würde? Jemand, der ihnen Mut macht, Kraft gibt und der sie vielleicht sogar liebt? Genau das machen sich Pädophile zunutze. Sie bauen Kinder und Jugendliche nicht nur (vermeintlich) auf, sondern sammeln dabei die ganze Zeit Munition: Mit den anvertrauten Geheimnissen, Chatverläufen oder den offenherzigen Bildern werden die jungen Opfer erpresst, falls sie etwa den Wünschen des Täters nicht zustimmen. Was diese Kinder und Jugendliche dann an inneren Konflikten durchleben müssen, ist für sie kaum verkraftbar. Bin ich schuld? Habe ich etwas falsch gemacht? Werden meine Fotos und Geheimnisse wirklich vor aller Welt ausgebreitet?