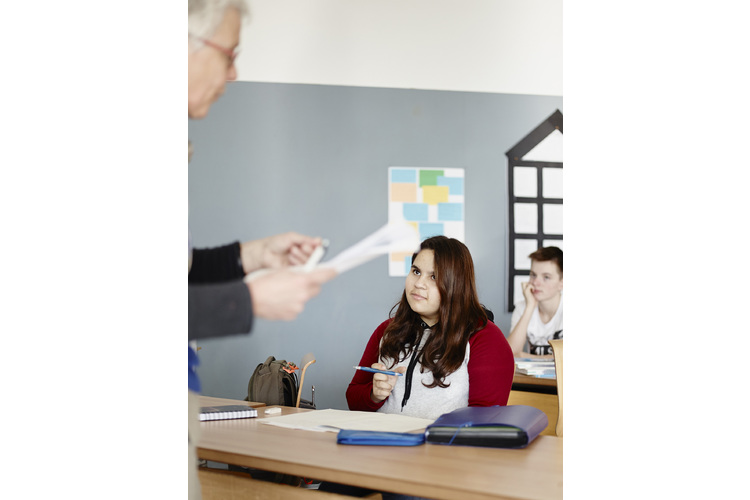Amina kommt mitten im Schuljahr in eine fremde Schule. Die 14-jährigen Mädchen, mit denen sie in vielen Fächern unterrichtet wird, haben alle ihre Cliquen gebildet und definieren sich über ihre Freundschaften. Selbst wenn es keine Sprach- und Kulturunterschiede gäbe, hätte es «die Neue» hier schwer.
Nach den ersten paar Wochen, in denen Amina eher allein unterwegs war, suchten die Lehrpersonen das Gespräch mit den anderen Teenager-Mädchen. Diese fühlten sich allerdings angegriffen und missverstanden. «Wir haben doch gar nichts gemacht», sagten sie. Das stimmte. Aktiv ausgegrenzt hatte niemand. Aber: «Man merkt an Kleinigkeiten, ob jemand integriert ist», sagt Sportlehrerin Caro Emmenegger. Wenn die Mädchen durcheinander rennen und Fangen spielen, sei alles okay. Wenn sie aber anstünden beim Hochsprung zum Beispiel, falle auf, dass sich manche lachend unterhalten und andere einfach nur allein und ruhig herumstünden.
Überhaupt machen sich die Lehrpersonen und die Schulleitung in Grosswangen sehr viele Gedanken über das Thema Integration. In der Förderklasse, die Amina am Montagmorgen gleich nach Deutsch als Zweitsprache besucht, scheint die Lehrerin sogar die Deutschübungen darauf ausgelegt zu haben, dass die Mädchen miteinander ins Gespräch kommen. Die Schülerinnen und Schüler sollen Sätze in den verschiedenen Zeiten bilden. «Als Kind habe ich », «Früher habe ich », «Jetzt mache ich », «Später werde ich » Amina und ihre Sitznachbarin bringen die Übung ruckzuck zu Ende: «Als Kind habe ich viel geschlafen», «Jetzt mache ich viele Hausaufgaben», «Später werde ich ich weiss noch nicht.» Damit haben sie zwar die korrekten Verbformen eingefügt, aber quasi nichts voneinander erfahren. Jetzt sitzen sie schweigend nebeneinander und schauen nach vorne. «Frau Marberger, was sollen wir jetzt machen?» «Ja, seid ihr schon fertig? Da darf man ruhig auch mehrere Sätze bilden! Ihr sollt einfach miteinander reden. Frag sie doch mal, wie es in der Ukraine war!», motiviert die Lehrerin.
Aminas Mitschülerin gehorcht brav. Sie erfährt, dass Aminas Schule sehr gross war. Dann sitzen beide Schülerinnen erneut still nebeneinander. «Wo wohnst du?», fragt Aminas Mitschülerin in die Stille. Sie sagt die Adresse. Wieder Stille. Dann wagt Amina selbst einen Versuch: «Was hast du an deinem Geburtstag gemacht?», fragt sie, und jetzt kommen endlich ein paar Sätze zustande, die nach einer Unterhaltung klingen. Aber es ist anstrengend. Es ist Unterricht.
Man merkt an Kleinigkeiten, ob jemand integriert ist.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Kinder auf dem Pausenplatz nicht die Sprache sprechen, ie Amina im Deutschunterricht lernt, sondern eben ihren Dialekt. Kein Wunder also, dass Amina in der Pause oft Kopfhörer trägt.
Schulleiter Urs Camenzind will nicht schön reden, was schwierig ist: «In diesen Zeiten ist es für die Kinder aus Flüchtlingsfamilien nicht leicht, Anschluss zu finden», sagt er. Es kämen gleich mehrere Schwierigkeiten zusammen: «Die Sprachbarriere, Kulturdifferenzen, aber auch eine bestimmte Grundskepsis Fremden gegenüber.» Der Widerstand, der in Deutschland gegenüber Flüchtlingen herrsche, sei auch hierzulande zu spüren – und das ginge natürlich auf die Kinder über.
Dieses Problem sei an sich nichts Neues, «aber der Anspruch hat sich verändert – also, dass Schulen die Integration in die Gesellschaft leisten sollen». Daneben betont auch Camenzind gruppendynamische Prozesse, die bei Jugendlichen in dem Alter eben normal seien. Und: «Die Persönlichkeit des Kindes spielt natürlich auch eine Rolle. Wir erleben Amina als eher zurückhaltend.»
Eine Grundskepsis Fremden und besonders Flüchtlingen gegenüber ist spürbar – auch schon bei Kindern.
Nur war sie das offenbar nicht immer. Beim Mittagessen zu Hause erzählt Aminas Mutter, wie dankbar sie dafür sei, dass sie jetzt eine Wohnung hätten und, vor allem, dass Amina eine richtige Schule besuche, eine gute Bildung bekomme. Bildung spielt in Aminas Familie eine grosse Rolle – fast alle ihre Verwandten sind Juristen oder Ärzte. Aminas Schwester studiert in der Ukraine Jura, und die Familie wünscht sich, dass Amina einmal Medizin studiert. Sie selbst ist von der Idee aber nicht begeistert und weiss noch nicht genau, was sie einmal machen will.
Nachdem Aminas Heimatstadt Donezk von den Russen eingenommen worden war, die auch das Haus der Familie zerstörten, sind sie und ihre Mutter erst einmal innerhalb der Ukraine geflohen. «Aber wer aus Donezk kommt, ist nirgendwo gerne gesehen – in anderen Städten wurde unser Auto zerkratzt, und ich fand keinen Job», erinnert sich die Mutter. Als sich dann die Möglichkeit ergab, mit einem Bus voller Flüchtlinge in den Westen zu ziehen, ergriff Aminas Mutter diese Chance. Heute ist sie stolz darauf, dass ihre Tochter so schnell Deutsch lernt. Nur eines macht ihr Sorgen: «Ich glaube, sie hat es schwer in der Schule. Früher hat Amina viel häufiger Freunde mitgebracht und ist auf andere zugegangen. Jetzt ist sie so verschlossen.»
Amina selbst kann die Sorgen all der Menschen um sie herum offenbar nicht nachvollziehen. Egal, wer sie fragt – ihre Lehrer, ihre Mutter, die Journalistin –, sie betont immer wieder, dass sie sich wohlfühle an der Schule, dass es ihr gut gehe. Trotzdem will sie nach der Schule nicht in der Schweiz bleiben. Die asiatischen Länder faszinieren sie. «Ich brauche über 100 00 Dollar, um dahizugehen», sagt sie, und das erste Mal lacht sie ganz offen. «Wissen Sie vielleicht, wie man einen Ferienjob bekommt?
An die 8000 Kinder und Jugendliche haben 2015 in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt, davon sind rund 2000 ohne Eltern als sogenannte UMAS (unbegleitete minderjährige Asylsuchende) hierher gekommen. Kinder im schulpflichtigen Alter dürfen und müssen in der Schweiz auch während ihrem Asylverfahren die Schule besuchen. Insbesondere kleinere Gemeinden schicken asylsuchende Kinder teilweise schon von Beginn an in der Regelschule
in normale Schulklassen. In Gemeinden mit mehr
asylsuchenden Kindern gibt es häufig Aufnahme- oder Empfangsklassen. Diese besuchen die
Flüchtlingskinder, bis sie das Niveau einer
Regelklasse erreicht haben. In manchen Kantonen – zum Beispiel Luzern – gibt es auch Schulen innerhalb der Asylzentren, die die Flüchtlingskinder auf den normalen Unterricht vorbereiten, bis diese auf die einzelnen Gemeinden zugeteilt werden. Andere Kantone wie Genf haben Mischlösungen: Hier werden die Kinder morgens in Spezialklassen und am Nachmittag mit den anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet. Besonderes Augenmerk liegt auf den Asylsuchenden, die älter als 16 sind, und auf jenen, die als UMAs in die Schweiz gekommen sind. Für sie gibt es in vielen Kantonen spezielle Brückenangebote und Integrationsklassen. Der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH weist darauf hin, dass die Integration von
Flüchtlingskindern nur gelingen kann, wenn bei der Bildung nicht weiter gespart werde und zusätzliche Mittel für diese Integration freigegeben würden.