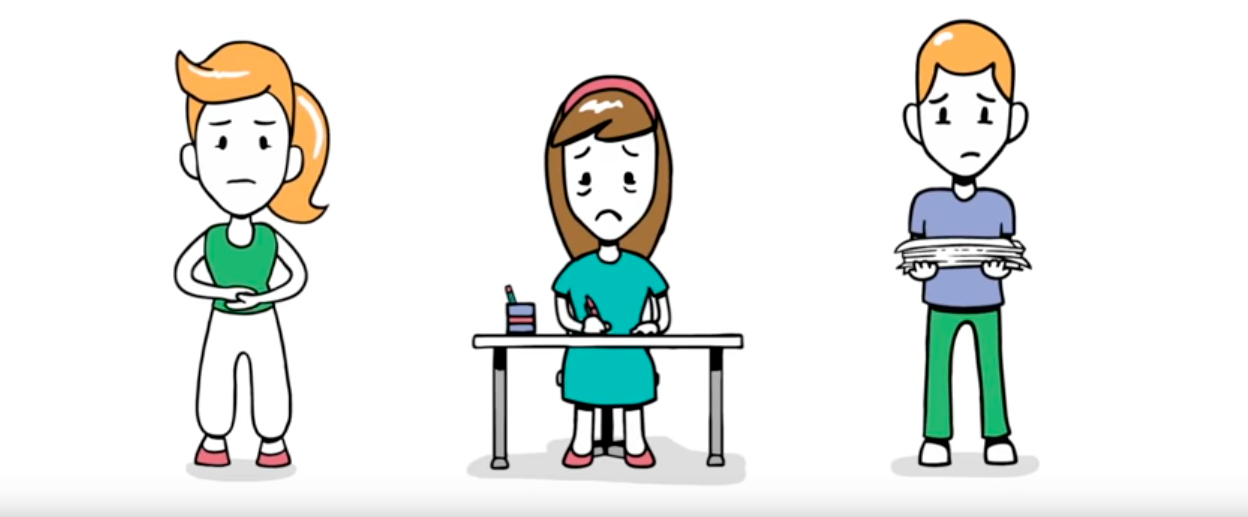Kommt das Schreiben von Hand zu kurz in der Schule?
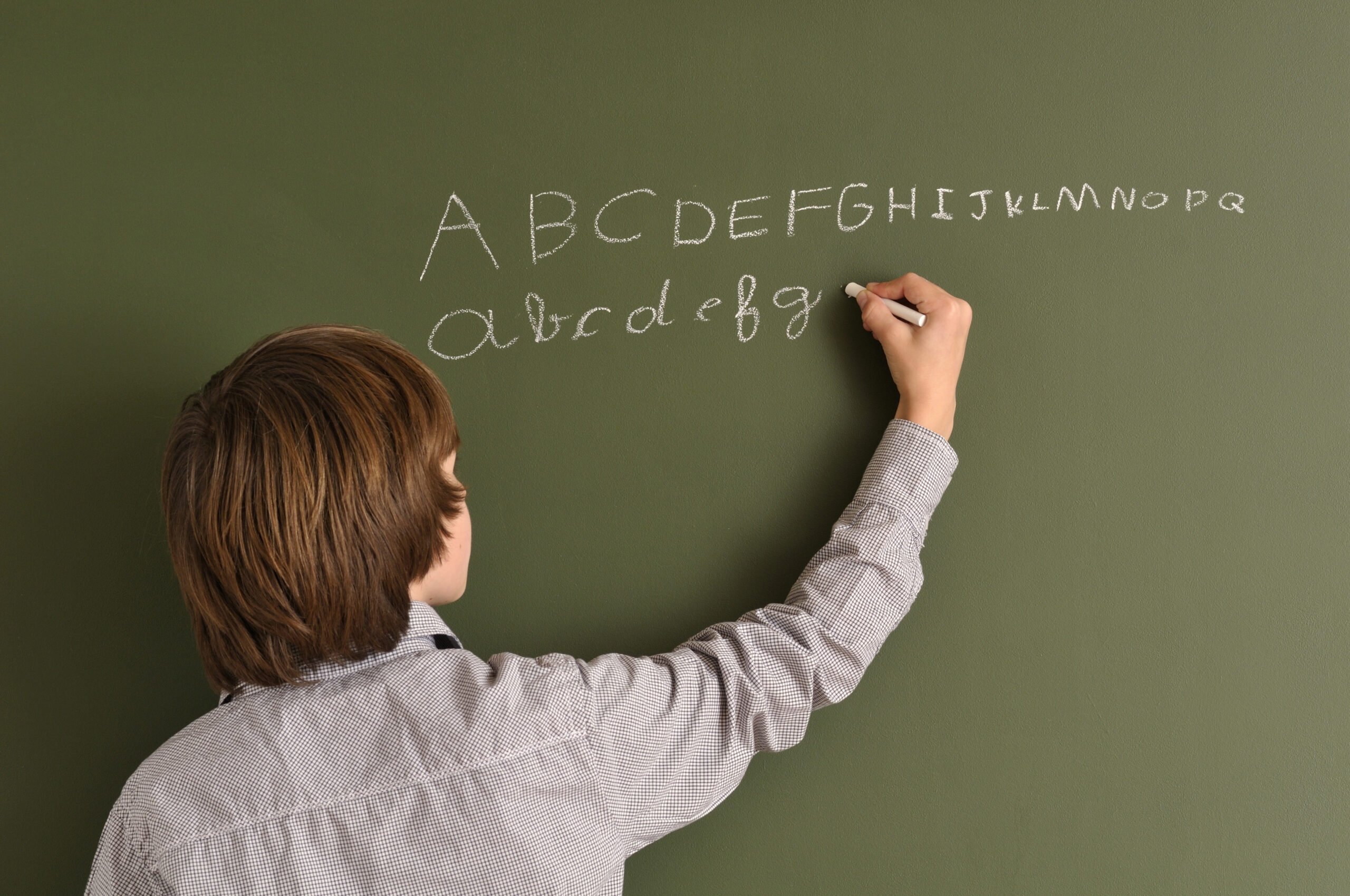
Handschrift ist Hirnschrift: Was das Erlernen der Basisschrift und das Schreiben von Hand mit Gehirnleistung und Lernerfolg zu tun haben – und warum das gute alte Schreibheft im Unterricht noch lange nicht ausgedient hat.
Kinder können immer schlechter mit der Hand schreiben – so lautet die Schlussfolgerung einer repräsentativen Umfrage unter 2000 Lehrpersonen, die der deutsche Verband Bildung und Erziehung vor wenigen Wochen veröffentlicht hat. Nach Meinung des deutschen Lehrpersonals hätten in der Primarschule rund 45 Prozent der Jungen Probleme mit dem Handschreiben, bei den Mädchen seien es 29 Prozent.
Es ist ein Ergebnis, das in der Schweiz sehr unterschiedlich aufgenommen wird. «Wir wissen um die Befunde aus Deutschland», sagt Franziska Peterhans, «und wir gehen nicht davon aus, dass die Resultate in der Schweiz anders wären.» Peterhans ist Zentralsekretärin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und hat in den vergangenen Jahren intensiv die Diskussion um die Abschaffung der Schweizer Schnürlischrift als Schulschrift erlebt, die vor allem auch eine Diskussion um den Wert des Handschreibens war.
Kinder behalten einen Buchstaben besser in Erinnerung, wenn sie ihn mit der Hand zeichnen statt ihn eintippen.
«Schönes Schreiben hat sehr lange einen unglaublichen Stellenwert gehabt», sagt Peterhans, «doch die Schnürlischrift ist besonders schwierig zu erlernen.» Das war einer der Gründe, weshalb die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz seit dem Herbst 2014 uneingeschränkt nur noch die sogenannte Deutschschweizer Basisschrift empfiehlt. Bei dieser beginnen die Kinder erst mit Blockschrift, dann werden die einzelnen Buchstaben miteinander verbunden.
Warum mit Schönschrift abmühen, wenn jeder am PC schön schreiben kann?
Ein Argument, das Lehrer heute oft hören, lautet: Was sollen sich die Kinder denn abmühen, es gibt doch Tablets und Computer, da muss man nicht gut schreiben können. «Das sehen wir ganz anders», sagt Franziska Peterhans.
Einerseits sei völlig klar, dass sich das Schreibverhalten der Kinder mit der zunehmenden Nutzung der digitalen Medien geändert habe, und auch das Tippen auf einer Tastatur zu beherrschen sei wichtig. «Andererseits ist das Schreiben von Hand und mit einem Stift eine wichtige Aufgabe, mit der die Feinmotorik trainiert werden kann.»
Handschrift fördert die Gehirnentwicklung
Alles, was mit Motorik und Bewegung zu tun hat, fördert die Entwicklung des Gehirns. Beim Schreiben mit der Hand geht es also um viel mehr als bloss die Erhaltung einer alten Kulturtechnik, und auch nicht darum, einen schön anzuschauenden Stil zu trainieren. Handschrift ist Hirnschrift. Einen Stift zu halten und zu führen, den Druck zu variieren, erfordert von unserem Gehirn eine ganz andere Leistung als Tippbewegungen auf einer Tastatur oder das Wischen auf dem Tablet.
Studien haben gezeigt, dass das Handschreiben auch beim Lernen helfen kann. So behalten Kinder beispielsweise einen, Buchstaben besser in Erinnerung, wenn sie ihn mit der Hand zeichnen statt ihn auf einem Computerbildschirm eintippen. Eine Untersuchung mit US-amerikanischen Studenten hat darüber hinaus ergeben, dass nicht nur das Lesenlernen, sondern auch das Behalten von Fakten leichter fällt, wenn von Hand mitgeschrieben wird.
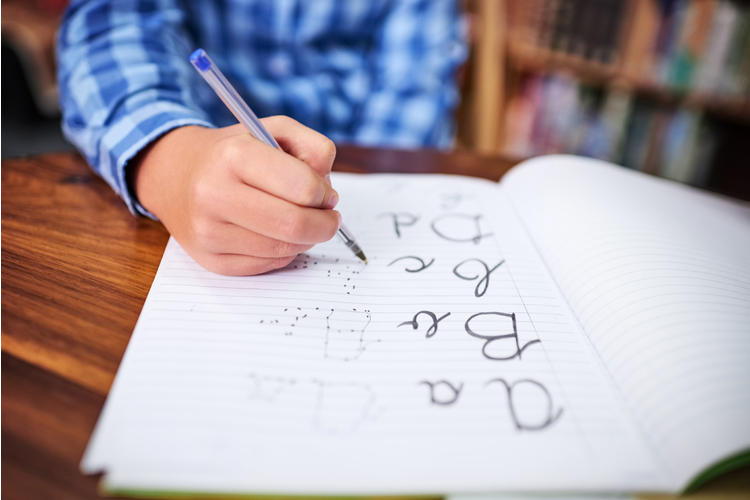
Experten vermuten, dass dafür die Kombination aus der Bewegung der Hand und dem entsprechenden Inhalt die Information anders im Gehirn verankert als beim Tippen. Schreiben ist deutlich anstrengender als Tippen. Lehrpersonen berichten von Schülerinnen, die einen Krampf in der Hand bekommen, wenn sie zehn Minuten lang einen Stift halten müssen.
Schreiben üben braucht Training
Hier hilft nur konsequentes Trainieren. «Ein Mandala auszumalen daheim ist zwar nicht unbedingt eine Übung der Kreativität, aber die Feinmotorik wird dabei bestens geschult», sagt Franziska Peterhans. Sie ermutigt Eltern und Lehrpersonen, immer wieder Angebote zu schaffen zum Malen, Zeichnen, Schreiben. «Wichtig ist es, dann dabei zu sein, nicht korrigierend, sondern teilnehmend an dem, was das Kind mit grosser Mühe und Anstrengung mit den eigenen Händen zustande bringt.»
Und vor allem die Schulen, sagt Christa Röber, müssten beim Schreibenlernen wieder mehr in die Pflicht genommen werden. Die deutsche Pädagogin und Sprachdidaktikerin beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren mit dem Schreiben. «Der Unterricht diesbezüglich hat sich massiv gewandelt», sagt Röber, «in den 50er- und 60er-Jahren wurden noch ganze Schreibhefte vollgeschrieben, um den korrekten Bewegungsablauf beim Schreiben der Buchstaben und Wörter zu üben und zu automatisieren, Pfeile zeigten an, in welche Richtung der nächste Bogen gezogen werden musste.»
An Schulen wird Schreibbewegung weniger trainiert
Seit den 70er-Jahren wird der Schwerpunkt des Schreibens auf Selbständigkeit und Kreativität der Kinder gelegt. Häufig sollen sie schon früh mit sogenannten Anlauttabellen eigene Texte schreiben. Darin werden alle Laute einer Sprache neben einem Anlaut-Bild gezeigt, also beispielsweise ein Au neben einem Auto oder ein H neben einem Hut.
So, wie in diesen Texten Fehler nicht korrigiert würden, kritisiert Röber, werde auch nur relativ wenig auf einen vorgegebenen Ablauf der Schreibbewegungen beim Produzieren der Buchstaben geachtet. «Diese kontrollierte Form der Einführung in einen jahrzehntelang bewährten Bewegungsablauf ist an den meisten Schulen gänzlich verloren gegangen», sagt Röber.
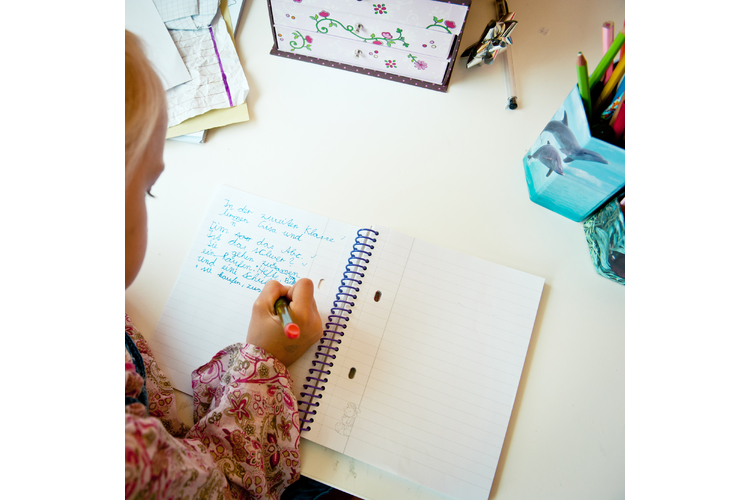
Das setzt sich auch in den höheren Klassen fort: Dort, wo für das Bearbeiten von Aufgaben nur Ankreuzen und Lückenausfüllen erwartet wird, bleibt die Beachtung des leserlichen Schreibens auf der Strecke. Die derzeitige Diskussion um den Verfall der Handschrift fällt zusammen mit internationalen Untersuchungen der Rechtschreib- und Leseleistung der Primarschüler. Laut Röber mit erschreckenden Ergebnissen: Eine steigende Zahl Kinder verlässt die Primarschule, ohne richtig lesen zu können.
Die Vorteile der Handschrift
Experten nehmen an, dass die festgestellten Defizite auch darauf zurückzuführen sind, dass sich der Fokus hin zu Selbständigkeit und Kreativität verlagert hat – auf Kosten einer sorgfältigen Hinführung zur Schrift. «Das Schreiben mit der Hand hat den Vorteil, dass die Kinder die Strukturen der Schreibungen intensiver wahrnehmen», sagt Röber. Dies diene sowohl dem Rechtschreiben als auch dem Lesen.
«Vor allem für Kinder, die etwas langsamer sind, ist der intensive Umgang mit den Wörtern beim Schreiben eine sehr wertvolle Angelegenheit.» Die deutsche Untersuchung zur Schreibfähigkeit der Kinder möchte Sibylle Hurschler differenziert betrachtet wissen. Die Schriftdidaktikerin und Handschriftforscherin der Pädagogischen Hochschule Luzern weist darauf hin, dass es sich dabei nicht um eine empirische Studie, sondern nur um eine Umfrage unter Lehrpersonen handelt. Zudem mit geschlossenen Fragen, die Teilnehmenden mussten sich also für vorgegebene Antworten entscheiden.
Grenze zwischen Handschrift und Tastatur verwischt
Empirisch belegt hingegen sei durch Studien der Pädagogischen Hochschule Luzern, dass die Schweizer Kinder mit dem Wechsel der obligatorischen Schulschrift zur Basisschrift leserlicher und geläufiger schreiben können als zuvor. «Die Kinder entwickeln aus der unverbundenen Ausgangsschrift ihre persönliche, teilverbundene Handschrift. Somit entfällt das Lernen einer zweiten Schrift», sagt Sibylle Hurschler.
Die Wissenschaftlerin hat beobachtet, dass sich in der Praxis die Grenze zwischen Handschrift und Tastatur verwischt. «Es zeigen sich immer mehr hybride Lösungen», sagt Hurschler, «bei mir sitzen junge Leute in der Vorlesung, die auf ihren digitalen Geräten ganz selbstverständlich und sehr versiert zwischen der Tastatur und dem digitalen Stift wechseln.» Vor allem bei komplexen Zusammenhängen behalten Lernende das Wissen leichter, wenn sie es von Hand aufschreiben.
Guter Handschriftunterricht befähigt die Kinder, die Schrift als Kommunikationsmittel zu nutzen.
Sybille Hurschler, Schriftdidaktikerin
«Das hat vermutlich damit zu tun, dass beim Tippen die Verarbeitung linear erfolgt, während beim Schreiben das Gehörte formatiert, sortiert und in Hierarchien eingebunden wird. Dies bedeutet, dass der Text bereits verstanden und verarbeitet wird», erklärt Hurschler. Sie plädiert dafür, dass beide Techniken – von Hand und auf der Tastatur schreiben – sinnvoll koexistieren sollten.
Und zwar so, dass sie ohne grosse Anstrengung ausgeübt werden können. Zwar gelte nach wie vor, dass Kinder leserlich schreiben lernen sollten, sagt Hurschler. «Die Geläufigkeit der Handschrift ist allerdings ebenso entscheidend, denn so wird das Arbeitsgedächtnis entlastet.» Es entstehen automatisierte Muster, welche – ohne darüber nachzudenken – abgerufen werden können, so wie beispielsweise die Hand beim Gitarrespielen die Griffe ohne Mühe findet.
«Eine automatisierte Schrift ermöglicht es also, sich auf das Verfassen des Textes zu konzentrieren», sagt Hurschler. «Guter Handschriftunterricht befähigt damit die Kinder, die Schrift als Kommunikationsmittel zu nutzen.»
Wie sieht guter Handschrift-Unterricht aus?
Und wie sieht dieser gute Unterricht aus? Aus der Handschriftforschung sei bekannt, sagt Hurschler, dass auf kurze, intensive und regelmässige Trainingsintervalle unbedingt Schreibaktivitäten folgen sollten, wo es um Textproduktion geht. Bei Buchstabenabläufen sei in dieser Phase hilfreich, anstelle von mechanischer Wiederholung bewusst die Grösse, Tempo und Krafteinsatz zu variieren und in diesem spielerischen Zugang den Ablauf zu festigen.
Wie weit ist der Bogen beim kleinen G geschwungen? Ist das kleine A schmal oder bauchig gemalt? Wird der i-Punkt tatsächlich als Punkt gesetzt, oder zeichnet der Schreiber da einen Kreis?
Auch auf einer anderen Ebene spielt die Handschrift eine Rolle: Sie ist Ausdruck der Persönlichkeit, eine Art Fingerabdruck auf Papier. So, wie uns auch Mimik und Gestik unverwechselbar machen. Wer den Stift zugunsten der Tastatur gänzlich aufgibt, verliert auch eine Möglichkeit, sich auszudrücken.
Sich hinsetzen und das Schreiben von Hand zu üben, ist eine anstrengende Aufgabe für Kinder. Versuchen Sie stattdessen, kleine Schreibanlässe im Alltag zu finden, die gar nicht erst als lästiges Üben verstanden werden können. Ein paar Vorschläge:
- Bitten Sie Ihr Kind, den Einkaufszettel zu schreiben, den Sie ihm diktieren, während sie die Vorräte in der Küche überprüfen. Lebensmittel, die es noch nicht schreiben kann, darf es gerne auch zeichnen.
- Kaufen Sie «einfach mal so» eine Postkarte, die sie an Oma, Tante oder den besten Kumpel schreiben.
- Veranstalten Sie eine Schatzsuche in der Wohnung oder im Haus, bei der über mehrere Etappen ein Hinweiszettel zu einem Versteck führt, wo wiederum ein Hinweiszettel liegt, bis schliesslich der Schatz gefunden wird. In der nächsten Runde darf Ihr Kind die Zettel beschriften und die Hinweise verstecken.
- Lassen Sie Ihr Kind für jedes Familienmitglied einen Witz auf einen Zettel schreiben, den jeder morgens neben seinem Teller oder seiner Müeslischüssel findet. So beginnt der Tag gleich mit guter Laune.
- Erfinden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind eine Fortsetzungsgeschichte. Jeder darf jeden Abend eine vorher festgelegte Anzahl an Sätzen dazuschreiben.
Informationen und Schriftbeispiele zur Deutschschweizer Basisschrift: www.basisschrift.ch
Kalligraphie und Handlettering
Die Kunst des schönen Schreibens – das bedeutet Kalligrafie, wenn man es aus dem Griechischen übersetzt. Geschrieben wird mit Feder oder Pinsel, der Kalligraf muss mit höchster Präzision und einem gut trainierten Schwung arbeiten. Das ist für ältere Kinder, die Spass am Gestalten von Buchstaben haben, durchaus erlernbar.
Einfacher und damit auch für Lese- und Schreibanfänger geeignet ist das sogenannte Handlettering. Dabei werden einzelne Buchstaben gezeichnet, gemalt oder skizziert, die Auswahl der verwendeten Werkzeuge ist gross: Vom Buntstift über Tusche und Fineliner bis zu Aquarellfarbe ist alles möglich. Sowohl die Kalligrafie als auch das Handlettering schulen die Feinmotorik des Schreibers.