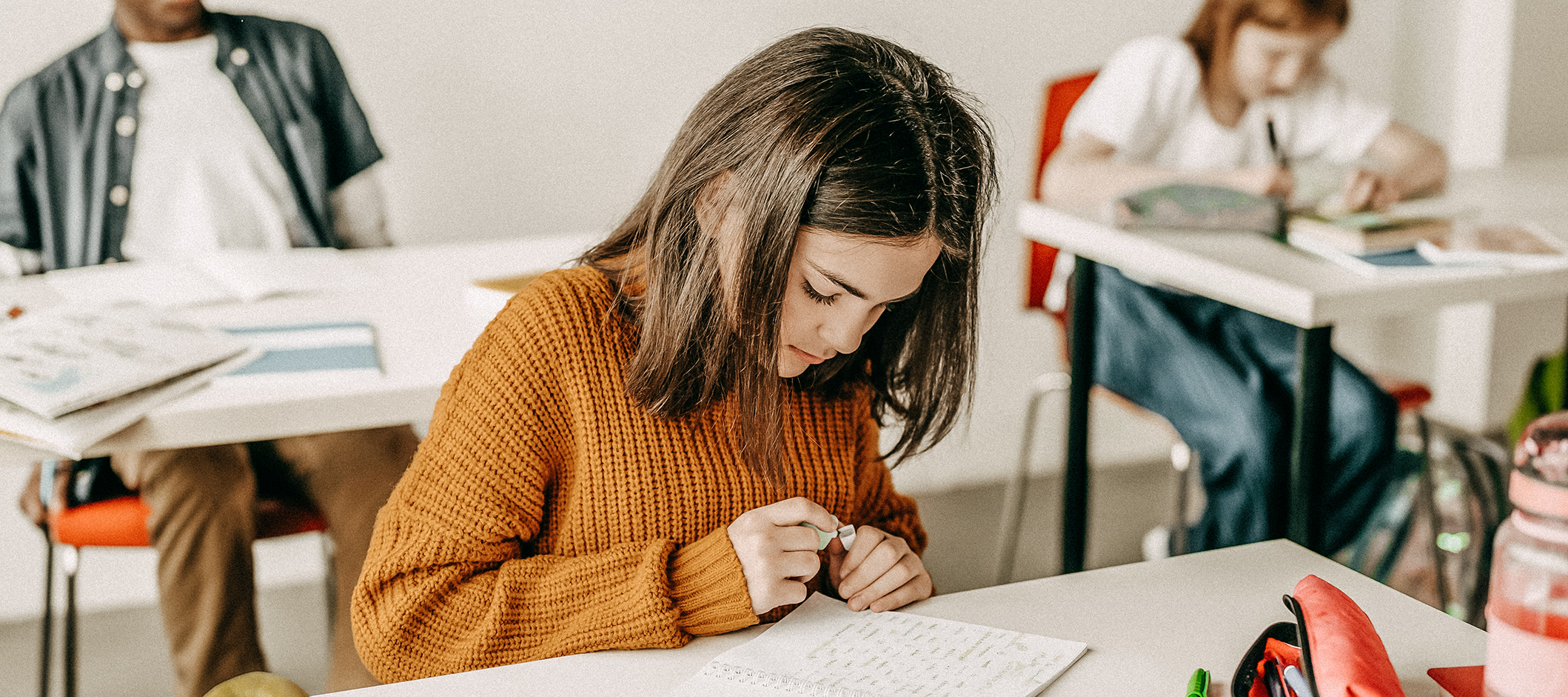Eine gute Schule: Was ist das?

Bilder: Franziska Messner-Rast
Über das heutige Bildungssystem wird gern und oft diskutiert – und geschimpft. Für dieses Dossier haben sich die Fritz+Fränzi-Lernexperten darüber Gedanken gemacht, wie Schule gelingen kann. Ihre Bilanz macht Mut.
Rund 2000 Mal macht sich ein Kind morgens auf zum Kindergarten oder in die Schule, bis es die obligatorische Schulzeit abgeleistet hat. Es sind 2000 Tage, die den weiteren Lebensweg erheblich mitprägen. Was sollen Kinder aus dieser Zeit mitnehmen? Uns treibt diese Frage seit Jahren um.
Untersuchungen wie die Pisa-Studien oder die gross angelegte Hattie-Analyse, in die Daten von 250 Millionen Schülerinnen und Schülern einflossen, erachten wir als unzureichend: Sie fokussieren fast ausschliesslich darauf, welche Testergebnisse Kinder und Jugendliche zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Bereich erzielen.
Was eine erfolgreiche Schulzeit auch ausmacht:
Neben der Leistung erscheinen uns andere Kriterien als mindestens ebenso wichtig. So finden wir es wertvoll, wenn junge Erwachsene auf ihre Schulzeit zurückblicken und sagen können:
- Ich habe vieles gelernt, das für mich persönlich relevant war und mich auf meinen weiteren Lebensweg vorbereitet hat.
- Ich weiss, wie man lernt, bin mir bewusst, dass Hindernisse dazugehören und habe in der Schule das notwendige Vertrauen in meine Fähigkeiten mitbekommen, um mich auch zukünftig an Herausforderungen zu wagen und Neues zu lernen.
- Ich habe mich in der Schule sicher und wohlgefühlt. Ich war Teil einer Gemeinschaft und habe erfahren, dass wir alle weiter kommen, wenn wir zusammenarbeiten und sich jeder mit seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten einbringen darf.
Für dieses Heft haben wir zahlreichen Kindern und Jugendlichen aus dem deutschsprachigen Raum Fragen rund um die Schule gestellt und ihre Meinungen eingeholt. Ihnen scheint über alle Schulstufen hinweg insbesondere der letzte der obigen Punkte wichtig zu sein, wie die Interviews zeigen.
Berührend klare Vorstellungen der Kinder
Mit einer berührenden Klarheit berichten Kinder und Jugendliche, was die Schule leisten sollte: David, 8 Jahre, antwortet auf die Frage nach seiner Wunschschule: «Es wäre niemand gemein. Alle Kinder würden zusammen spielen und lachen. Keiner wäre alleine. Niemand würde plagen und hauen und lügen. Die Lehrer würden zuhören und zuschauen und einem glauben. Alle wären lieb zueinander.» Und Eliane, 14, ist es wichtig, «dass man respektiert wird, nett ist und sich gegenseitig hilft».

Fragt man Kinder und Jugendliche, was ihnen an der Schule nicht gefällt, kommen immer wieder dieselben drei Aspekte zur Sprache:
- Zurückweisung und Mobbing, wie am Beispiel von Lina, 17, deutlich wird: «Ich wurde von meiner damaligen Klasse mehrere Jahre stark gemobbt. Das war so stark, dass sich soziale Ängste entwickelt haben und ich letztendlich nicht mehr zur Schule gehen konnte. Als wir dann die Schuldigen anzeigen wollten, hat mir der Lehrer gedroht, dass durch eine Anzeige alles schlimmer werden würde.»
- Leistungsdruck und Angst vor Bewertung. Simon, 9, sagt, dass er am liebsten nicht mehr zur Schule gehen würde: «Jeden Tag Prüfungen und schlechte Noten.»
- Eine angespannte Beziehung zur Lehrperson. David, 8, beschreibt seine Lehrerin so: «Wenn jemand etwas nicht versteht oder Fragen stellt, dann packt sie die Kinder und zerrt sie in den Gang. Sie schreit auch immer.»
Natürlich haben Schülerinnen und Schüler auch ihre Vorstellungen von gutem, spannendem Unterricht. Dieser sollte, wie ein Grossteil der interviewten Kinder und Jugendlichen betont, morgens später beginnen. Janis, 12, wünscht sich einen «Forscherclub», Ilias, 8, würde gerne «mehr draussen experimentieren» und Josephina, 16, möchte «keine Hausaufgaben, mehr Teamwork und Themen erarbeiten – nicht so viel Theorie».
Ela, 9, hätte sogar gerne ein neues Fach: «Ich möchte Kindern in armen Ländern und Heimen helfen. Es wäre schön, wenn es ein Fach gäbe, in dem man für arme Kinder bastelt, Sachen verkauft und das Geld immer armen Kindern schickt.» Auch gemeinsame Unternehmungen wie Exkursionen, Projektwochen, lokale Einsätze für die Umwelt, Klassenlager, Ski- und Wandertage werden sehr geschätzt.
Ihre Ansprüche an eine gute Schule bringen die Kinder und Jugendlichen deutlich zum Ausdruck: Zur Schule geht man gerne, wenn man verständnisvolle, geduldige, humorvolle Lehrpersonen hat, sich in einer Klasse akzeptiert und unterstützt fühlt, auf eine anregende Lernatmosphäre mit Freiräumen und Mitbestimmungsrecht bauen darf und keine Angst vor Abwertung und schlechten Noten haben muss.
Eine «produktive Unzufriedenheit» treibt viele Lehrpersonen an
In unserem Alltag treffen wir auf viele inspirierende Lehrpersonen und Schulleitende, deren Vision von Schule erstaunlich ähnlich klingt wie die der Schülerinnen und Schüler – und die täglich daran arbeiten, diesen Zielen näher zu kommen. Was uns dabei überrascht: Es sind sehr unterschiedliche Menschen, die ihren Unterricht auf sehr eigene Art gestalten. Manche setzen fast ausschliesslich auf Frontalunterricht, andere stellen das selbstorganisierte Lernen ins Zentrum. Was sie verbindet, ist eine innere Haltung.
Sie sind neugierig, suchen nach eigenen Wegen und haben oft etwas an sich, das wir als «produktive Unzufriedenheit» bezeichnen: Sie sehen die Probleme, wissen aber gleichzeitig, wie bedeutsam ihr Beruf ist und wie viel Handlungsspielraum sie haben, den sie zugunsten der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen ausschöpfen möchten. Und sie investieren viel Zeit und Energie in die Beziehungen – zwischen ihnen und den Lernenden, aber auch innerhalb der Klasse.
Lehrpersonen unterrichten im Wesentlichen Menschen
Wo können wir ansetzen, damit sich Schulen in eine positive Richtung entwickeln? Unserer Meinung nach kann das nur gelingen, wenn wir den Emotionen, die das Lernen begleiten, mehr Beachtung schenken.
Lerninhalte und das didaktische Vorgehen haben in der Aus- und Weiterbildung einen so hohen Stellenwert, dass sich Lehrpersonen zwar viele Gedanken dazu machen, wie sie etwas vermitteln und die Stunden konzipieren möchten, sich aber zu selten fragen, wie die Schülerinnen und Schüler sich während des Unterrichts fühlen.
Die Lehrerin und Theaterpädagogin Maike Plath (siehe Interview) schreibt dazu in ihrem Buch «Spielend unterrichten und Kommunikation gestalten»: «Lehrerinnen und Lehrer sind Experten in ihren studierten Fächern und in Fragen der Didaktik.

Dabei wird aber vergessen, dass sie nicht einfach nur Mathematik, Geschichte oder Englisch unterrichten – im Wesentlichen unterrichten sie Menschen.» Um diesen Aspekt zu verdeutlichen, nutzen wir bei Lehrerfortbildungen eine etwas gemeine Übung: Wir stellen den Lehrpersonen in der Gruppe simple Rechenaufgaben wie «26 + 34 = ?» oder «7 × 8 = ?». Es dauert meist nicht lange, bis sich Unruhe und Unwohlsein ausbreiten, einzelne Teilnehmende nervös auf den Stühlen herumrutschen und eine der unerwartet aufgerufenen Personen mit knallrotem Kopf murmelt: «Äh … ich kann überhaupt nicht nachdenken!»
An dieser Stelle brechen wir das Kopfrechnen ab und sprechen in der Gruppe darüber, welche Gedanken und Gefühle die Übung ausgelöst hat und an welche Erfahrungen sie erinnert wurden. Dabei wird deutlich, dass sich bei vielen Lehrpersonen ein Gedankenkarussell in Gang setzt: «Alle starren mich an», «Ich kann das nicht», «Was denken meine Kollegen, wenn ich das nicht lösen kann?», «Oh Gott, wie peinlich, das ist genauso wie damals, als wir diese furchtbaren Rechenspiele im Unterricht machen mussten».
Negative Gefühle stehen dem Lernprozess im Weg
Es handelt sich durchwegs um Aufgaben, die die Lehrpersonen problemlos lösen könnten. Doch die aufkommende Angst und Scham blockiert viele von ihnen so stark, dass sie nicht mehr klar denken können. Neben dem Inhalt wird somit immer auch abgespeichert, welche Gefühle ein bestimmtes Fach in uns auslöst – mit teilweise schwerwiegenden Auswirkungen auf komplexe Denkprozesse oder die Kreativität.
Auf die Frage, wie sie ihre eigene Schulzeit erlebt haben, hören wir in Weiterbildungen von Lehrpersonen immer wieder ähnliche Aussagen. Zum Beispiel: «Unser Matheunterricht hat mir in erster Linie gezeigt, dass Mathe Begabungssache ist, ich sowieso zu langsam und zu blöd dafür bin. Unser Lehrer hat mit den vier begabten Klassenkameraden den Unterricht gestaltet und wir anderen haben uns irgendwann ausgeklinkt.»
Oder: «Ich hatte acht Jahre Französisch. Wir haben vom Subjonctif bis zum Passé simple so ziemlich alle Spezialfälle der Grammatik durchgekaut. Ich kann Bücher von Albert Camus lesen, bin aber so gehemmt und darauf fixiert, keine Fehler zu machen, dass ich mir in Frankreich nicht einmal einen Kaffee bestellen kann.» Vielleicht wurden diese Lektionen minutiös durchgeplant, auf den Lehrplan abgestimmt und die Prüfungen sorgfältig korrigiert.
Es erfordert Mut, sich der Frage zu stellen: Was lernen die Kinder in meinem Unterricht wirklich? Was erfahren sie über sich und ihre Fähigkeiten?
Wenn aber das, was davon bei den Schülerinnen und Schülern hängenbleibt, ein Gefühl von Widerwillen, Inkompetenz, Angst und Scham ist, hat all der Einsatz mehr geschadet als genützt. Es ist hart, sich dies einzugestehen und erfordert Mut, sich der Frage zu stellen: Was lernen die Kinder und Jugendlichen in meinem Unterricht wirklich? Was erfahren sie über sich und ihre Fähigkeiten? Welche Beziehung bauen sie zu meinem Fach auf? Habe ich in meiner Klasse ein Klima herstellen können, das es Kindern erlaubt, sich ohne Hemmungen zu melden und den Unterricht mitzugestalten?
Lehrpersonen sind oft starken Sachzwängen ausgesetzt: «Ich muss den Lehrplan durchkriegen!», «Ich brauche noch Noten fürs Halbjahreszeugnis », «Die ganze Bürokratie erstickt mich».
Dadurch gerät das Wichtigste regelmässig in den Hintergrund. Genau an diesem Punkt ist die innere Haltung entscheidend. Im Gespräch mit Lehrpersonen und Schulleitenden, die wir schätzen, fällt uns immer wieder auf, dass sie sich von diesen Sachzwängen freimachen und ihre Prioritäten bewusst anders ausrichten. Das fängt oft bei den Zielen an. Diese Lehrpersonen wissen, was ihnen wichtig ist und verschreiben sich Zielen wie: «Im Turnunterricht will ich den Kindern Freude an der Bewegung vermitteln.» Oder: «Ich will, dass jedes Kind in seinem Tempo lernen kann und Fortschritte erleben darf.»
«Es ist mir wichtig, Zuversicht zu vermitteln»
Eine dieser Lehrpersonen ist Renate Jaggi. Sie unterrichtet an einer integrativen Schule in Biel und definiert ihre Aufgabe wie folgt: «Das Wichtigste, das ich meinen Schülern und Schülerinnen mitgeben möchte, ist möglichst viel Zuversicht: die Zuversicht, dass vieles, oft mehr als gedacht, möglich ist und werden kann. Die Zuversicht, selbst etwas bewirken, verändern zu können. Die Zuversicht, dass nebst der Familie in der Schule immer auch noch andere, Erwachsene und Kinder, da sind, die einen mit Wohlwollen und Interesse an positiver Entwicklung begleiten und unterstützen.»

Dafür hat Renate Jaggi eine Vielzahl von Methoden entwickelt. Sie erzählt: «Wir stellen uns beispielsweise morgens unsere erwünschte Zukunft vor, indem wir überlegen, was wir abends am Tisch zu Hause gerne erzählen würden, wobei wir auf konkret umsetzbare, kleine Schritte setzen. Die Kinder mögen und beherrschen dieses ‹So-tun-als-ob›. Zum Beispiel: ‹Heute ist es mir gelungen, ruhig zu bleiben und den Auftrag ein zweites Mal zu lesen, anstatt gleich die Lehrerin zu fragen. Das war nützlich, weil …› Oft ist die Wirkung frappant, was für mich enorm berührend ist.»
Willkommen seien bei den Schülerinnen und Schülern auch sogenannte Gratistipps, erzählt die Lehrerin weiter, kleine Hinweise, die sich die Kinder gegenseitig geben, damit ihnen diese Schritte gelingen. Jaggi: «Eine gemeinsame Sammlung hilfreicher Strategien in besonders heiklen, anspruchsvollen Situationen zur Verfügung zu haben, erachte ich als viel wirksamer als jedes Belohnungs- und Bestrafungssystem, erleichtert es uns doch, unsere Würde zu erhalten beziehungsweise wieder zu finden, Fehlverhalten in Ordnung zu bringen und untereinander wieder in positive Beziehung zu treten.
Wenn wir eine Schule möchten, die die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt, sollten wir nicht gegen das System kämpfen, sondern für die Schule.
Dies gilt im Übrigen nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich selbst. Besonders nützliche Tipps für schwierige Situationen haben wir gemeinsam kreiert, aufgeschrieben und beispielsweise in einen umgebauten Kaugummi-Automaten gesteckt. Wer nicht weiterkommt, kann sich einen Tipp aus dem Automaten holen. Wir trainieren in der Klasse auf verschiedenste Weise, uns selbst und andere wertschätzend zu beobachten, als ‹Ressourcen- Detektive› gegenseitig Fähigkeiten zu entdecken, Anstrengungen und Fortschritte – und seien sie noch so klein – zu bemerken und diese letztlich auch einander rückzumelden.»
Wenn wir von solchen Beispielen erzählen, kommt fast unmittelbar der Einwand von anderen Lehrpersonen: «Das ist ja schön und gut, aber dafür fehlen mir die Zeit und die Ressourcen.» Das ist ein Trugschluss. Durch die Bank alle Lehrpersonen, die aktiv an einem guten Klassenklima, der Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern und dem Aufbau von Kompetenzen im sozial-emotionalen Bereich arbeiten, betrachten dies als Investition, die sich auszahlt.
«Wir wollten keine Ghettoisierung»
Der Förderlehrer Werner Fessler, den wir über sein Lehrmittel «Atlas Mathematik» kennengelernt haben, stellte gemeinsam mit zwei weiteren Lehrpersonen den gesamten Unterricht auf individualisiertes, entwicklungsorientiertes Lernen um. Sie entwickelten eigenständig Material, das es jedem Kind erlaubt, an Aufgaben zu arbeiten, die seinem Leistungsstand entsprechen. Ein ungeheures Unterfangen! Er sagt dazu: «Wir wollten keine ‹Ghettoisierung› oder Diskriminierung, wie das manchmal mit Sonderklassen oder der Sek C passiert ist.
Das waren Sammeltöpfe für schwierige, randständige Kinder. Von denen gab es bei uns viele, und die konnten bei uns gerne und in aller Ruhe in die Schule kommen. Die Kombination aus Altersdurchmischung und einer konsequenten Ausrichtung auf individualisierten, entwicklungsorientierten Unterricht hat Vorteile gebracht: Disziplinarisch wurde es ruhiger, Unterrichtsstörungen und Gewalt nahmen ab. Das war für alle eine tolle Erfahrung.»
Wir alle sind «das System», das sich schwer tut mit Veränderungen
Einfacher wird es, wenn die Schulleitung solche Bestrebungen unterstützt. Daniel Weibel, Schulleiter in Ersigen BE und Vorstandsmitglied im Berufsverband VSL Bern betont: «Hier sind Schulleitungen unbedingt gefordert. Die Überforderung können sie massgeblich minimieren, indem sie Prioritäten setzen, Freiräume nutzen und Ballast entsorgen. Eine Lehrer- und Lehrerinnenkonferenz, zum Beispiel, sollte einen klaren Gewinn für alle bedeuten, sonst muss sie gestrichen werden.»
Oft hören wir von Eltern die Klage, dass sich «das System» nicht ändere und es «doch nicht sein kann», dass sich die Schule nicht schneller wandelt. Dabei wird oft übersehen, dass es eine Aufbruchstimmung bei vielen Menschen im schulischen Kontext gibt, dass sich der Wandel an vielen Orten vollzieht und gleichzeitig wir alle «das System » sind, das sich schwer tut mit Veränderungen.
Fast alle progressiven Menschen, die wir in den letzten Jahren kennenlernen durften, mussten sich gegen teils massive Widerstände von Seiten ihrer Kollegen, Behörden, vor allem aber der Eltern durchsetzen. Es verlangt Mut, Ausdauer, ein dickes Fell, Selbstvertrauen und Engagement, um über das Bestehende hinauszugehen.
«Bei mir können alle so lange lernen, bis sie es können»
Der mittlerweile pensionierte Mathematiklehrer und Professor für Mathematikdidaktik Peter Geering, der das Programm «Atlas Mathematik» mitbegründet hat, erinnert sich: «Freiräume hat man, wenn man sie sich nimmt. Meine Schüler haben früher bei einem Misserfolg in Mathematikprüfungen oft gesagt ‹das war Pech› oder ‹ich hatte einen schlechten Tag›, und damit war das Thema erledigt. Irgendwann habe ich entschieden, dass sie Prüfungen wiederholen können, wenn sie mit der Note unzufrieden sind.

Dadurch konnte ich ihnen antworten: Ja, da hattest du einen Misserfolg. Versuche es doch noch einmal. Wenn du magst, helfe ich dir bei der Vorbereitung. Dafür wurde ich natürlich auch angegriffen. Ein Aufsichtskommissionsmitglied wollte mir das nicht durchgehen lassen, weil ich in meiner Klasse in der Probezeit keine ungenügende Durchschnittsnote in Mathe vergeben hatte. Ich sagte dem Herrn: «Das ist so – bei mir können alle so lange lernen, bis sie es können.» Nicht jedem ist es gegeben, sich auf diese Art bei Vorgesetzten unbeliebt zu machen.
Wie herausfordernd ein Wandel im Schulsystem ist, zeigt sich auch bei zwei Forderungen, die wir persönlich gerne unterstützen: Die Abschaffung der Hausaufgaben und der Noten in den ersten Schuljahren.
Hausaufgaben und Noten: Kann das weg?
Im Kanton Bern gibt es mittlerweile an den meisten Schulen keine Hausaufgaben mehr. Diesem Schritt gingen teils heftige Proteste aus der Elternschaft voraus: «Wir kriegen gar nichts mehr mit aus der Schule!», «Die Lehrer wollen uns rausdrängen!», oder «Wie soll ich jetzt wissen, wo mein Kind steht?», hiess es.
Das Thema Noten ist mindestens so umstritten. Dabei ist es keinesfalls so, dass Lehrpersonen geschlossen an der Notengebung festhalten möchten. Viele empfinden das ständige Schreiben von Prüfungen, das Vermessen der Kinder und die unzähligen Stunden, die sie mit Korrekturen verbringen müssen, als Belastung. Zudem zweifeln viele Lehrpersonen, ob diese Art des Feedbacks sinnvoll ist. Sie sehen, wie schwächeren Kindern jegliche Motivation abhandenkommt, wenn sie immer wieder die Erfahrung machen müssen, nicht zu genügen.
Roland Bosshart, Schulinspektor im Amt für Volksschule Thurgau, spricht von einem Dilemma: «Man ermutigt Kinder, bestärkt sie in dem, was sie schon können. Dann zwingt man sie, eine Prüfung zu schreiben und lässt das Fallbeil Note fallen. Schliesslich erklärt man einigen von ihnen, warum sie «schlecht waren» und muss sie wieder aufrichten. Darunter leiden viele Lehrpersonen.»
Konservative Kräfte steuern gegen eine Abschaffung
Doch Noten einfach abzuschaffen, ist nicht so leicht. Selbst wenn es nur darum geht, auf eine Benotung in der Unterstufe zu verzichten, regt sich massiver Widerstand. Bürgerlich-konservative politische Kräfte steuern nach wie vor gegen eine Abschaffung der Noten, meist mit der Begründung, dass diese der Disziplin und Leistungsmotivation zuträglich seien. Dass diese Haltung mehrheitsfähig ist, zeigen Abstimmungen: Im Kanton Appenzell sprachen sich zuletzt 67 Prozent, in Genf sogar 75 Prozent der Abstimmenden für ein Notenobligatorium in der Primarschule aus.
Es ist noch ein weiter Weg, bis eine kritische Masse darauf vertraut, dass Kinder lernen wollen und nicht dazu gezwungen werden müssen. Rückmeldungen sind für den Lernprozess unabdingbar. Wirklich nützlich sind sie dann, wenn sie den Schülerinnen und Schülern aufzeigen, wo sie stehen, an welcher Stelle sie Mühe haben und wie sie sich verbessern können. Nur wenn Zeit zur Verfügung steht, um Lücken zu schliessen und Nichtverstandenes aufzuarbeiten, tragen Bewertungen massgeblich zu Lernfortschritten bei. Prüfungen und Noten, wie sie aktuell gestaltet werden, leisten dies in den seltensten Fällen.
Der Diskurs darüber, was gute Schule leisten sollte und wie der Weg dorthin aussehen kann, muss immer wieder neu geführt werden. Dabei sollten wir uns nicht blind auf «Bildungsexperten und -expertinnen» stützen, die lediglich Idealbilder beschwören, ohne praktische Wege aufzuzeigen. Vielmehr sollten auch die Stimmen derer eingefangen werden, die diese Themen tagtäglich in der Praxis betreffen: Lehrpersonen, Lernende und Eltern.
Auch Eltern können einen Beitrag zum Wandel der Schule leisten
Wenn wir eine Schule möchten, die den Bedürfnissen der Kinder Rechnung trägt, sie da abholt, wo sie stehen, sich an ihren Stärken und Interessen orientiert, dann sollten wir nicht «gegen das System» kämpfen, sondern für die Schule. Für gute Ideen, konkrete, praktische Schritte, und eine Politik, die den Schulen das zur Verfügung stellt, was sie braucht. Für ein gesellschaftliches Klima, das jungen, idealistischen Menschen Lust macht, die Lehrerausbildung in Angriff zu nehmen und das die engagierten, erfahreneren Lehrpersonen soweit unterstützt und wertschätzt, dass diese bis zur Pensionierung im Beruf bleiben möchten.
Als Eltern darf man sich ab und zu selbstkritisch fragen: «Wann habe ich zuletzt einer engagierten Lehrperson eine positive Rückmeldung gegeben oder sie vor anderen verteidigt? Habe ich bei der letzten Wahl darauf geachtet, Politiker beziehungsweise Politikerinnen zu wählen, die meine Interessen im Bereich Bildung vertreten und bereit sind, die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen?
Inwiefern bringe ich mich positiv in die Entwicklung der Schule meines Kindes ein, indem ich mich zum Beispiel im Elternrat engagiere, Gesprächsanlässe nutze, Projektwochen unterstütze oder Veranstaltungen mitorganisiere? Gebe ich der Schule meiner Kinder eine Chance, Neuerungen und Experimente zu wagen oder gehöre ich zu den Eltern, die sofort den Teufel an die Wand malen und Unterschriften sammeln, wenn jemand etwas bewegen möchte?
Den Lehrerinnen und Lehrern unter Ihnen möchten wir das folgende Zitat von Maike Plath mit auf den Weg geben: «Lehrkräfte sollten sich nicht länger als Opfer eines Systems begreifen, sondern als die Akteurinnen und Akteure der nächsten relevanten Emanzipationsbewegung. Dafür sollten wir uns zusammentun und kooperieren, statt einsam jeden Tag das Unmögliche zu versuchen.»