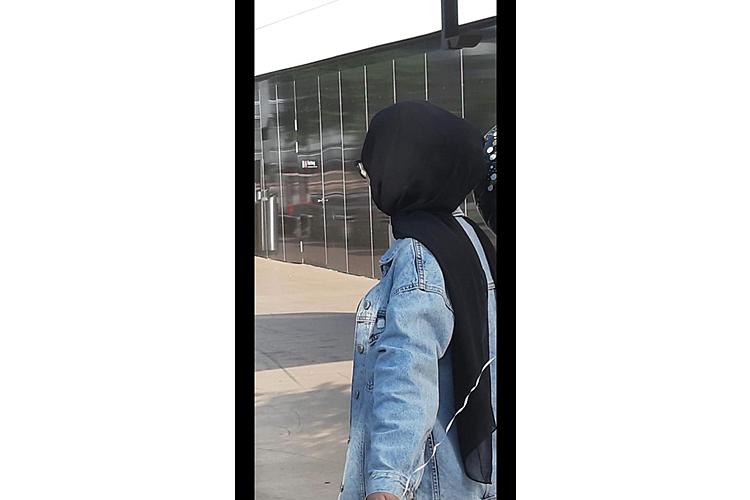Wenn Kinder Krieg erleben und fliehen müssen, dann lassen sie vieles zurück. Was sie häufig mitnehmen sind Angst und Trauer, aber auch Hoffnung. Angekommen in der neuen Heimat gilt es viele Hürden zu meistern. Ein Bericht über Kinder, Lehrer und Therapeuten, die vieles unternehmen, um dem Trauma zu trotzen.
Eindrücke haften in uns fest. Jeder Mensch kennt Reize, die über Nase, Ohren oder Augen einen Weg in unser Gedächtnis finden. So kann der Geruch von frisch gemähtem Gras innere Bilder, Gefühle wecken: etwa frohe Stunden beim Fussball, Sommertage im Freibad oder Ferien auf dem Bauernhof. Manche dieser Eindrücke werden Teil unserer Identität. Und sie gehen bis weit in die Kindheit zurück.
Es gibt Kinder, die erleben, wie ihre Eltern oder nahestehende Menschen von Bomben zerfetzt, gefoltert oder entführt werden. Auch diese Eindrücke können sich einnisten, sogar traumatisieren. Man spricht von Trauma, wenn Menschen eine existentielle Bedrohung erleben und sie daran verzweifeln. Susanne Attassi vom
Happiness Again Traumatherapiezentrum in Amman, Jordanien, berichtet von syrischen Kindern, die gesehen haben,
«wie Vater oder Mutter umgebracht worden sind». Andere wurden Opfer von Vergewaltigungen.
Trauma als ständiger Begleiter
Eine Form der Traumafolgestörung, gekennzeichnet durch anhaltende Beschwerden, nennen Fachleute posttraumatische Belastungsstörung, PTBS. Sie äussert sich zum Beispiel durch unkontrollierbare «Flashbacks». Das sind Bilder vor dem inneren Auge, von traumatischen Szenen, die unvermittelt auftauchen. Diese können wachgerufen werden durch plötzliche Reize, wie Geräusche oder Gerüche, die mit traumatischen Erinnerungen verbunden sind. Starker psychischer und körperlicher Stress sind die Folge. Menschen mit PTBS leiden an ständiger Anspannung, Reizbarkeit, Schlafproblemen und Konzentrationsschwierigkeiten. Auch Depression, Angststörungen, Drogenabhängigkeit oder ein erhöhtes Selbstmordrisiko können mit dem Krankheitsbild einhergehen.
Das Spannungsfeld syrischer Flüchtlingskinder
Bei einer Kriegstraumatisierung steigt die Wahrscheinlichkeit einer PTBS deutlich an. Neben den Kriegserlebnissen selbst sind es auch Fluchterfahrungen, die traumatisieren können.
Matthis Schick ist Leiter des Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer am Universitätsspital Zürich.
Der Umgang mit Trauma unterscheidet sich zwischen älteren und jüngeren Menschen. «Kinder sind zwar verletzlicher, aber auch lern- und anpassungsfähiger als Erwachsene», erklärt Matthis Schick, Leiter des Ambulatoriums für Folter- und Kriegsopfer am Universitätsspital Zürich. Doch kann auch das Trauma der Eltern bei den Kindern Belastung und Konflikte erzeugen, etwa, wenn Eltern reizbar, impulsiv oder emotional nicht erreichbar sind. Spannungen können auch auftreten, wenn das Trauma die Eltern stärker beeinträchtigt und sie in ihrer Integration nicht weiterkommen. Daraus können Wertkonflikte entstehen. Wenn syrische Kinder zum Beispiel im neuen Umfeld ihren Kleidungsstil verändern.
Zudem geraten Kinder öfter in Rollenkonflikte: so übernehmen sie, weil sie die Sprache häufig schneller beherrschen, früh Verantwortung für die Eltern. Denn ohne Unterstützung ihrer Kinder können viele Eltern keine Behördengänge oder Arztbesuche absolvieren. Diesen Effekt nennen Fachleute «Parentifizierung» der Kinder. Schliesslich können Kinder in Gewissenskonflikte und unter Erwartungsdruck geraten: etwa, wenn Eltern äussern, dass ihnen selbst, im Gegensatz zu den Kindern, alles im alten Heimatland genommen wurde. Die Kinder sollen nun, in der neuen Heimat, alle Chancen nutzen.
Ankommen in der neuen Heimat, mit schwerem Gepäck
Doch neben der Eltern-Kind-Dynamik gibt es weitere Hürden, die der Integration von Flüchtlingsfamilien im Wege stehen. Selbst in einem sicheren, stabilen Land wie der Schweiz, wie Matthis Schick beschreibt: «Faktoren wie unsicherer Aufenthaltsstatus, Schwierigkeiten mit der gesellschaftlichen und sprachlichen Integration, Trennung von Angehörigen und prekäre Wohnverhältnisse fallen psychopathologisch stark ins Gewicht. Diese Belastungsfaktoren erzeugen post-migratorischen Stress, der schwer wiegt und das Risiko für psychische Erkrankungen erhöht». Problematisch ist auch, dass viele Flüchtlinge nicht in die Traumabehandlung kommen. Psychisches Leiden und auch die zugrundeliegenden traumatischen Erfahrungen sind oft stark stigmatisierend. Das heisst, die Betroffenen schämen sich, fürchten soziale Ächtung. Es sei «sehr berührend, mit welchem Aufwand das Trauma bisweilen versteckt wird, obwohl die Symptome sehr stark sind». Etwa, wenn Betroffene panisch reagieren, sobald es an der Tür klingelt. Deshalb gilt es, Vertrauen aufzubauen, bevor eine Traumatherapie beginnen kann. Auch gegenüber staatlichen Einrichtungen. Denn Kinder und ihre Eltern haben in Syrien erlebt, dass der Staat verfolgt, foltert und tötet. Dieses Vertrauen aufzubauen ist in einem ersten Schritt über Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen und Lehrpersonen möglich. Sie haben den dauerhaften und entscheidenden Zugang zu den Familien.
Der Schulalltag von Flüchtlingskindern
Demnach spielt für Flüchtlingskinder die Schule eine zentrale Rolle. Sie liefert Tagesstruktur und sozialen Kontakt. Diese beiden Ressourcen bieten Kindern Vorteile, die den Eltern weitestgehend verwehrt bleiben. Denn sie leben meist abgeschottet im Flüchtlingsheim, ohne Arbeit und Freundeskreis, mitten im Asylverfahren.
Maram, die im Alter von 12 Jahren von Syrien in die Schweiz geflüchtet ist, erinnert sich: «In meiner Klasse war niemand mit arabischem Hintergrund, mit dem ich hätte reden können. Am Anfang hatte ich also grosse Angst und ein sehr schwaches Selbstbewusstsein, grosse Selbstzweifel. Ich hatte immer Angst Fehler zu machen»
Maram flüchtete im Alter von 12 Jahren von Syrien in die Schweiz.
Ein Schlüssel sowohl zur Integration als auch zur Traumatherapie ist die deutsche Sprache. Markus Busin, Lehrer im Zürcher Langstrassenquartier, erinnert sich, dass es vor ca. 15 Jahren noch sogenannte «Aufnahmeklassen» gab. Darin waren nur Kinder aus dem Ausland vertreten, die parallel zu den regulären Schulklassen unterrichtet wurden. Sie wurden von einzelnen erfahrenen Lehrpersonen geleitet und verfolgten das Ziel, den Anschluss an den regulären Unterricht zu ermöglichen. Vereinzelt gibt es derartige Klassen auch heute noch, zum Beispiel, wenn es sich um eine grössere Gruppe betroffener Kinder handelt. Generell kommen die Kinder aber inzwischen direkt in die regulären Klassen, in das nächstgelegene Schulhaus. Dort erhalten sie zum Beispiel zusätzlichen Deutschunterricht oder werden von Unterrichtsassistenzen begleitet.
Herausforderungen bei der Integration
«Gedanken macht man sich schon darüber, wenn ein neues Kind mit wenig bis keinen Deutschkenntnissen in die Schule kommt», schildert Thomas Gerber, dessen Sohn Leon syrische Flüchtlingskinder in der Klasse hatte. «Ob es aber die Unterrichtsqualität beeinträchtigen könnte, darüber mache ich mir keine Sorgen».
Für Lehrpersonen gibt es eine klare Vorgabe. Sie sollen sich auf ihre pädagogische Rolle beschränken, was nicht immer einfach ist. «Wir können Kriegstraumata nicht bearbeiten. Für das sind wir nicht ausgebildet und für das ist auch das Setting in einer Schulklasse einfach falsch», erklärt Markus Busin.
Zu erkennen, welches Kind traumatisiert ist, hängt von der Vorinformation ab. Kommt ein Kind aus einem Kriegskontext, dann achten Lehrpersonen meist besonders auf eine mögliche Traumatisierung. An den schulpsychologischen Dienst vermittelt werden dann vor allem Kinder, die laut sind. Kinder ohne Verhaltensauffälligkeiten in der Klasse, entgehen wiederum dem Radar und somit auch einer Therapie.
Mitschüler Leon beschreibt es so: «Vielleicht waren die Flüchtlingskinder ein bisschen ängstlicher und zurückhaltender als andere Kinder. Sie haben nicht jedem vertraut, aber das hat sich mit der Zeit gebessert. Ich mochte sehr an ihnen, dass sie immer so zuvorkommend, hilfsbereit und nett waren. Das war schon speziell und cool.»
Probleme für die Integration der Kinder entstehen, wenn sie verunsichert sind: durch ihre Erlebnisse, aber auch weil sie die Sprache nicht sprechen. Markus Busin achtet deshalb darauf, die neuen Kinder nicht unnötig zu exponieren. Ausserdem vermeidet er direktes Nachfragen zu traumatisierenden Erfahrungen. Vielmehr stellt er sicher, dass die Kinder später von sich aus über ihre Erlebnisse sprechen können, wenn sie das möchten.
«Ich habe gespürt, dass Lehrer und Schüler Angst hatten mich über meine Vergangenheit zu fragen, sehr zurückhaltend, fast vorsichtig waren.Sie dachten vermutlich, dass ich selbst Angst hätte über meine Erlebnisse zu sprechen», erklärt Flüchtlingskind Maram.
Für die Integration in die Schulklasse sind gemeinsame Erlebnisse manchmal sogar wichtiger als Sprache. Auch in einem mehrtägigen Klassenlager, bei einem Sportfest oder Kuchenverkauf kann eine neue, geteilte Identität entstehen. Ohne einen zusätzlichen Aufwand können bereits die Tagesstruktur des Schulalltags und die gemeinsamen Erlebnisse einen wichtigen Schutzraum für die Kinder bieten. Gleichzeitig jedoch sieht Markus Busin bei psychologischen Massnahmen für Flüchtlingsfamilien ein grosses Defizit: «Da werden Familien und Kinder doch sehr alleine gelassen. Ich denke mir, es wäre wichtig, wenn diese Kinder so schnell wie möglich Unterstützung bekommen. Das muss nicht gleich psychologische Therapie sein, sondern schlichtweg jemand, der ihnen wieder in den Alltag hilft».
Ähnlich schätzt es auch Thomas Gerber ein: «Man hatte irgendwie das Gefühl, das Kind sucht einen Halt, und den bekam es durch die Kinder und nicht durch irgendwelche institutionellen Hilfestellungen.» Für die Mitschülerinnen und Mitschüler sieht Thomas Gerber einen Mehrwert: «So wird das soziale Verhalten der Kinder aktiviert, wie es sonst sicher nicht der Fall wäre. Ausserdem bekommen die Kinder durch die Erzählungen ein ganz anderes Bild als aus den Nachrichten. So sind die Menschen, die man in den Nachrichten sieht, plötzlich keine Fremden mehr.»
Traumabehandlung
Christina Gunsch, Leitende Psychologin für Kinderpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich geht davon aus, dass etwa 30 bis 50 Prozent aller syrischen Flüchtlingskinder traumatisiert sind. «Betroffene werden dann bei mir für die Behandlung angemeldet, wenn sie in der Schule ausser Rand und Band sind». Die Kinder sind aggressiv oder können sich nicht konzentrieren. Die Einschätzung der Situation durch Lehrpersonen ist hier entscheidend. Um sie zu unterstützen, gibt es seitens der «Zürcher Arbeitsgruppe Kind und Trauma» die
Broschüre «Flucht und Trauma». Christina Gunsch ist Mitautorin der Broschüre. Darin werden Trauma, auffälliges Verhalten sowie mögliche Interventionen erläutert.
Christina Gunsch ist leitende Psychologin für Kinderpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.
Das Hauptziel verschiedener Therapieansätze ist es, dem Leiden entgegenzuwirken. Die Therapieverfahren, die Christina Gunsch hierfür wählt, sind wissenschaftlich belegt. Dabei wagt sie sich mit ihren kleinen Patienteninnen und Patienten in die Höhle des Löwen, denn: «Man weiss inzwischen, dass man die schwierigsten Erfahrungen nochmals durchgehen muss, um ein Trauma heilen zu können». Wie dieses Durchgehen genau abläuft, hängt von dem betroffenen Kind ab. So zeichnen manche Kinder die traumatisierenden Erlebnisse auf. Aber auch Aufschreiben, Nachspielen oder die Erfahrungen in Gedanken immer wieder durcharbeiten, helfen. Wichtig ist dabei ein Wiedererinnern mit allen Sinnen: also, wie hat es ausgesehen, wie hat es gerochen, was hat das Kind gehört? Viele Kinder absolvieren diese Form der Therapie über mehrere Wochen problemlos.
Flüchtlingskind Maram hätte gerne mehr über Syrien gesprochen, erklärt sie. Deswegen hat sie ihre Vertiefungsarbeit darüber geschrieben um ein wenig über ihre Erlebnisse in Syrien zu berichten. «Viele Menschen wissen nicht was dort passiert, und ich hatte einfach das Bedürfnis darüber zu sprechen.»
Entwicklungsperspektiven schaffen
Ob den Kindern und ihren Familien das Ankommen in der neuen Heimat gelingt, ist von vielen Faktoren abhängig. Diese Einschätzung teilen Christina Gunsch und Matthis Schick: Traumatherapie gelingt vor allem durch ein stabiles schulisches Umfeld und eine Unterstützung durch das private Umfeld des Kindes. Ausserdem sei es entscheidend, dass die Aussicht auf eine «lebbare» Zukunft besteht. Schafft man es, diese realisierbare Perspektive zu vermitteln, finden sich Mittel und Wege, mit der Vergangenheit umzugehen. Neben einem stabilen Umfeld in Schule und Familie ist es wichtig, persönliche Ressourcen, wie etwa Talente und berufliche Kompetenzen, zu fördern: Also «das, was Patienten mitbringen, aufgreifen und unterstützen».
Für Maram war es insbesondere ihre Schweizer Lehrerin, die ihr das Gefühl gab niemand Fremdes zu sein. «Sie hat viel mit mir gesprochen, mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, dass das für mich ein Neubeginn ist, dass ich Talent habe. Das hat mich sehr bestärkt.»
Es gilt zu vermeiden, dass syrische Flüchtlingskinder und Kinder aus anderen Krisenregionen Teil einer «verlorenen Generation» werden. Die Risiken und potentiellen Langzeitfolgen für die Kinder wie für die Gesellschaft sind zu hoch. Deshalb sei es laut beider Experten wichtig, vor Ort eine gute Vorarbeit sicherzustellen: Indem bereits in Syrien und Anrainerstaaten Eltern und Kinder für psychiatrische und psychotherapeutische Arbeit sensibilisiert werden. So, wie es zum Beispiel im Happiness Again Traumatherapiezentrum in Amman, Jordanien gemacht wird. Zudem wäre, so Christina Gunsch, bei der Aufnahme in die Schweiz, neben einer körperlich-medizinischen Untersuchung, auch eine psychologische Untersuchung wichtig. Trauma früh zu erkennen und rechtzeitig zu behandeln, gelänge so besser.
Kinder mit Kriegserfahrungen sind nicht nur die grössten Leidtragenden, sondern schultern gleichzeitig auch die Lasten des neuen Alltags. Deshalb ist es entscheidend, diesen Kindern auf dem Weg einen Teil des schweren Gepäcks abzunehmen und ihnen einen hoffnungsvollen Blick in ihre Zukunft zu ermöglichen.
Maram hat dabei einen klaren Plan. «Für die Zukunft wünsche ich mir eine gute Ausbildung. Ich möchte mich als Teil der Gesellschaft fühlen. Ich beginne demnächst eine Ausbildung als medizinische Praxisassistentin. Wenn das klappt, würde ich gerne selbst mal Ärztin werden.»
Syrienkrieg: Zahlen und Fakten
Der seit 2011 anhaltende Syrienkrieg hat laut Angaben der Vereinten Nationen die grösste humanitäre Katastrophe seit Ende des Zweiten Weltkriegs ausgelöst. Bisher hat der Krieg über 400000 Menschenleben gefordert. Mit rund 13 Millionen Flüchtlingen (6 Millionen ausserhalb Syriens und 7 Millionen Binnenflüchtlingen) ist über die Hälfte der syrischen Bevölkerung unmittelbar vom Krieg betroffen. 44 Prozent der Flüchtlinge sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Syrische Kinder unter 9 Jahren kennen kein Leben ohne Krieg. Schätzungen zufolge sollen 30 bis 50 Prozent der syrischen Flüchtlingskinder kriegstraumatisiert sein. Galt Syrien vor dem Krieg als Land mit hohem Bildungsstand (99.6 Prozent Primarschulquote), wurden seit 2011 über 4000 Schulen zerstört.
Quellen: UNICEF, UNHCR, Human Rights Watch

Betroffen vom Krieg im Herkunftsland seiner Eltern reiste
Dr. Omar Kassab 2013 nach Jordanien um herauszufinden, welchen Beitrag geleistet werden kann, um die Not der wachsenden Zahl syrischer Flüchtlinge zu lindern. Daraus entstand
Syrian Refugee Crisis.