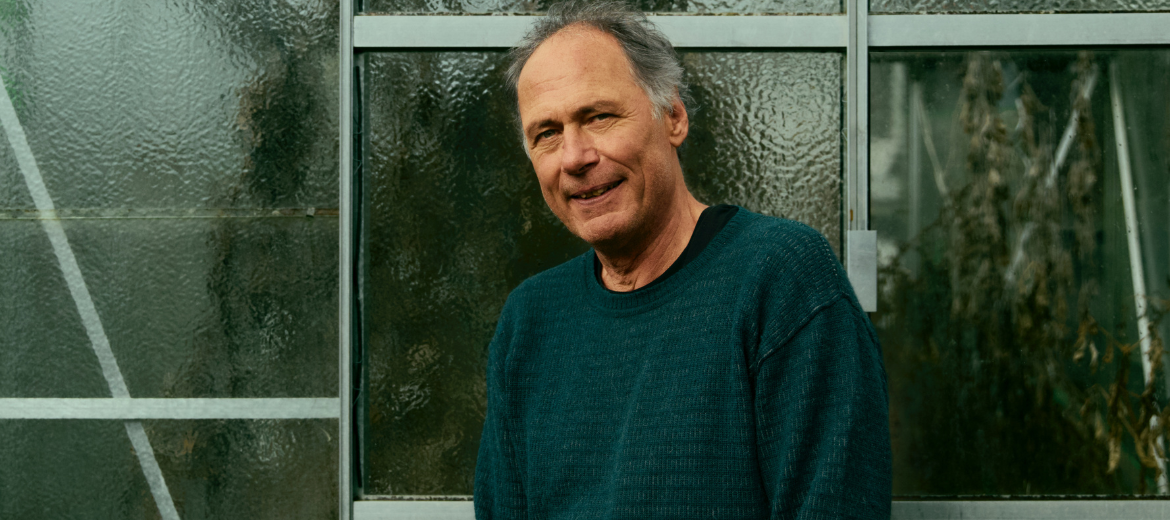Wie wird mein Kind selbstbewusst?

Wir alle sehnen uns danach, vorbehaltlos angenommen und geliebt zu werden – es bildet die Basis unseres Selbstbewusstsein. So entwickelt ein Kind diesen wichtigen Baustein für ein zufriedenes Leben.
Die Saat für unser Selbstbewusstsein wird in unserer frühen Kindheit gelegt. Die ersten Lebensjahre in der Entwicklung eines Menschen sind deshalb so wichtig, weil sich in dieser Zeit seine Gehirnstruktur mit ihren ganzen neuronalen Netzen und Verschaltungen herausbildet. Die Erfahrungen, die wir in dieser frühen Entwicklungsphase mit unseren nahen Bezugspersonen machen, graben sich tief in unser Gehirn ein.
Kinder sind existenziell darauf angewiesen, dass ihre Eltern sie bedingungslos lieben und auf ihre Bedürfnisse feinfühlig reagieren. Ob und wie diese Bedürfnisse nach grundsätzlicher Akzeptanz in unserer Kindheit gestillt werden, hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir später durchs Leben gehen. Am allerwichtigsten ist für Kinder die verlässliche und körperliche Nähe der Eltern, deren Fürsorge und unmittelbare Zuneigung. Das ist «das Ticket zum Überleben», sagt der Kinderarzt Herbert Renz-Polster.
Die vier Grundbedürfnisse unseres Selbstbewusstseins
Gemäss dem Psychotherapieforscher Klaus Grawe gibt es vier psychische Grundbedürfnisse:
1. Bindung
Die frühe Bindungserfahrung hat einen fundamentalen Einfluss auf die spätere Gesundheit, die Beziehungsfähigkeit und die Stressresistenz. Sie ist wie eine Art Flugzeugträger, aus dem man in die Welt starten kann. In den ersten sechs Lebensjahren erfährt das Kind: «Ich kann mich auf Mama und Papa verlassen.» «Ich werde gehört und gesehen.» «Ich darf weinen.» «Man erkennt meine Bedürfnisse.»
Wird Anerkennung an eine bestimmte Bedingung geknüpft, merkt sich das Kind, dass es nur wertvoll ist, wenn es sich in bestimmter Weise verhält.
Ein enger, fürsorglicher und verlässlicher Kontakt zwischen Kind und Bezugspersonen ist die Voraussetzung dafür. Vermag diese erste Beziehungserfahrung Geborgenheit, Verlässlichkeit und Schutz zu schenken, entsteht so etwas wie ein stabiles Grundgefühl. Wird das kindliche Bedürfnis nach Bindung frustriert – durch Vernachlässigung, Ablehnung oder psychische oder physische Misshandlung –, leidet das Gefühl, wertvoll, stark und kompetent zu sein.
2. Autonomie
Kinder brauchen Geborgenheit, aber auch Autonomie und Selbständigkeit. Kinder, so der Bindungsforscher John Bowlby, sind von Natur aus mit einem Forschungsprogramm ausgerüstet, mit dem sie auf die Umwelt zugehen, sich in das Leben der anderen Menschen einklinken. Sie möchten sich als «wirksam» empfinden. Dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten kann nur entwickeln, wer seinen eigenen Willen ausdrücken darf.

Viele Kinder sind emotional so stark in den Mittelpunkt der Familie gerückt, dass sie «aus Liebe behindert werden», sagt Herbert Renz-Polster. Ein Beispiel: Die Zehnjährige möchte allein die drei Stunden Zugfahrt entfernte Oma besuchen. Instinktiv ziehen viele Eltern die Leine stramm – aus Furcht, das Mädchen könnte niemals bei der Oma ankommen.
Diese Ängste sind verständlich, gelten aber als «elterliche Überfürsorge». Denn Autonomie bedeutet auch, dass Kinder altersabhängig und im Rahmen ihrer Fähigkeiten über gewisse Dinge selbst entscheiden können.
3. Lustbefriedigung
Das Kind strebt danach, Lust zu empfinden und Unlust zu vermeiden. Es ist für das spätere Leben existenziell wichtig, dieses Lustempfinden zu regulieren. Das Kind muss die Fähigkeit zur Frustrationstoleranz, zum Belohnungsaufschub und zum Triebverzicht erlernen, und so ist Erziehung zum grossen Teil darauf angelegt, dem Kind einen angemessenen Umgang mit Lust und Unlust beizubringen.
Oft geht Bedürfnis Nummer 2 mit Bedürfnis Nummer 3 einher (das Dessert vor der Hauptmahlzeit essen zum Beispiel). Gefragt ist ein gesunder Umgang damit. Wird dieses Bedürfnis zu stark reglementiert, kann es dazu führen, dass das Kind später zwanghaftes Verhalten entwickelt – oder aber umgekehrt seinen Gelüsten nur allzu gerne nachgibt.
4. Anerkennung
Hier geht es um die Erkenntnis: «Ich bin willkommen, so wie ich bin.» Ist das der Fall, ist die Welt ein freundlicher Ort. Wir sind darauf konditioniert, Anerkennung durch andere zu erhalten – schon von klein auf. Problematisch wird es, wenn diese Anerkennung an eine Bedingung geknüpft wird. Dass man ein Kind also nur liebt, weil es etwas besonders gut gemacht hat oder sich von einer besonders schönen Seite gezeigt hat. Dann merkt sich das Kind, dass es nur wertvoll ist, wenn es sich in bestimmter Weise verhält.
Stark erschüttert wird das Selbstbewusstsein durch die Erfahrung, nicht respektvoll behandelt zu werden. Verbale Schmähungen wie Herabsetzung, Demütigung, aber auch Liebesentzug lassen ein Kind zum Schluss kommen, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Aber auch das Umgekehrte gilt: Werden seine Fähigkeiten nicht beachtet oder als selbstverständlich genommen, kann es schwer sein, ein Gefühl für das eigene Können zu entwickeln und auf sich selbst stolz zu sein.

Ein gesundes Selbstbewusstsein zu haben, heisst demnach, sich kompetent zu fühlen (lat. competere = zu etwas fähig sein) und aus tiefstem Herzen sagen zu können: «Ich kann etwas.» – «Ich werde geliebt, so wie ich bin.» – «Ich darf einen eigenen Willen haben.» – «Ich werde respektiert und wahrgenommen.» – «Selbst wenn es mal nicht so gut läuft, bin ich «okay.»
Wir haben gesehen, dass diese Kompetenzen in den Kinderjahren zu einem grossen Teil aus funktionierenden Beziehungen gebildet werden. Somit lastet auf Eltern grosser Druck, «es» möglichst gut zu machen, damit das Kind «gut herauskommt». Viele Eltern empfinden den Alltag mit Erziehung, Schule und Beruf als fordernd. Hat es negative Folgen für das kindliche Selbstbewusstsein, wenn die Eltern gestresst, beruflich eingespannt oder perfektionistisch sind? Was, wenn ein Schicksalsschlag, eine Trennung uns vor grosse Herausforderungen stellt?
Der Begriff Selbstbewusstsein wird unterschiedlich definiert. Man kann grob zwei Definitionen unterscheiden:
- Die engere beschreibt Selbstbewusstsein als Erkennen der eigenen Person.
- Die weitere Definition schliesst Selbstvertrauen mit ein, also das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen.
Im allgemeinen Sprachgebrauch setzen wir Selbstwertgefühl mit Selbstbewusstsein gleich. Der hier verwendete Begriff des Selbstbewusstseins schliesst deshalb das Selbstwertgefühl mit ein.
Quellen: Fabian Grolimund und Stefanie Rietzler via www.biber-blog.ch; Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik, lexikon.stangl.eu
Eltern sind nicht an allem schuld
Die Eltern haben nicht immer Schuld, sagt der deutsche Kinderarzt Herbert Renz-Polster. «Die Schuld der Eltern war das Geschäftsmodell der Psychologie der letzten 100 Jahre, die jedes Drama und jede Verletzung des Menschen aus dem Verhalten seiner Mutter zu erklären suchte», sagt er. Eltern seien da besonders verletzlich: Alles, was bei Kindern schiefläuft, meinen sie auf ihre Kappe nehmen zu müssen. Zu Unrecht! «Erziehung vollzieht sich in einem System.»
Heutige Eltern machen es wirklich gut.
Herbert Renz-Poster, Kinderarzt
Eltern seien weder die allmächtigen «Weichensteller» noch die Magier, die ihren Kindern die Tricks des Lebens beibringen, sondern sie seien Teil eines Ganzen, so Renz-Polster, zu dem auch die Kinder selbst gehörten, die Verwandten, die Freunde, die Schule, die Vereine, ja die ganze Gesellschaft. Denn tatsächlich machen es die heutigen Eltern wirklich gut.
Mehrere Untersuchungen, darunter besonders die Shell-Studie, bescheinigen den Eltern eine gute Erziehung und den Kindern ein gutes Verhältnis zu Mutter und Vater: «Mehr als 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, erachten diese nebst Freunden als wichtigste Stütze und finden bei ihnen Rückhalt und emotionale Unterstützung.»

Familie, Freunde und Freizeitaktivitäten tragen wesentlich zum Selbstbewusstsein und Wohlbefinden des Kindes bei. Welche Rolle spielt die Schule? Mehrere Studien deuten darauf hin, dass die Schule, der Leistungsdruck und der damit verbundene Stress das kindliche Selbstbewusstsein eher negativ beeinflussen.
Wenig selbstbewusste Kinder leiden in der Schule eher
Tatsächlich sind Kinder, die sich selbst als unsicher und wenig kompetent sehen, in der Schule besonders gefährdet, sagt die Berner Erziehungswissenschaftlerin Tina Hascher. Kinder mit geringem Selbstbewusstsein haben mehr Angst in der Schule, trauen sich weniger zu, strengen sich in der Folge weniger an und sehen die Zukunft eher negativ.
Auf Eltern lastet ein grosser Druck, ‹es› möglichst gut zu machen, damit das Kind ‹gut herauskommt›.
Diese Kinder bedürfen unserer Aufmerksamkeit. Gerade wenn es einmal schlecht läuft, in der Schule beispielsweise. Dann brauchen auch ältere Kinder wieder ihre Eltern oder andere Erwachsene, die trösten und motivieren. «Nichts stärkt Kinder mehr als das Wissen: Ich bin wundervoll, und niemand kann dieses Gefühl besser vermitteln als Eltern», erklärt der deutsche Psychiater Michael Schulte-Markwort.
«Dafür ist es nötig, den Blickwinkel auf die Stärken des Kindes zu legen statt auf seine Schwächen.» Ist die Mathearbeit verhauen? Dafür ist das Kind vielleicht in Französisch gut oder hat eine Leidenschaft fürs Lesen. Aber selbst wenn das schulische Leben das Selbstbewusstsein mindert oder es in der Familie gerade harzt, muss ein Kind nicht zwangsläufig scheitern.
«Nicht jeder Kratzer führt gleich zu Krankheiten», sagt Renz-Polster. «Es braucht viele ungünstige Einflüsse, um ein Kind aus dem Gleis der Entwicklung zu werfen.» Um unsicher durchs Leben zu gehen, müssen die Grundbedürfnisse massiv nicht erfüllt oder missachtet worden sein.
Die eigene Widerstandskraft anregen
Und auch dann muss ein Kind nicht zwingend scheitern. Ein Kind kann auch ohne fabulöses Selbstbewusstsein durchaus psychisch gesund erwachsen werden, glücklich und zufrieden sein. Denn – das ist die gute Nachricht – ungünstige Umstände können durch andere Faktoren, aus denen das Kind Kraft und Vertrauen schöpft, fast immer wettgemacht werden.
Dazu gehören Geschwister, Grosseltern, Freunde, ja sogar Nachbarn, bei denen ein Kind immer wieder spielt, isst oder seine Hausaufgaben macht. Sie können ganz unbewusst dem Kind Erfahrungen vermitteln, dass es etwas kann, wertvoll ist und eine innere Stärke oder Widerstandskraft, also Resilienz entwickelt. Das geschieht im Kind selbst, aktiv trainieren kann man es nicht.
Positive und eigenwirksame Erfahrungen speisen das Vertrauen ins Selbst wie ein inneres Kraftwerk.
Resilienz «ist keine statische Angelegenheit, kein Programm und kein Produkt, das man einfach so entwickeln kann», sagt die Zürcher Psychologieprofessorin Corina Wustmann. Kinder könnten nicht resilient «gemacht» werden. Vielmehr seien es einzelne, in einem ständigen Wechselspiel befindliche Puzzlesteinchen, die dazu beitrügen, dass ein Kind innere Stärke verspüre, selbst wenn das Leben mal «gemein» zu ihm sei. Und man kann, so Wustmann, gar nicht immer punktgenau sagen, weshalb aus einem manchmal unglücklichen Kind dann doch ein glücklicher Erwachsener wurde.
Zur Resilienz tragen laut Wustmann vor allem positive Erfahrungen in der Alltagswelt bei. «Wenn Kinder im Alltag altersgemäss Verantwortung übernehmen können, empfinden sie sich als selbstwirksam. Sie realisieren, dass sie etwas können, und die anderen sehen auch, dass es das gut kann – diese Erfahrungen sind wertvoller als alle Förderprogramme zusammen.»
«Ich werde nicht in Watte gepackt»
Die nachhaltigsten Botschaften für das kindliche Selbstbewusstsein sind demnach: «Ich darf Erfahrungen machen.» «Ich werde nicht in Watte gepackt.» «Ich kann etwas bewirken, das mir und anderen Spass und Freude bereitet.» Daraus nährt sich das kindliche Selbstvertrauen. Positive und eigenwirksame Erfahrungen in der Spielgruppe oder Kita, im Kindergarten und in der Schule, aber auch im Wald, auf dem Fussballplatz oder durch ein Hobby speisen dieses Vertrauen wie ein inneres Kraftwerk. Daraus schöpft das Kind, wenn sich Zweifel melden. Zum Beispiel Glaubenssätze, also verinnerlichte Botschaften etwa von den Eltern, einfache Aussagen wie «Mathe ist ja einfach nicht dein Ding!».

Bei unsicheren Kindern meldet sich diese innere Stimme häufiger als bei selbstbewussteren, und unsichere Kinder lassen sich davon eher beeinflussen. Sie hören diese innere zurechtweisende, kritisierende Stimme beim kleinsten Fehler. Die Folge könne Scham sein, sagt der Verhaltenstherapeut und Buchautor Mathew McKay: Aus Angst, Risiken einzugehen, abgelehnt zu werden, bewegt man sich sehr vorsichtig in der Welt. «Das Gefühl, es nicht zu schaffen oder es nicht zu verdienen, kann die Funktionsfähigkeit und Zufriedenheit in praktisch jedem Lebensbereich behindern.»
Freundlich zu sich selbst sein
Ein Rezept gegen diese inneren Zweifel, so Mathew McKay, sei, Gefühle oder Gedanken zu benennen, um sie so distanzierter betrachten zu können und sich nicht mit ihnen zu identifizieren. Und so verlieren sie an Macht. Eine ungenügende Note in Mathe zum Beispiel heisst dann eben nicht, dass man in Mathe immer schlecht ist.
Kindern sollte man ruhig jeden Tag sagen, dass sie aus tiefstem Herzen geliebt werden.
Margarete Killer-Rietschel, Psychologin
Eine zweite Möglichkeit ist, den Fokus anders zu legen und herauszufinden, was gut läuft. «Jedes Leben hat Aspekte, die man bedauert oder bereut. Das Entscheidende ist nicht so sehr, was einem passiert, sondern wie man die Aufmerksamkeit darauf richtet.» Es gehe für jeden Menschen, ob gross oder klein, letztlich darum, einen ausgewogenen Blick auf sein Selbst zu richten, Verständnis und Mitgefühl für sich selbst und andere zu zeigen. Diese buddhistischen Tugenden kann man auch seinen Kindern vermitteln: «Ich bin okay, auch wenn ich es mal nicht bin» – diese simple Maxime hilft tatsächlich.
Und Zuneigung. Viel Zuneigung. Am besten täglich. «Kindern sollte man ruhig jeden Tag sagen, dass sie aus tiefstem Herzen geliebt werden und etwas ganz Besonderes sind», sagt die Psychologin Margarete Killer-Rietschel. Denn Hand aufs Herz: Auch wir Erwachsene hören das gern. Besonders, wenn der Tag etwas wolkig beginnt.