«Es gibt keine negativen Gefühle»

Der Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge sagt, Aggressionserziehung sei eine besonders wichtige Aufgabe von Eltern. Denn wenn ein Kind tobt, reagieren Mütter und Väter oft hilflos. Der Bestsellerautor über Wut, Mitgefühl und schwierige Eltern-Kind-Beziehungen.
Herr Rogge, in heiteren Momenten spiegeln Eltern ihren Kindern deutlich, wie sehr sie ihre Freude oder ihren Mut wertschätzen. Negative Gefühle wie Angst oder Wut möchten sie dagegen möglichst schnell abstellen. Das ist verständlich. Aber ist es auch sinnvoll?
Ich möchte zunächst die Differenzierung zwischen negativen und positiven Gefühlen aufheben. Es ist nicht sinnvoll, die eine Emotion als erwünscht und die andere als unerwünscht einzuordnen. Das ist zwar eine gängige Unterscheidung in unserem Alltag, aber für die Begleitung der Kinder ist sie fatal.
Warum?
Sie sagen es ja schon: Weil unsere Tendenz ist, die negativ besetzten Gefühle möglichst schnell stillzulegen. Emotionen auszubilden und sich ihnen zu stellen, ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe jedes Menschen, die mit der Geburt beginnt und uns über das Trotzalter, das Schulalter, die Pubertät bis ins hohe Lebensalter begleitet.

Mit Fröhlichkeit kommen wir alle bestens klar. Es ist auch wunderbar, wenn ich meinem Kind meine Freude darüber zeige, dass es diese Gefühle mit mir teilt. Mit der gleichen Intensität sollte ich aber auch Angst, Wut oder Aggression begleiten.
Der Elternsatz ‹Du brauchst doch keine Angst zu haben› ist wirklich kein bisschen hilfreich!
Die gehören auch zum Leben dazu, sie sind wichtig und wertvoll für uns, also müssen wir auch mit diesen Gefühlen umgehen können. Wir müssen ihre Funktion kennen, ihre Hintergründe. Es gibt zum Beispiel Ängste, die notwendig sind, weil sie uns schützen. Und es gibt Ängste, die uns unselbständig machen und kleinhalten.
Wer ängstlich ist, möchte dieses Gefühl schnellstmöglich loswerden. Also versuchen Eltern, ihren Kindern die Angst zu nehmen.
Ein Elternsatz, der Kindern deshalb immer wieder vorgebetet wird, lautet: «Du brauchst doch keine Angst zu haben.» Das ist wirklich kein bisschen hilfreich! Wenn ein Kind Angst hat, hat es Angst. Dann sucht es Nähe und Geborgenheit. Punkt! Es will nicht noch hören, dass seine Sorge unberechtigt ist. Dann fühlt es sich nämlich ausserdem noch dumm. Auch nicht hilfreich ist die Warum-Frage, die jüngeren Kindern oft gestellt wird. «Warum hast du denn da Angst?»
Wie soll man denn als Mutter oder Vater herausfinden, was das Kind umtreibt?
Je jünger mein Kind ist, desto wichtiger ist es, es zunächst einmal zu beobachten. Ich könnte versuchen, mir ein bestimmtes Verhalten selbst zu erklären oder mit meinem Partner oder meiner Partnerin darüber zu reden.
Wenn ein Kleinkind heftige Wutanfälle hat, kann man fragen ‹Wie fühlt sich deine Wut an?›, ‹Wo sitzt deine Wut?›. Das sind Dinge, die ein Kind in Bildern erfassen kann.
Ich kann mich beispielsweise fragen, ob seine Emotionen Ausdruck einer Entwicklungsphase sind, ob es Aufmerksamkeit möchte. Warum-Fragen drücken meistens eine gewisse pädagogische Ohnmacht aus. Das spüren Kinder. Deshalb bekommt man darauf auch so unsinnige Antworten wie «darum» oder «weiss nicht».
Gar nichts zu fragen kann aber doch auch nicht die Lösung sein.
Natürlich ist es sinnvoll, so früh wie möglich über Gefühle zu reden. Aber die Fragen der Erwachsenen sollten dem Kind – vor allem wenn es noch klein ist – nicht die Aufschlüsselung der Situation übertragen.
Wenn ein Kind zum Beispiel Angst vor Monstern hat, sind Fragen wie «Wie sieht es aus?», «Wo ist es?», «Wie könnten wir es besiegen?» konstruktiv. Wenn ein Kind mit drei oder vier Jahren heftige Wutanfälle hat, kann man etwas fragen wie «Wie fühlt sich deine Wut an?», «Wo sitzt deine Wut?». Das sind Dinge, die ein Kind in Bildern erfassen kann. Damit werden die Gefühle in Sprache greifbar und damit auch veränderbar.
Mitgefühl ist besser, weil es Hilfe zur Selbsthilfe anbietet.
Wenn das bereits mit einem kleinen Kind geübt wurde, kann es später viel besser erklären, wie es ihm gerade geht. Damit, dass ein Kind sein Gefühl benennen kann, kann es diesen Zustand auch besser verstehen und verarbeiten.
In Ihrem Buch «So grosse Gefühle!» fordern Sie die Eltern auf, Mitgefühl statt Mitleid zu zeigen. Warum ist der Unterschied so wichtig?
Mitgefühl ist besser, weil es Hilfe zur Selbsthilfe anbietet. Manchmal überlegen Eltern, ob sie hartherzig sind, wenn sie kein Mitleid mit ihrem verzweifelten oder ängstlichen Kind zeigen. Aber mitzuleiden bestätigt das Kind in seiner Hilflosigkeit, das bietet ihm keine Perspektive in der Verzweiflung.
Mitfühlende Eltern verstehen die Betroffenheit, vermitteln Trost und machen Mut: «Ich gebe dir Halt, wenn du ihn brauchst.» Dass diese Haltung wünschenswert ist, transportiert bereits ein uraltes Kinderlied: «Hänschen klein, ging allein, in die weite Welt hinein.»
Was erzählt dieses Lied über die emotionale Begleitung eines Kindes? Hänschen verlässt doch sein Elternhaus.
Richtig, das müssen Kinder ja auch. Eine der elterlichen Herausforderungen ist, ein Kind nicht in seinem Wunsch nach Bewegung und Entwicklung zu bremsen. Wenn ich meinem Kind ständig sage: «Pass bloss auf, sei vorsichtig», dann begrenze ich es durch meine Ängste.
Wer versucht, Aggressionen aus der Kindheit zu verbannen, legt die Entwicklung still.
Die meisten Kinder sind aber ohnehin umsichtig und prüfen ihre Fähigkeiten, wenn sie etwas Neues beginnen. In dem Lied heisst es: «Stock und Hut, stehn ihm gut, ist gar wohlgemut». Hänschen bekommt einen Stock, damit er Halt spürt, und er bekommt einen Hut, mit dem er sich behütet fühlt. Und mit diesem Gefühl geht er allein in die Welt. Er wird nicht gefahren! Er bewegt sich selbst, macht in seinem Tempo Entwicklungsschritte. Dazu gehören gewisse Ängste, dazu gehört auch Aggression.
Ein aggressives Kind kann für seine Eltern und für alle anderen höllisch anstrengend sein.
Erwachsene sagen häufig: «Ein Kind ist aggressiv». Das ist eine fatale Bewertung, die ist nicht sinnvoll. Ein Kind handelt in bestimmten Situationen aggressiv. Als Erwachsener sollte ich dann gucken, was das Kind durch seine Handlung ausdrückt. Das bedeutet nicht, dass ich als Elternteil stillschweigend jedes Verhalten ertrage, aber eine veränderte Sichtweise wäre ein sinnvoller erster Schritt.
Was können Eltern dabei entdecken?
Der lateinische Wortstamm von Aggression verrät einiges über die Funktion dieses Gefühls. Das Verb «aggredere» bedeutet nämlich auch «auf etwas zugehen, losgehen, etwas anpacken». Die konstruktive Seite dieses Gefühls wird oft ausgeblendet.
Heute ist bei vielen Kindern der Körper stillgelegt worden. Sie wissen nicht, was ein Körper aushält und was zu gravierenden Verletzungen führen kann.
Wer zum Beispiel einen sportlichen Wettkampf gewinnen möchte, braucht diese Form von Energie und Selbstmobilisierung. Kinder müssen schreien, toben und raufen dürfen. Wer versucht, Aggressionen aus der Kindheit zu verbannen, legt die Entwicklung still.
Dass ein Kind andere schlägt oder mutwillig Dinge zerstört, kann man aber der Entwicklung zuliebe nicht einfach tolerieren. Wie setzt man als Vater oder Mutter Grenzen?
Aggressionserziehung – also eine Erziehung zum gesunden Umgang mit Aggressionen – ist wichtig. Kinder wollen Regeln überschreiten, Grenzen austesten. Eltern müssen alters- und situationsangemessen reagieren und Grenzen setzen. Dazu gehört, ein Kind in aggressiv aufgeladenen Situationen nicht wie einen kleinen Erwachsenen zu behandeln und Dinge zu diskutieren oder zu verhandeln.
Eltern müssen sich aber auch überlegen, wann ein Nein sinnvoll ist. Zur Aggressionserziehung gehört auch, Kinder körperliche Erfahrungen machen zu lassen. Als ich vor 30 Jahren eine Umfrage gemacht habe, ob zu Hause gerauft wird, haben das 75 Prozent aller Familien bestätigt. Bei meiner letzten Befragung vor einigen Jahren wurde nur noch in 30 Prozent der Familien gerangelt und spielerisch gekämpft.
Was ist die Konsequenz?
Wir beobachten viel öfter als früher, dass Kinder gar nicht mehr wissen, wo beim spasshaften Raufen das Mass ist. Früheren Generationen war klar, wenn einer am Boden liegt und man spürt, der kann nicht mehr, hört man auf. Und man wusste auch, dass man zwar am Handgelenk fest zupacken oder auf den Oberarm schlagen darf, aber nicht den Hals zudrückt oder gegen den Kopf tritt.
Eltern haben immer mit zwei Generationen Kindern zu tun. Dem Kind vor ihnen und dem Kind in ihnen, also dem Kind, das sie selbst waren.
Heute ist bei vielen Kindern der Körper sozusagen stillgelegt worden. Sie wissen nicht, was ein Körper aushält und was zu gravierenden Verletzungen führen kann. Wenn diese Kinder die Wut packt, schlagen und treten einige deshalb mit erschreckender Heftigkeit. Oft sind sie danach selbst verstört über ihren Gefühlsausbruch.
Wie gut gelingt es Eltern eigentlich, die Ursachen für solche und andere Gefühlsausbrüche zu erkennen?
Darauf möchte ich zwei Antworten geben. Die erste lautet: Eltern haben immer mit zwei Generationen Kindern zu tun. Dem Kind vor ihnen und dem Kind in ihnen, also dem Kind, das sie selbst waren.
Ein schüchterner Junge muss nicht ins Wildniscamp, weil seine Mutter als Kind gerne mehr Freiheit gehabt hätte.
Je mehr sich ein Erwachsener mit seinen kindlichen Erfahrungen auseinandergesetzt hat, desto unbelasteter und offener kann er sein eigenes Kind annehmen und erkennen, was es umtreibt und braucht. Kinder wollen nicht, dass man an ihnen auslebt, was die Eltern gerne gehabt hätten. Ein schüchterner Junge muss nicht ins Wildniscamp, weil seine Mutter als Kind gerne mehr Freiheit gehabt hätte.
Ist Eltern das bewusst?
Darauf zielt der zweite Teil meiner Antwort ab: Ein Grossteil der Eltern denkt heutzutage ziemlich pädagogisch. Gerade was bestimmte Erziehungstechniken und Massnahmen angeht, sind Eltern heute viel kompetenter als frühere Generationen.
Was sich nicht im gleichen Masse entwickelt hat, ist allerdings das Wissen über bestimmte Entwicklungsphasen. Das ist eher unterentwickelt und daraus resultieren dann einige Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Beziehung.
Haben Sie ein Beispiel?
Nehmen wir die Aggressionsthemen, die zwischen dem sechsten und dem zehnten Lebensjahr auftauchen. Viele Eltern nehmen bei diesen Wutausbrüchen an, dass sie in der Erziehung des Kindes etwas falsch gemacht und vielleicht Regeln zu soft vermittelt haben. Oder sie glauben, dass ihr Kind ein ungünstiges Temperament hat, ein «Wüterich» ist. Dabei ist der Widerwille nur eine Unabhängigkeitserklärung des Kindes.
Kinder brauchen unbewachte Freiräume, aber klare Regeln und Abläufe, die ihnen Sicherheit geben.
Es geht – wie auch vorher bei den Trotzanfällen oder später in der Pubertät – um die Abgrenzung von den Eltern. Um die Welt zu entdecken, müssen Kinder sich losreissen. Sie entdecken gleichaltrige Bezugspersonen. Sie entdecken andere Wertvorstellungen, andere Denkweisen. Das öffnet den Horizont, macht aber auch Angst.
Bei diesen Entdeckungen treten deshalb oft widersprüchliche Gefühle auf. Wenn Eltern das wissen, können sie damit entspannter umgehen. Kinder brauchen in dieser Zeit unbewachte Freiräume, aber klare Regeln und Abläufe, die ihnen Sicherheit geben.
Im Alltagsstress klappt das mit der entspannten Reaktion trotz aller Erkenntnis oft nicht. Auf den Tobsuchtanfall des Kindes folgt der Wutanfall der Eltern. Schlimm?
Nein. Ein Vater oder eine Mutter ist keine pädagogische Maschine. Man ist selbst auch ein Mensch mit allen Gefühlen, die das Menschsein ausmachen. Das für sich zu akzeptieren, ist wichtig. Man kann am Ende eines Tages ja auch mit dem Kind in einer Art Gute-Nacht-Ritual über den Tag reden und fragen: Wie war es für dich heute? Dann kann man auch artikulieren, was man selbst empfunden hat, was gut war und was man vielleicht gerne anders gehandhabt hätte.
- Kinder wollen Regeln überschreiten, Grenzen austesten. Eltern müssen alters- und situationsangemessen reagieren und Grenzen setzen.
- Mitleiden hilft dem Kind nicht. Vielmehr bestätigt es in seiner Hilflosigkeit, das bietet ihm keine Perspektive in der Verzweiflung.
- Tipp: Eltern sollen Mitgefühl statt Mitleid zeigen. Denn: «Mitfühlende Eltern verstehen die Betroffenheit, vermitteln Trost und machen Mut: ‚Ich gebe dir Halt, wenn du ihn brauchst.’», sagt der Erziehungsexperte Jan-Uwe Rogge
Viele Eltern sagen sich in kritischen Situationen zur Beruhigung den Satz «Es ist nur eine Phase, das geht vorbei».
Wobei das nur bedingt richtig ist. Entwicklung ist keine stete Aufwärtsbewegung. Nehmen wir das Beispiel der Trennungsangst: Wenn ein Kind in die Welt hinausgeht und etwas Neues entdeckt, sei es, dass es Laufen lernt, in den Kindergarten kommt oder auch die erste Ferienfreizeit mitmacht, muss es sich von Vertrautem trennen. Da kommen oftmals Unsicherheitsgefühle und Ängste hoch, von denen Eltern dachten, sie seien schon passé. Plötzlich weint das Kind an der Schwelle zum Kindergarten wieder, auf einmal kommt der Schulanfänger nachts wieder ins Elternschlafzimmer.
Ist das problematisch?
Als ich in den 1970er-Jahren ausgebildet wurde, galt Regression als etwas Problematisches. Inzwischen weiss man, dass solche vermeintlichen Rückschritte völlig normal sind. Trennungsängste tauchen im Trotzalter, in der Pubertät und auch im Erwachsenenalter auf.
Natürlich sucht man dann die Nähe zu den Menschen und der Umgebung, die einem bislang Kraft gegeben haben. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele Kinder in kritischen Entwicklungsphasen den Kontakt zu den Grosseltern suchen. Das sind ihre Wurzeln. Die geben auch Halt in Gefühlsstürmen.
Buchtipp:
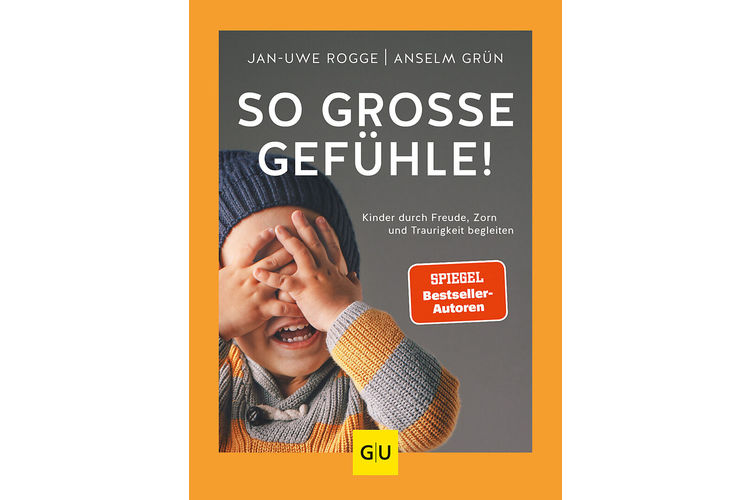
Gräfe und Unzer 2020, 208 Seiten, ca. 16 Fr.


















