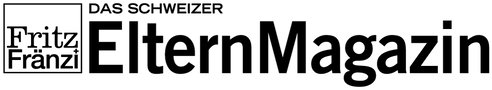Mutter: Superheldin und Sündenbock
Mutterliebe, heisst es, sei das stärkste Gefühl überhaupt: naturgegeben und absolut, auf ewig und mit nichts vergleichbar. Entsprechend existiert in unseren Köpfen ein Bild der guten Mutter: «Bedingungslos, aufopfernd, selbstlos – das sind ihre Attribute. Eine Superheldin, die alles kann und die stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ein Mensch, der unerschöpflich liebt und für alle verfügbar ist.
Jemand, der sein Leben lang Halt schenkt, aber auch irgendwann grossmütig loslässt, wenn es an der Zeit dafür ist.» So beschreiben die Journalistinnen und Buchautorinnen Annika Rösler und Evelyn Höllrigl Tschaikner in «Mythos Mutterinstinkt» ein Mütterideal, das uns allen geläufig ist.
Wir sind geprägt von einem extrem überhöhten Mutterbild.
Gaby Gschwend (1956 – 2017), Psychologin
In der Schweiz war Gaby Gschwend eine der Ersten, die dieses Mutterbild in der Fachliteratur kritisierten. «Beim Muttermythos handelt es sich um extrem überhöhte, idealisierte, romantisierte Vorstellungen von der Mutter, ihrer Bedeutung für das Kind und vom Wesen der Mutter-Kind-Beziehung», hielt die 2017 verstorbene Psychologin und Autorin fest.
Problematische Klischees
«Obgleich diese Bilder nicht realistisch sind und es auch gar nicht sein können, sind wir von ihnen emotional und mental stark geprägt.» So resultierten daraus scheinbar unumstössliche Gewissheiten wie die, dass die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind bedingungslos ist und die Intensität ihrer Gefühle keine Schwankungen kennt. Oder die Annahme, dass eine Mutter alle ihre Kinder gleich lieb hat – und diese nur in ihrer Obhut gedeihen.
Solche Klischees seien in vielerlei Hinsicht problematisch, so Gschwend. Etwa fürs Kind: Wer von seiner Mutter keine Liebe bekomme, suche die Fehler automatisch bei sich – weil es die lieblose Mutter «einfach nicht gibt». Und Frauen könnten am Muttermythos nur scheitern, weil sie ihren Kindern gegenüber natürlich nicht nur positive Gefühle hätten. «Viele fühlen sich deswegen schuldig.»
Mutterschaft – ein zweischneidiges Schwert
Die Überhöhung von Mutterschaft ist ein zweischneidiges Schwert: Man stellt die Mutter auf ein Podest – und geht umso härter mit ihr ins Gericht, wenn etwas schiefläuft. Kommt es im Leben erwachsener Menschen zu Brüchen, taucht bald die Frage auf, welchen Anteil die Mutter daran haben könnte, weiss Claudia Haarmann, Therapeutin und Buchautorin. «Die Mutter kann es nur falsch machen», sagt sie, «denn die Vorstellung lautet, dass sie in allem richtig zu sein hat.»
Die Mutterliebe ist ein menschliches Gefühl wie jedes andere – vergänglich, ungewiss, unvollkommen.
Elisabeth Badinter, Philosophin
Woher rührt dieses Ideal der Supermutter und was bewirkt es? Wissen Mütter wirklich von Natur aus am besten, was Kinder brauchen? Und richten wir den Blick einmal ins Private: Was bewegt Frauen, die ihre Kinder auf dem Weg ins Leben begleiten? Wie prägt eine Mutter ihre Töchter und Söhne? Welchen Einfluss hat die Erfahrung mit ihr auf unseren Umgang mit eigenen Kindern? Diesen und weiteren Fragen geht dieses Dossier nach.
«Die Mutterliebe ist nur ein menschliches Gefühl. Sie ist, wie jedes Gefühl, ungewiss, vergänglich und unvollkommen. Sie ist möglicherweise – im Gegensatz zur weitverbreiteten Auffassung – kein Grundbestandteil der weiblichen Natur», schreibt die französische Philosophin Elisabeth Badinter in «Die Mutterliebe».
Vom Wandel der Mutterliebe
Sie zeigt in diesem Klassiker auf, dass die Vorstellung der bedingungslos liebenden Mutter relativ jung ist. So zitiert Badinter Behördendokumente von 1780, die belegen, dass von 21'000 Kindern, die in Paris auf die Welt kamen, nur 1000 von ihren Müttern gestillt wurden. «Weitere Tausend», hielt ein Polizeileutnant namens Lenoir fest, «geniessen das Privileg, im Elternhaus von Säugammen gestillt zu werden. Alle anderen werden im zartesten Alter bei einer Pflegemutter untergebracht, die unter Umständen weit weg lebt.»
Ein Umstand, der Fragen aufwerfe, findet Badinter: «Wie kann man sich erklären, dass der Säugling in einer Zeit, da die Muttermilch und die mütterliche Pflege für ihn eine grössere Chance zu überleben bedeuteten, fremden Händen überlassen wird? Woran liegt es, dass sich die gleichgültige Mutter des 18. Jahrhunderts in die besorgte des 19. und 20. Jahrhunderts verwandelt hat?»
Eine ganz neue Sicht auf das Kind
Dieselben Fragen stellte sich Autorin Gaby Gschwend. In «Mütter ohne Liebe» zeichnet sie nach, wie die Bedeutung von Mutterschaft im Lauf der Zeit variierte. «Noch weit bis ins 18. Jahrhundert war Mutterliebe mit keinem speziellen sozialen oder moralischen Wert verbunden», schreibt Gschwend. «Im Allgemeinen zählten Kinder nicht viel. Vor allem von Frauen, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten mussten, wurden sie nicht selten als Unglück betrachtet.»
Nach dem Wochenbett seien Kinder Pflegefamilien und auf Bauernhöfen dem Gesinde überlassen worden. Im Bürgertum kamen sie auf Pensionate, damit die Mutter repräsentieren oder als Hausmutter amten konnte. Sie half im Geschäft oder Handwerk ihres Gatten mit und befahl Arbeiter und Hausangestellte.
Bis ins 18. Jahrhundert starb jedes dritte Kind vor dem ersten Geburtstag. Zwar habe Armut viele Frauen genötigt, ihr Kind wegzugeben, räumt an der Stelle Philosophin Badinter ein. Dies erkläre aber nicht die hohe Säuglingssterblichkeit in allen sozialen Schichten, argumentiert sie mit Verweis auf Frauen, «denen es durchaus möglich war, ihre Kinder bei sich aufzuziehen und sie zu lieben, und die es jahrhundertelang nicht getan haben. Offenbar waren sie der Ansicht, diese Beschäftigung sei ihrer unwürdig, und daher beschlossen sie, sich dieser Last zu entledigen. Sie taten das übrigens, ohne den geringsten Skandal auszulösen.»
Noch zur selben Zeit schlug die Geburtsstunde eines neuen Mütterideals. In «Émile», dem meistgelesenen Erziehungsbuch der Weltliteratur, eröffnete Jean-Jacques Rousseau 1759 eine neue Sicht aufs Kind: Er beschrieb es als Individuum, das der Fürsorge bedarf. Der Mensch, so die Überzeugung des Genfer Aufklärers, sei von Natur aus gut. Doch entfalteten sich seine Anlagen nicht von allein, er brauche dafür Anleitung. Dafür hatte Rousseau die Mutter im Blick – als Gebärende und Nährende sei sie dazu prädestiniert, das Gute im Menschen zu bewahren.
Wie die Mutter aufs Podest kam
Die fortschreitende Industrialisierung machte solche Ideen mehrheitsfähig. Menschen zogen in die Städte, es vollzog sich eine Trennung zwischen Haushalt und Arbeitsplatz. Der Wohlstand stieg, die bürgerliche Mittelschicht wuchs. «In der Tat wurde es zu einer zentralen Komponente des bürgerlichen Status, dass ein Mann auf die produktive Arbeitsleistung seiner Frau verzichten konnte», schreibt Historiker Steven Mintz im Sammelband «Mutterschaft, Vaterschaft».
Während Mutterschaft in Arbeiterfamilien zweitrangig blieb, wurde Erziehung im Bürgertum zur bewussten Angelegenheit. «Es verstärkte sich die Überzeugung, dass Frauen – frei von den korrumpierenden Einflüssen der Wirtschaft und Politik – eine besondere Fähigkeit hätten, in Kindern Charakterzüge auszubilden, auf die eine freie Gesellschaft angewiesen ist», so Mintz. Und: «Im Bürgertum war Kindererziehung zunehmend mit einem Einflössen von Schuldgefühlen verbunden.»

Das Bild von der Mutter, die ausschliesslich Mutter – weil von Natur aus dazu berufen – ist, hielt sich fast 200 Jahre lang. Zwar bewirkten moderne Empfängnisverhütung und Feminismus Veränderungen. Sie vermochten aber nicht zu demontieren, was Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm als Ideal der intensiven Mutter bezeichnet. «Es basiert auf der tief verankerten gesellschaftlichen Überzeugung, dass eine Mutter alles Erdenkliche für ihr Kind tun soll und in jedem Fall dessen wichtigste Bezugsperson bleiben muss.»
Mütter in der Bindungsfalle
Dieses Credo habe sich zuletzt sogar intensiviert, so Stamm. Gründe dafür gebe es viele. Zum Beispiel habe die Frauenpolitik weibliche Berufstätigkeit als Garant für Freiheit propagiert, Mutterschaft aber weiterhin als Privatsache betrachtet – «die Hauptzuständigkeit für das Kind blieb bei der Frau». Dahinter steht laut Stamm der unerschütterliche Glaube, dass ein Kind für die optimale Entwicklung seine Mutter braucht.
Befeuert werde er nicht nur von Traditionalisten, sondern auch von einseitig interpretierten und oft überholten Annahmen der Bindungstheorie: «Seit Beginn des neuen Jahrtausends erobert sich die Bindungstheorie ihren Platz zurück, den sie in den 1970er-Jahren innehatte. Bemerkenswert ist, dass dieser Siegeszug mit dem sorgenvollen Blick auf die abwesende Mutter – einmal mehr – dann einsetzte, als Frauen in grosser Zahl auf den Arbeitsmarkt zurückkehrten.»
Dein Alltag ist ihre Kindheit: Dieser Satz fühlt sich für viele Mütter so an, wie nachts auf einen Legostein zu treten.
Annika Rösler & Evelyn Höllrigl Tschaikner, Buchautorinnen
In den 1970ern weckten Forscherinnen und Forscher wie John Bowlby, Mary Ainsworth oder Donald Winnicott das Bewusstsein dafür, dass eine sichere Bindung für die Entwicklung des Kindes zentral ist. Dieser Fokus aufs Kind war wegweisend, nahm aber nur die Mütter in die Verantwortung. So vertrat der britische Kinderarzt John Bowlby zunächst die Ansicht, «dass der Vater von keinerlei direkter Bedeutung für die Entwicklung des Kleinkindes ist».
Sein Kollege Donald Winnicott befand, Frauen allein seien aufgrund ihrer «primären Mütterlichkeit» in der Lage, sich in ihr Kind hineinzuversetzen. Gelinge dies nicht, drohten dem Kind drastische Folgen wie etwa Autismus. Zwar prägte Winnicott später den Begriff der «good enough mother», der hinreichend guten statt perfekten Mutter. Von der Mutter als wichtigster Bezugsperson wich er kaum ab. Und betonte: Für eine gute Beziehung zum Kind sei es zentral, dass die Frau ihre Mutterschaft mit Freude ausübe.
Kinder als moralische Instanz
Es scheint, als hallten seine Mahnrufe bis heute nach: «Dein Alltag ist ihre Kindheit», lautet Sinnspruch Nummer eins in Mütter-Communitys. «Ein Satz, der sich für viele Mütter so anfühlt, wie nachts ungebremst auf einen Legostein zu treten», finden die Journalistinnen Annika Rösler und Evelyn Höllrigl Tschaikner. «Es geht nicht mehr darum, Kinder zu bekommen und eine Strecke des gemeinsamen Lebenswegs mit ihnen zu bestreiten, sondern auch darum, dabei möglichst glücklich zu sein. Eine glückliche Mutter ist eine Mutter von glücklichen Kindern. Wobei die Kinder hier zu einer Art moralischen Instanz erhoben werden.»
Wird die Welt rau und ungastlich, stehen Kind und Familie für den sicheren Ort und werden entsprechend gebraucht.
Claudia Haarmann, Therapeutin
Verstärkt wird die aufopferungsvolle Mutterschaft durch gesellschaftlichen Optimierungsdruck, ist Sozialforscherin Stamm überzeugt. «Wir glauben, dass wir Kinder schleifen können, bis sie bestimmten Vorstellungen entsprechen.» Dahinter stehe eine Haltung, die das Kind als Gradmesser elterlichen Erfolgs betrachte und es somit zum Wettbewerbsfaktor mache. «Kinder sollen sich nicht mehr innerhalb der Norm entwickeln, sondern am besten darüber hinaus.»
Diese Förderverantwortung falle primär den Frauen zu. «In der Schweiz entspricht es der Realität, dass Schulen bei Bedarf die Mütter anrufen und nur in Notfällen die Väter.»

Zufluchtsort Kind
Nicht zuletzt, dies vermuten Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm, Philosophin Elisabeth Badinter und Therapeutin Claudia Haarmann gleichermassen, sind es unsichere Zeiten, die zur Überstilisierung von Mutterschaft beitragen. «Zufluchtsort Kind» nennt Haarmann das Phänomen: «Wird die Welt rau und ungastlich, ist es menschlich, eine Hoffnung zu hegen. Dann stehen das Kind und die Familie für den sicheren Ort und werden in dem Sinne gebraucht.»
Eine Flucht ins «Natürliche» beobachtet Badinter. Immer mehr Frauen, stellt sie im Bestseller «Der Konflikt» fest, seien entmutigt von der harten Arbeitswelt. Sie liessen sich verführen vom neuen, biologisch geprägten Feminismus. Dieser fordere nicht mehr die Gleichheit der Geschlechter, sondern betone vielmehr deren Unterschiede.
Die Mehrheit der Weltbevölkerung geht mit Kindern anders um als wir.
Heidi Keller, Psychologin
Im Gegensatz zur Frauenbewegung, die Mutterschaft als Begleiterscheinung im Leben einer Frau betrachtete, begreife eine neue Generation von Feministinnen Mutterschaft «als die zentrale Erfahrung der Weiblichkeit, auf deren Grundlage eine neue, menschlichere und gerechtere Welt entstehen könne».
Dieser Feminismus verherrliche Zyklus, Schwangerschaft und Geburt – sowie die Natur als über alles erhabene Referenzgrösse. «So empfinden es die Frauen dann als Erleichterung, für einige Jahre zu Hause zu bleiben, um jene wirklich guten Mütter zu sein, die ihre eigenen Mütter nicht waren, und aus ihren Kindern ihr Lebenswerk zu machen. Sie rühmen sich, authentischer, weniger konsumorientiert und naturverbundener zu sein.»
Andere Länder, andere Sitten
Bei allem Überfokus auf das Kind geht vergessen, dass es anderswo anders läuft – und Kinder sich trotzdem gesund entwickeln. Heidi Keller, Psychologieprofessorin im Ruhestand, untersuchte während Jahrzehnten, wie Kinder in verschiedenen Kulturen aufwachsen. Ihr Fazit: In allen Erdteilen sind Gemeinschaften davon überzeugt, dass sie mit dem Nachwuchs auf die einzig richtige Art und Weise verfahren – «die kann sehr unterschiedlich aussehen».
In dörflichen Gemeinschaften Madagaskars etwa besteht die Hauptaufgabe der Mutter darin, das Kind zu stillen, während seine Erziehung ältere Kinder übernehmen. Undenkbar wären in Teilen Kameruns oder Indiens mütterliche Verhaltensweisen, die hierzulande als fürsorglich gelten: etwa mit dem Kind spielen. «Solche Erfahrungen machen Kinder dort unter ihresgleichen», sagt Keller, «denn viele Interaktionsformen zwischen Jungen und Alten, gerade Blickkontakt, sind hierarchisch ritualisiert.»

In westlichen Industriestaaten hingegen gilt eine Mutter, die ihrem Kind die ungeteilte Aufmerksamkeit verweigert, als desinteressiert. «In unserer Kultur ist der Eins-zu-eins-Austausch erwünscht», weiss Keller. «Ein Grossteil der Weltbevölkerung handhabt es anders: Da hat ein Kind eine Vielzahl von Ansprechpersonen, Kommunikation läuft oft simultan. Es hört mehreren Menschen gleichzeitig zu, beobachtet viel.»
Auch Keller kritisiert die Bindungstheorie – weil sie universelle Gültigkeit beanspruche, aber vom Modell der westlichen Mittelschichtfamilie ausgehe: «Bindungspersonen sind Erwachsene, der Austausch mit ihnen ist exklusiv. Dieses Muster trifft auf die Mehrheit der Weltbevölkerung nicht zu.» Aus ihrer Forschung in Kindertagesstätten weiss Keller: «Da ist man recht flott mit Bindungsklassifikationen, wenn es darum geht, aus einer Momentaufnahme heraus ein Urteil zu fällen.»
Die Diagnose «unsicher gebunden» falle beliebig, sei es, weil ein Kind oft weine oder selten, es forsch oder zurückhaltend sei. Vorurteile träfen meist die Mutter. «Der Anspruch, auf die Bedürfnisse des Kindes stets feinfühlig zu reagieren, überfordert viele Frauen», so Keller. «Manche bis zur Erschöpfung.»
Barrieren für modernes Mutterbild
Der gängige Vorschlag, dass Mütter gelassener sein sollten, greife zu kurz, findet Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm. «Solche Forderungen sind einseitig, weil sie davon ausgehen, dass die übertriebene Hingabe ans Kind eine ausschliesslich individuelle Wahl wäre. Dringender brauchen wir eine Redimensionierung gesellschaftlicher Überzeugungen, wie Mütter zu sein haben, sowie die Überwindung des Vorurteils, Frauen seien die fürsorglichsten Bezugspersonen.»
Viele glauben, dass dies gelingt, wenn Männer mehr Familienarbeit übernehmen, während der Staat in die familienergänzende Betreuung investiert und flexiblere Arbeitsmodelle oder Ausgleichsleistungen wie Elterngeld fördert. Solche Bemühungen gehen laut Stamm in die richtige Richtung, «ob sie langfristig dazu beitragen, ein rückständiges Mutterschaftsideal zu reformieren, bleibt offen».
Mütter müssen sich von der Vorstellung befreien, die wichtigste Person im Leben ihrer Kinder zu sein.
Margrit Stamm, Erziehungswissenschaftlerin
Denn der Glaube, dass nur aufopferungsvolle Mütter gute Mütter sind, sei bei der Mehrheit gebildeter Frauen verbreitet. Egal ob Vollzeitmutter oder erwerbstätig. «Sie meinen, sie seien für ihr Kind auch dann hauptverantwortlich, wenn dieses von anderen betreut wird», sagt Stamm. «Diese Logik ist die grösste Barriere für eine Modernisierung des Mutterbildes.»
Emotionale Überinvestition reflektieren
Deshalb brauche es Mütter, die nicht nur flexiblere Jobs und engagiertere Väter einforderten, sondern in ihren Köpfen auch einen Perspektivenwechsel vollzögen. «Dies bedeutet, dass sie gewillt sind, sich mit ihrem möglicherweise überengagierten Verhalten auseinanderzusetzen», sagt Stamm, «und sich von der Vorstellung zu befreien, die wichtigste Person im Leben ihrer Kinder zu sein.» Die emotionale Überinvestition ins Kind beeinträchtige nicht nur dessen Freiraum, sie verhindere auch geteilte Verantwortung als Eltern.

Aus Umfragen weiss die Forscherin: Frauen erkennen durchaus, dass die hinreichend gute Mutter eine Option wäre. Als Mutter kürzerzutreten, liege aber nicht drin, so ein häufiges Argument, weil der Partner dies nicht richtig kompensiere – und dann Fastfood auftische, das Kind nicht warm genug anziehe, den Haushalt vernachlässige.
Stamms Langzeituntersuchung zur elterlichen Arbeitsbelastung zeigt, dass Mütter im Haushalt weitaus mehr Arbeitsstunden leisten als Väter, selbst wenn die Frauen Vollzeit berufstätig sind. In allen anderen Bereichen überwiegt jedoch die gemeinsam geteilte Arbeitslast. Und: Väter erwirtschaften im Schnitt drei Viertel des Haushaltseinkommens. «Ob wir es gerne hören oder nicht», so Stamm, «auch die volle Lohntüte ist eine Form der Fürsorge.»
Rosinenpicker und Kontrollfreaks
Für das in der Schweiz häufigste Familienmodell – der Vater ist Haupternährer, die Mutter verdient das Zubrot – entscheiden sich Paare in der Regel gemeinsam, weiss Stamm: «Frauen äussern den Wunsch, dass sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen wollen, und übernehmen die Hauptverantwortung fürs Häusliche.»
So konservierten Paare die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die entsprechende Klischees zementiere. Davon zeugten, einmal mehr, Umfragen: «Mütter beklagen sich über unbedarfte Partner, die sich zu Hause die Rosinen herauspicken, während Väter diesbezüglich öfter auf ihre zwei linken Hände und die scheinbar überlegenen Fähigkeiten der Partnerin verweisen.»
Wie ginge es besser? «Eine Voraussetzung ist die Bereitschaft beider, sich selbst infrage zu stellen», glaubt Stamm. «Das heisst zuerst einmal: zu erkennen, dass man in einer Partnerschaft nichts ändern kann, wenn sich nur das Gegenüber ändern soll. Deshalb sollten sich beide für die Situation des anderen sensibilisieren. Dies ist dann der Fall, wenn Männer sich eingestehen, dass ihre Rosinenpickerei oder zur Schau gestellte Hilflosigkeit die Identität ihrer Partnerin als Frau belastet. Und wenn Frauen lernen, ihren Einflussbereich herunterzufahren und abzugeben, ohne die eigene Herangehensweise als Goldstandard zu betrachten.»
Zum Weiterlesen
- Elisabeth Badinter: Die Mutterliebe. Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute. Piper 1980 (nur noch antiquarisch erhältlich).
- Claudia Haarmann: Der Schmerz verlassener Eltern. Kontaktabbruch als emotionales Erbe verstehen und Wege damit umzugehen. Kösel 2024, ca. 30 Fr.
- Claudia Haarmann: Mütter sind eben Mütter. Was Töchter und Mütter voneinander wissen sollten. Kösel 2019, ca. 24 Fr.
- Gaby Gschwend: Mütter ohne Liebe. Vom Mythos der Mutter und seinen Tabus. Hogrefe 2012, ca. 26 Fr.
- Margrit Stamm: Du musst nicht perfekt sein, Mama! Schluss mit dem Supermama-Mythos – Wie wir uns von überhöhten Ansprüchen befreien. Piper 2020, ca. 17 Fr.