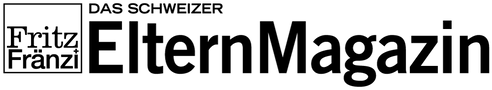Nicht alle Regeln führen zum Ziel
Sie haben gerade ein ausgewogenes Zmittag gekocht. Danach fragt Ihr Kind: «Darf ich noch ein Stück Schoggi?» Oder Sie erfahren, dass es sich in der Mensa Pommes bestellt hat – obwohl es weiss, dass Sie das nicht besonders gern sehen. Solche Situationen kommen in jeder Familie vor – und sie führen zur Grundfrage: Wie viel Einfluss sollen Eltern auf das Essverhalten ihrer Kinder nehmen – und wie offen sollten sie mit «ungesunden» Wünschen umgehen?
Nicht zu viele Regeln
Viele Eltern möchten, dass ihre Kinder sich gesund ernähren – und greifen deshalb zu klaren Regeln: kein Softdrink, keine Süssigkeiten vor dem Znacht, nur ein Dessert pro Woche. Diese Regeln sind gut gemeint. Doch sie können unbeabsichtigte Folgen haben – insbesondere, wenn sie nicht erklärt oder als absolut empfunden werden. Manche Kinder beginnen dann heimlich zu essen oder entwickeln ein schlechtes Gewissen bei bestimmten Lebensmitteln.
Kinder haben von Natur aus ein sehr feines Gespür dafür, wann sie hungrig sind und wann nicht mehr. Doch wenn sie lernen, über den Hunger hinaus zu essen, nur um eine Regel zu erfüllen, geht dieses Gespür nach und nach verloren.
Selbstwahrnehmung statt Kontrolle
Was Kinder wirklich brauchen, ist eine Kombination aus Orientierung und Vertrauen – statt starrer Vorgaben. Eltern können dieses Vertrauen stärken, indem sie dem Kind zutrauen, selbst mitzuentscheiden: Möchtest du noch eine Portion? Spür mal in deinen Bauch – hast du noch Hunger? Solche Fragen fördern die Selbstwahrnehmung – und die Erfahrung, gehört zu werden.
Auch die Umgebung zählt: Wenn es zu Hause nie Schoggi oder Chips gibt, erscheinen diese Lebensmittel anderswo besonders verlockend. Kinder lernen dann nicht, damit umzugehen, sondern nur: Das ist verboten. Kinder brauchen Gelegenheiten, auch mal zu viel zu essen – und selbst zu merken, wie sich das anfühlt. Solche Erfahrungen fördern Selbstkompetenz – mehr als jede Essensregel.
Ein entspannter Umgang mit Essen beginnt mit Offenheit – aber auch mit Haltung.
Rituale geben Sicherheit
Auch Rituale helfen. Zum Beispiel: Sonntag ist Desserttag. So entsteht Verlässlichkeit – ganz ohne Druck. Kinder können sich aktiv einbringen, mitentscheiden und erleben: Ich werde ernst genommen. Statt täglich über Ausnahmen zu diskutieren, schafft ein gemeinsames Ritual Klarheit und Entspannung. Vielleicht darf das Kind sogar mitbestimmen, was es gibt – Pudding, Glace oder Früchtespiess?
Vertrauen statt Bewertung
Ein entspannter Umgang mit Essen beginnt mit Offenheit – aber auch mit Haltung. Offenheit heisst nicht: Alles ist erlaubt. Sondern: Kinder einbeziehen, ehrlich erklären und ohne moralischen Zeigefinger begleiten. Warum gibt es bei uns selten Cola? Warum ist Sirup eine Alternative? Warum essen wir zu bestimmten Zeiten gemeinsam? Solche Erklärungen schaffen Verständnis – wenn sie auf Augenhöhe und altersgerecht formuliert sind.
Wer vor dem Kind ständig über Kalorien spricht oder mit schlechtem Gewissen auf das Dessert verzichtet, sendet unterschwellig Botschaften wie: «Süsses ist gefährlich» oder «Ich darf das nicht». Besser ist eine Sprache, die Genuss ohne Bewertung vermittelt: «Ich habe heute mehr Lust auf etwas Frisches» klingt ganz anders als «Ich darf keine Schoggi essen».
Lernen durch Fehler
Und schliesslich: Fehler sind kein Rückschritt, sondern Lernmomente. Wenn ein Kind an einem Geburtstag drei Becher Cola trinkt und danach Bauchweh hat, ist das keine Katastrophe, sondern ein wertvoller Erfahrungswert. Ebenso, wenn Pommes zum Zmittag nicht lange sättigen: Kinder erleben dabei am eigenen Körper, welche Lebensmittel ihnen guttun – und welche nicht.
Vertrauen bedeutet: dem Kind zutrauen, aus solchen Erfahrungen zu lernen. Nicht alles kommentieren. Nicht jede Wahl bewerten. Sondern begleiten, da sein – und langfristig dabei helfen, dass das Kind ein stabiles, positives Verhältnis zum Essen entwickeln kann.
5 Regeln, die ihren Zweck verfehlen
- «Erst der Apfel, dann die Schoggi»: Sorgt dafür, dass das Kind Vitamine bekommt – klar. Aber es kann auch dazu führen, dass es über den Hunger hinaus isst, nur um zur Schokolade zu kommen.
- «Süsses nur am Tisch»: Fördert bewusstes Essen und Rituale. Doch wenn das Kind lieber alleine geniessen möchte, entsteht Frust. Dann gibt es vielleicht eine zweite Portion heimlich.
- «Pommes sind verboten»: Was verboten ist, wird besonders attraktiv. Und zwar genau dann, wenn Eltern nicht dabei sind. Besser: gemeinsam darüber reden, was es sonst noch gibt.
- «Softdrinks gibts bei uns nicht»: Führt dazu, dass Kinder bei jeder Gelegenheit ausser Haus masslos zugreifen. Tipp: verdünnter Sirup – schmeckt süss, ist aber kontrollierbar.
- «Aufessen ist Pflicht»: Das schadet dem natürlichen Sättigungsgefühl. Besser: Das Kind selbst schöpfen lassen – nachnehmen ist jederzeit erlaubt.