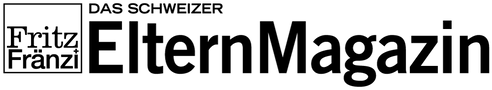Es begann ganz harmlos, in den Campingferien. Mein vierjähriger Sohn beobachtete zwei ältere Jungs, wie sie rote Luftballons mit Wasser füllten und sich unter Juchzen und Gebrüll damit bewarfen. «Mama», sagte er mit leuchtenden Augen, «ich will auch eine Bombe haben!» Arglos kaufte ich ihm ein paar Ballons und hielt gerne als Opfer für seine Attacken her. Ich ahnte nicht, dass dies erst der Beginn eines immer länger werdenden Wunschzettels nach Waffen sein würde.
Wasserpistolen und Piratensäbel, Messer, Laserschwerter und Nerf Guns: Spielzeugwaffen sind in Kinderzimmern fast ebenso verbreitet wie die Paw Patrol. Auch die Spielwarenabteilungen der Kaufhäuser rüsten pünktlich vor jedem Weihnachtsfest auf. Immer schon gab es bei vielen Eltern deswegen Unbehagen.
Spielen ist nicht die Realität, und das wissen Kinder.
Wiebke Waburg, Pädagogin
In Zeiten des Ukraine-Kriegs und Nachrichten über Amokläufer an Schulen zucken manche Mütter und Väter umso mehr zusammen, wenn der Nachwuchs begeistert mit Pistolen herumballert. Doch sind diese Bedenken berechtigt? Können Spielzeugwaffen tatsächlich die Gewaltbereitschaft fördern? Und was ist es überhaupt, das schon kleine Kinder so sehr an Kampfgeräten fasziniert?
«Zunächst einmal ist es ganz wichtig, zu wissen: Spielen ist nicht die Realität, und das wissen Kinder», sagt Wiebke Waburg, die als Professorin am Institut für Pädagogik der Universität Koblenz-Landau unter anderem zu Spielzeugpädagogik forscht.
Sie rät Eltern zu Gelassenheit. Kleine Buben, die mit Playmobil-Kanonen aufeinander zielen, wollten später nicht automatisch in einen Krieg ziehen. Schliesslich würden Kinder, die gerne mit Eisenbahnen spielen, auch nur in den seltensten Fällen Lokführerin oder Zugbegleiter werden.
Sich machtvoll erleben
Die kindliche Faszination für Waffen habe mehrere Aspekte, sagt Waburg. Zum einen ist da der Reiz des Verbotenen. «Gewehre, Messer oder Bögen sind ja stark mit dem Erwachsenenalter assoziiert», sagt die Pädagogikprofessorin. Mit Spielzeugwaffen könnten Kinder sich in einer Erwachsenenrolle ausprobieren «und sich dadurch auch machtvoll erleben», sagt sie.
Ein weiterer Faktor sei die Verarbeitung von Gewaltdarstellungen: «Was sehe ich im Fernsehen, was höre ich im Kindergarten?» Das Spiel mit Spielzeugwaffen kann Kindern bei der Einordnung des Gesehenen helfen.
Im Als-ob-Spiel können Kinder beide Rollen von Waffen erproben: Schutz und Gewaltabsicht.
Allan Guggenbühl, Psychologe und Psychotherapeut
Beim Spiel mit Wasserpistolen oder Nerf Guns, die mittels Luftdruck Schaumstoffpfeile abfeuern, kommt laut Waburg auch noch der Wettkampfcharakter hinzu: «Man erlebt dabei, dass man gewinnt», sagt sie. «Diese Spielfreude spielt auch eine grosse Rolle.»
Ein existenzielles Grunddilemma
Der Schweizer Psychologe und Experte für Jugendgewalt, Allan Guggenbühl, geht noch einen Schritt weiter. Er erklärt die kindliche Faszination für Schiessgeräte mit einem «existenziellen Grunddilemma», das diese verkörperten – dem Umgang mit Gewalt.
Waffen hätten zwei Funktionen: «Einerseits Schutz, andererseits Gewaltabsicht.» Bereits vierjährige Kinder würden besagtes Dilemma spüren, das sich im Objekt der Spielzeugwaffe ausdrücke: die Chance, sich zu verteidigen, aber auch die Möglichkeit, selbst zum Bösewicht zu werden, der andere Menschen angreift oder mittels der Waffe Macht über sie ausübt.
Im sogenannten Als-ob-Spiel oder Rollenspiel, bei dem Kinder sich eine Fantasiewelt konstruieren, könnten sie, wie Guggenbühl sagt, beide Rollen erproben. Ohne schlimme Folgen, denn schliesslich ist alles nur ein Spiel.
Im Spiel vollziehen Kinder dabei sogar einen wichtigen Entwicklungsschritt. Sie lernen den Umgang mit Gefühlen, wie der deutsche Kinderpsychotherapeut Bernhard Moors einmal sagte: «Was heisst das überhaupt, Wut zu haben, was heisst es, Aggressionen zu verspüren, sich wirksam oder mächtig zu fühlen? Das ist ja mit Worten nicht zu erklären.» Spielzeugwaffen könnten den Kindern dabei als Ausdrucksmittel helfen, «ohne dass man sich selber oder andere Menschen verletzt».
Vom Geschlecht abhängig
Bei all dem stellen Experten in ihren Beobachtungen grosse Unterschiede zwischen den Geschlechtern fest. «Pistolen, Pfeile – all das fasziniert Jungs viel mehr als Mädchen», sagt Allan Guggenbühl. Woran das liegt, darüber ist sich die Wissenschaft bislang nicht einig. Valide Untersuchungen sind schwierig durchzuführen.
«Die sozialen Komponenten in Bezug auf Geschlechtskonstruktion beginnen schon sehr früh», sagt die Pädagogikforscherin Waburg. «So ist es sehr schwierig, zu beurteilen, was biologisch ist und wo das Soziale anfängt.» Bereits kurz nach der Geburt würden Eltern mit Buben anders sprechen als mit Mädchen und ihnen bestimmte Eigenschaften zuschreiben, sagt Waburg.
Eltern sollten das kindliche Spiel nicht überbewerten. Das ist oft das eigentliche Problem.
Bernhard Moors, Kinderpsychotherapeut
Die meisten Buben fangen etwa im Alter von vier Jahren zum ersten Mal an, sich für Waffen zu interessieren. Mit acht bis zehn Jahren ist diese Phase in der Regel wieder beendet, auch ohne Einflussnahme der Eltern. Computer- und Internetspiele werden dann wichtiger.
Keine erhöhte Gewaltbereitschaft
Doch nicht erst bei den berüchtigten Ego-Shootern, sondern schon viel früher haben viele Eltern Angst, dass die Kampf- und Kriegsspiele ihrer Kinder deren Gewaltbereitschaft fördern könnten. Kinderpsychotherapeut Bernhard Moors findet diese Sorge jedoch unbegründet. «Die Gefahr ist bei uns Erwachsenen, dass wir schnell werten und überbewerten», sagt er. «Das ist dann oftmals das viel grössere Problem.»
Im ungünstigen Fall könnten Eltern dabei eigene Ängste auf ihr Kind übertragen. Moors rät dazu, das kindliche Spiel nicht zu sehr mit Bedeutung aufzuladen. Denn es gebe keine empirischen Belege für einen Zusammenhang zwischen Spielzeugwaffen und einer erhöhten Gewaltbereitschaft im späteren Leben.
Was wirklich Gewalt erzeugt
Ein viel grösserer Faktor für eine erhöhte Gewaltbereitschaft sei etwa eine aggressive häusliche Umgebung, sagte der Psychologe. Die entstehe beispielsweise durch Kriegs- oder Terrorerfahrung der Eltern oder Kinder. Auch emotionale Vernachlässigung sowie strafende und kontrollierende Eltern können die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen steigern.
«Wenn Kinder schlimmste Traumata erleben», sagt Moors, «kann es im Einzelfall dazu kommen, dass sie später selber zur Waffe greifen.» Traumata machten die einen zu Pazifisten, die anderen zu Kämpfern. Spielzeugwaffen hätten damit jedoch nichts zu tun und seien nur Teil eines harmlosen kindlichen Rollenspiels.
Kinder, die nicht mit Spielzeugwaffen spielen dürfen, finden sie meist noch viel interessanter.
Bernhard Moors, Kinderpsychotherapeut
Tipps für den Umgang mit Spielzeugwaffen
Doch wie sollen Eltern sich am besten verhalten? Therapeut Bernhard Moors hält nichts von pauschalen Verboten. Das sei ohnehin kaum möglich: «Kinder, die am Spielen mit Spielzeugwaffen gehindert werden, finden sie meist noch viel interessanter», sagt er.
Auch ohne Gerät lasse sich Krieg spielen. Zum Schiessen reiche ein Stock – oder der eigene Zeigefinger. Wiebke Waburg rät Eltern ebenfalls von Verboten ab. Eltern würden damit die Spielbedürfnisse ihrer Kinder einfach ignorieren, sie schlimmstenfalls nicht ernst nehmen.
Nicht auf andere Personen zielen
Erlauben Eltern die Kriegsspiele zu Hause, dann führt das, wie Allan Guggenbühl sagt, in der Regel sogar eher zu einer kritischen statt einer bewundernden Haltung der Kinder. Wichtig sei, wie Eltern das Thema einordneten. «Höchst problematisch ist natürlich die Verherrlichung von Krieg», sagt Guggenbühl. Eltern sollten Waffen niemals mit einer Ideologie von Gewalt gleichsetzen, wie es gerade in Kriegszeiten immer wieder passiert. Helfen könnten dagegen klare Spielregeln, die jede Familie für sich selbst definieren dürfe.
«Eine Regel ist: Ziele nicht auf eine andere Person. Und wenn man einen Schwertkampf inszeniert, dann mach lieber ein Turnier als einen Kampf, bei dem der andere stirbt.» Auch sollten Kinderwaffen, so raten die Experten, als Spielzeug klar erkennbar sein. Zum Beispiel durch die Farbgebung, durch eine optische Abhebung von echten Waffen.

Eine riesige Auswahl
Spielen Kinder dennoch, dass im Kampf jemand stirbt, dann könnten Eltern das zum Anlass nehmen, altersgerecht anzusprechen, was Krieg im wirklichen Leben bedeutet. Dass also aus echten Feuerwaffen nicht nur Wasser kommt – oder was sie anrichten können. Einschreiten sollten Eltern immer dann, wenn jemand im Spiel tatsächlich verletzt werden könnte, sagt Wiebke Waburg: «Das ist ein No-Go.»
Entscheiden Eltern sich dafür, ihrem Kind eine Spielzeugpistole zu kaufen, stehen sie vor einer riesigen Auswahl. Wichtig ist es, auf Altersempfehlungen zu achten, auf Sicherheit und eine gute Materialqualität. Wiebke Waburg regt ausserdem an, sich auf ein oder zwei Spielzeuge zu beschränken – Kinder bräuchten nicht drei verschiedene Schiessgeräte.
Für meinen eigenen Sohn habe ich zu Hause mittlerweile klare Regeln aufgestellt: Laserschwerter und altersgerechte, bunte Spielzeugpistolen sind erlaubt. Alles, was allzu sehr an Krieg erinnert, wie Soldaten, Panzer oder Kampfflugzeuge, kaufen wir nicht. Wir sprechen auch am Küchentisch über den Ukraine-Krieg und darüber, dass echte Kämpfe kein Spass sind.
Neulich schrieben wir den Geburtstagswunschzettel für unseren Sohn. Er wünsche sich einen Roboter, sagte er, der echte Feuerbälle werfen kann. «Aber nur ganz kleine, damit unser Haus nicht abbrennt.» Immerhin, dachte ich, denkt er jetzt schon die Sicherheit der Familie mit. Und zur Not haben wir ja immer noch die Wasserbomben zum Löschen.