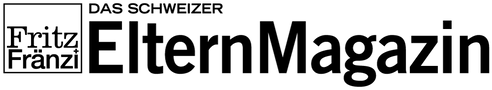«Verweigerung ist nicht gleich Autismus»
Frau Kamp-Becker, wie macht sich eine Autismus-Spektrum-Störung bemerkbar?
Sie vollzieht sich nicht im Verborgenen. Autismus ist eine beobachtbare Störung und zeigt sich durch basale Auffälligkeiten in Blickkontakt, Mimik und Gestik, aber auch, was das affektive Mitschwingen, also die emotionale Reaktion einer Person auf die Gefühle anderer betrifft. All dies ist bei Menschen mit Autismus reduziert.
Bereits im Säuglingsalter fehlt die soziale Orientierung, die Babys sonst zeigen, indem sie Blickkontakt aufnehmen oder über soziales Lächeln versuchen, Mimik zu imitieren. In retrospektiven Befragungen berichten Eltern von frühen Auffälligkeiten in diese Richtung. Die sie, insbesondere, wenn es noch ältere Geschwister gibt, schon bald bemerken.
Ein Kind mit einer autistischen Störung zeigt auf den Gegenstand, stellt aber keinen Blickkontakt zur Bezugsperson her. Das ist eines der stabilsten Frühsymptome.
Wir wissen, dass diese Auffälligkeiten im Laufe der Entwicklung relativ stabil bleiben und weder durch Intelligenz noch Reifung so stark beeinflussbar sind wie andere Entwicklungsabweichungen. Diese Symptome treten in Kombination mit repetitiven, stereotypen Verhaltensweisen auf, die von einer Intensität sind, dass sie den Alltag beeinträchtigen.
Wenn es um so grundlegende Auffälligkeiten geht, müsste eine Abklärung rasch Klarheit schaffen.
Tatsächlich kann ich als erfahrene Diagnostikerin relativ schnell beurteilen, wo keine Autismus-Spektrum-Störung vorliegt: Wenn ich nichts sehe, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit nichts da. Kompliziert wird es, sobald mögliche Hinweise vorliegen. Weil viele Symptome, die bei Autismus auftreten können, auch bei anderen Störungsbildern vorkommen. Wenn ein Kind sehr unruhig ist, Defizite in der Aufmerksamkeit oder eine erhöhte Impulsivität hat, muss ich unter Umständen erst mal eine ADHS in Betracht ziehen.

Und dann?
Dann gilt es, diese Symptomatik zuerst zu behandeln, die Eltern entsprechend zu instruieren und später nochmals zu schauen: Sind da noch immer Auffälligkeiten, die auf Autismus hindeuten könnten? Dasselbe, wenn ein Kind ängstliches oder oppositionelles Verhalten zeigt – Verweigerung ist nicht gleich Autismus. Oft ist ein schrittweises Ausschlussverfahren nötig.
Wir haben auf Grundlage umfangreicher Daten erforscht, welches die wichtigsten Merkmale sind, die eine Autismus-Spektrum-Störung von anderen Erkrankungen abgrenzen. Damit wollen wir Haus- und Kinderärztinnen ein Instrument an die Hand geben, mit dem sie ihren Blick schulen und besser einschätzen können, wann eine Autismus-Abklärung angezeigt wäre.
Was sind denn mögliche Warnzeichen?
Nehmen wir Blickkontakt als Beispiel. Es geht weniger darum, ob ein Kind einen anschaut oder nicht, sondern inwiefern es seinen Blick nutzt, um soziale Interaktion zu steuern. Weckt etwa ein Gegenstand das Interesse eines einjährigen Kindes, wird es darauf zeigen – und sich mit dem Blick zu seiner Bezugsperson vergewissern, dass diese den Gegenstand auch sieht. Fehlt diese geteilte Aufmerksamkeit, ist dies eines der stabilsten Frühsymptome für Autismus. Ein Kind mit einer autistischen Störung zeigt auf den Gegenstand, stellt aber keinen Blickkontakt zur Bezugsperson her.
Wie äussern sich Auffälligkeiten bei älteren Kindern?
Etwa dadurch, dass das Kind mich zwar anschaut, aber nicht reagiert, wenn ich anfange, ständig auf die Uhr zu gucken – es registriert diese Signale nicht als Zeichen dafür, dass zum Beispiel ein Sprecherwechsel angebracht wäre. Auch fehlt das Finetuning im Blickkontakt, den Personen ohne Autismus intuitiv aufeinander abstimmen.
Man guckt nicht durchgängig, sondern zwischendurch wieder weg, lässt den Blick kurz abschweifen, um ihn dann wieder auf die andere Person zu richten. Bei Kindern mit Autismus fehlt diese Abstimmung. Sie wirken desinteressiert, weil sie den Blickkontakt abbrechen, wo Personen ohne Autismus ihn halten würden, oder irritieren ihr Gegenüber, weil sie es fixieren oder scheinbar ins Leere starren. Auch nutzen sie Mimik und Gestik wenig.
Wo die Symptomatik weniger klassisch daherkommt, ist die Übereinstimmung leider nicht gut.
Worauf achten Sie da?
Wenn das Kind etwas nicht mag, richtet es dann seinen mimischen Ausdruck an seinen Interaktionspartner? Oder schaut es zwar ärgerlich oder traurig drein, guckt dabei aber irgendwohin? Inwiefern nutzt es Gestik als Kommunikationsmittel? Wir stellen Kindern, die über gute Sprachfähigkeiten verfügen, unter anderem die Aufgabe, etwas pantomimisch darzustellen.
Menschen mit Autismus erzählen die Geschichte, ohne Gestik zu nutzen, und erfassen soziale und emotionale Aspekte des Inhalts nicht altersentsprechend. Allgemein wirken ihr Blickkontakt, ihre Mimik, Gestik und Sprache nicht aufeinander abgestimmt. Weil sie diese Ausdrucksformen und deren Nuancen bei anderen schwer deuten können, haben sie auch Mühe, Gesprächsinhalte oder Sprechweise dem Gegenüber anzupassen. Das erschwert das Initiieren und Aufrechterhalten von Gesprächen. Was alle Autistinnen verbindet, sind Probleme bei der sogenannten Theory of Mind.
Also eingeschränkte Fähigkeiten, sich in andere Personen hineinzuversetzen.
Genau. Das ist eine Kernproblematik, der wir im Rahmen einer standardisierten Verhaltensbeobachtung auf die Spur zu kommen versuchen. Bei kleineren Kindern geschieht das oft spielerisch. Zum Beispiel zeigen Kinder mit einer autistischen Störung häufig eine reduzierte Fähigkeit zu interaktiven Rollenspielen – sie können nicht «so tun als ob». Wir schauen mit Kindern auch Bilderbücher an, die Freundschaft, Streit oder Gefühle thematisieren. Dabei darf man das Kind nicht gezielt leiten.
Das heisst?
Wenn ich auf ein weinendes Gesicht zeige und frage, wie es der Person hier gehe, verfügen viele autistische Kinder über kognitive Konzepte, um zu wissen: Wer weint, ist traurig. Daher weisen wir nicht auf diese Aspekte hin, sondern beobachten nur. Bei älteren Kindern und Jugendlichen umfasst die Diagnostik viele Gesprächsanteile, da schauen wir, inwiefern Wechselseitigkeit oder die Fähigkeit zum Smalltalk gegeben ist.
Wie häufig sind Fehldiagnosen?
Das ist schwer zu beurteilen. Klinische Diagnosen beruhen auf Verhaltensbeobachtungen, da kommt es darauf an, wie man die Störungskriterien auslegt. Man hat untersucht, inwiefern Einschätzungen von Experten aus unterschiedlichen Kliniken übereinstimmen, wenn sie in Aufzeichnungen von Verhaltensbeobachtungen beurteilen sollen, ob Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung vorliegt. Da zeigt sich bei stark ausgeprägten Fällen eine hohe Übereinstimmung – da, wo die Symptomatik weniger klassisch daherkommt, ist die Übereinstimmung leider nicht gut.