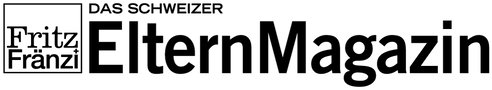Wie kann ich meinen Sohn vor Gewaltinhalten schützen?
1. Wisch, wisch, wisch … all diese Kurzvideos. Da geht die Konzentration doch flöten!
Sie dauern wenige Sekunden – und fesseln für Stunden: Kurzvideos. Tiktok hat sie, Instagram auch, Snapchat ebenfalls. Ob sie badende Igelchen zeigen oder verkürzte politische Messages, Susanne Walitza, Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, sieht darin ein Problem: «Das Gehirn gewöhnt sich an die Kürze der Videos und Informationen und das Lesen langer Texte fällt immer schwerer.» Auf alle Fälle dann, wenn dies nicht geübt werde. So rät die Jugendpsychiaterin, Kinder und Jugendliche immer wieder auch für längere Texte und Bücher zu motivieren.
Chatverläufe kontrolliert man nicht. Ein Kind hat ein Recht auf Privatsphäre. Man liest ja auch nicht sein Tagebuch.
Daniel Süss, Medienpsychologe
2. Soll ich mit meiner Tochter auf Instagram «befreundet» sein?
Ist sie einverstanden, spricht nichts dagegen. Aber: «Sich aufzudrängen oder es verpflichtend zu machen, empfehle ich nicht», sagt Daniel Süss, Professor für Medienpsychologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und Kommunikationswissenschaft an der Universität Zürich. Das gelte auch für das Kontrollieren von Chatverläufen.
«Ein Kind hat ein Recht auf Privatsphäre. Man liest ja auch nicht sein Tagebuch.» Wichtiger als Kontrolle seien Regeln, Aufklärung über Risiken und steter Dialog: «Kinder müssen wissen, dass sie sich bei allen Schwierigkeiten an die Eltern wenden können – ohne befürchten zu müssen, dass diese gleich alles verbieten.»
3. Hilfe, unser Sohn will Influencer werden!
«Der Wunsch ist nachvollziehbar und nicht besorgniserregend», so Medienpsychologe Daniel Süss. Immer schon habe es Traumberufe gegeben, Film- oder Musikstar etwa. Nun eben auch Influencerin oder Influencer. «Die meisten Heranwachsenden mit diesem Wunsch haben nicht die realistische Erwartung, dieses Berufsziel zu erreichen.»
Mit zunehmendem Alter werde Jugendlichen auch bewusst, wie stressreich der Job sei und mit wie viel Kommerzialisierung und wenig Freiheit er einhergehe. «Und wenn nicht, können Eltern den falschen Vorstellungen ihres Kindes mit einem entsprechenden Realitätscheck begegnen.»
4. Mein Kind ist erst 11, möchte aber unbedingt auf Tiktok.
Das Mindestalter vieler sozialer Netzwerke liegt bei 13, bei Whatsapp gar bei 16 Jahren. «Tatsächlich sind aber auch viele jüngere Kinder bereits auf Tiktok oder Instagram aktiv», sagt Yvonne Haldimann, Projektleiterin Jugend und Medien beim Bundesamt für Sozialversicherungen. Zumal sich Altersbeschränkungen leider nach wie vor leicht umgehen liessen.
Kinder unter 11 Jahren sollten nicht auf Tiktok sein.
Yvonne Haldimann, Projektleiterin
«Äussert ein Kind bereits vor 13 Jahren ein starkes Interesse für diese oder jene Plattform, können Eltern sich überlegen, ob sie einen früheren Einstieg je nach Reife des Kindes zulassen.» Dass die Aktivitäten dann umso enger zu begleiten sind, versteht sich. Und: Für Kinder unter 11 Jahren empfiehlt Haldimann Tiktok definitiv nicht.
5. Von Kriegsbildern bis Porno: Kann man Heranwachsende davor schützen?
Hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Selbst wenn Kinder kein Handy besitzen, können sie über Geräte von Freundinnen und Kollegen mit ungeeigneten Inhalten in Kontakt kommen. 36 Prozent der 12- bis 19-Jährigen haben laut James-Studie 2024 schon Videos mit Gewaltinhalten auf dem Handy oder Computer gesehen.
Bei Pornovideos sind es 52 Prozent der Jungs und 16 Prozent der Mädchen. Leider komme es häufiger vor, als man denke, dass schon Primarschüler über soziale Medien mit verstörenden Bildern konfrontiert würden, sagt Kinder- und Jugendpsychiaterin Susanne Walitza. «Die Erinnerungen an solche Bilder können Kinder sehr belasten.»
Um das zu verhindern, lassen sich auf Tiktok via «Eingeschränkter Modus» verschiedene Sicherheitseinstellungen vornehmen. Via «Begleiteter Modus» kann sich ein Elternteil auch mit dem Konto des Kindes verbinden. Bei Snapchat erhalten Eltern über «Familienzentrum» mehr Einblick in die Aktivitäten ihrer Kinder.
Anstelle von Youtube empfiehlt sich Youtube Kids. Und Instagram ist dabei, weltweit «Teen-Konten» mit strengeren Einstellungen für sensible Inhalte einzuführen. Auch ist es beispielsweise bei Tiktok und Instagram möglich, Content-Vorschläge zurückzusetzen, den Algorithmus also einem Reset zu unterziehen. Eltern tun gut daran, die Tools zu nutzen. Darüber hinaus gilt aber auch: Offen bleiben und nichts tabuisieren – damit das Kind sich traut, über Belastendes zu sprechen.
6. Seit meine Tochter auf Instagram ist, findet sie sich hässlich.
All die perfekten Bilder … Sie lassen einen schon mal hadern mit sich selbst, umso mehr, wenn man ein Teenager ist. Auch hier hilft es, kritisches Bewusstsein zu fördern. Etwa, indem man darauf hinweist, dass für ein anscheinend perfektes Bild zuerst x weniger perfekte Versuche gemacht wurden. Oder wie sehr sich mit Filtern nachhelfen lässt.
Medienwissenschaftlerin Maya Götz rät zudem dazu, Gegenlesearten anzubieten: «Boah, dieses Bild zeigt einen Körper, der gar nicht möglich ist. Das finde ich nicht gut», könne man zum Beispiel sagen. Oder dazu ermuntern, sich mal anderswo umzusehen. Ein Vorteil sozialer Netzwerke sei ja, dass es auch Räume abseits des Mainstreams gebe, die etwa «Body Positivity» vermitteln.
Fast jedes zweite Mädchen macht Erfahrungen mit Cybergrooming – dem Online-Versuch Erwachsener, sexuelle Kontakte zu knüpfen.
Yvonne Haldimann
7. Was, wenn mein Kind plötzlich radikale Meinungen entwickelt?
«Extremistische Botschaften, diskriminierende Wertehaltungen oder auch Fake News: Sie wirken vor allem dann problematisch, wenn sich Jugendliche mit diesen Themen im realen sozialen Umfeld nicht auseinandersetzen», sagt Medienpsychologe Daniel Süss.
Eltern sollten entsprechende Inhalte daher immer wieder zur Diskussion bringen und ihren Heranwachsenden früh kritisches Hinterfragen vorleben. Gerade die Frage, was echt ist und was nicht, werde angesichts der sich rasend weiterentwickelnden Möglichkeiten künstlicher Intelligenz noch zentraler, als sie heute schon sei.
8. Dass Fremde mein Kind kontaktieren könnten, macht mir Angst.
Tatsächlich bergen soziale Medien das Risiko für Cybergrooming – Versuche Erwachsener, sich online das Vertrauen von Kindern zu erschleichen, um sexuelle Kontakte zu knüpfen. Der James-Studie 2024 zufolge wurde rund ein Drittel der Jugendlichen schon via Internet von Fremden mit sexuellen Absichten angesprochen.
Betrachtet man nur die Mädchen, sind es 45 Prozent – fast jedes zweite! Um dies zu verhindern, sollten Heranwachsende auf ihren Profilen keine umfangreichen Angaben machen und Standortdienste ausschalten. Auch ist die Kontaktaufnahme durch Fremde soweit möglich ganz zu sperren und das Profil sollte nur für Freunde zugänglich sein.
«Machen Sie Ihrem Kind klar, dass nicht alle Menschen mit guten Absichten im Internet unterwegs sind», sagt Yvonne Haldimann von Jugend und Medien. Und wenn doch etwas passiert ist: «Keine Vorwürfe.» Stattdessen die entsprechende Person blockieren und beim Anbieter melden, Screenshots zur Beweissicherung erstellen – sofern das Material nicht als Kinderpornografie eingestuft werden kann, sonst mache man sich selbst strafbar – und dann zur Polizei gehen.
9. Am liebsten würde ich soziale Medien verbieten!
Der Wunsch mag verständlich sein. Seine Umsetzung kann sich aber mit zunehmendem Alter der Kinder schwieriger gestalten. Verbote können zur Folge haben, dass sich Jugendliche unverstanden fühlen, wie Medienwissenschaftlerin Maya Götz zu bedenken gibt. Sei das Kind das einzige in seinem Umfeld ohne soziale Medien, könne es irgendwann zum Aussenseiter werden, glaubt Medienpsychologe Daniel Süss.
Es sei denn, mehrere Familien sprechen sich ab. So wie dies etwa Bewegungen wie «Smartphonefreie Kindheit» anstreben. Süss gibt allerdings auch zu bedenken, dass sich Medienkompetenz vor allem dann entwickle, wenn Kinder entsprechende Erfahrungen sammeln können. «Das Verhältnis von Grenzen setzen und Freiräume geben muss sorgfältig abgewogen werden.»