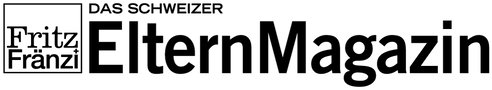«Kinder wollen mitreden können»
Frau Unterweger, Klimawandel, der Angriffskrieg auf die Ukraine oder die daraus resultierende Energiekrise – die schlechten Nachrichten reissen nicht ab. Was macht das mit Eltern und ihren Kindern?
Kinder, jedenfalls bis zum Teenageralter, suchen selten aktiv nach aktuellen Nachrichten und Meldungen. Je nach Relevanz und Mediennutzung dringen diese aber sehr wohl bis zu ihnen durch. Gerade vor solch gesellschaftlich durchdringenden Ereignissen wie dem Krieg gegen die Ukraine gibt es kein Entkommen, weil nicht nur die Medien ständig darüber berichten, sondern auch die Menschen im Alltag diese thematisieren. Wer Angehörige in der Ukraine hat, wird die entsprechenden Nachrichten emotional noch stärker aufnehmen. Ein anhaltendes Ereignis wie die Klimakrise wiederum kann bei vielen Menschen und insbesondere bei Kindern berechtigte Zukunftsängste auslösen.
Inwiefern sollten wir Kinder von negativen Mitteilungen fernhalten?
Zum Teil geht das gar nicht, da diese Themen omnipräsent sind. Aus Sicht der Kindheitsforschung lässt sich sagen, dass Kinder zwar spezifische Verletzbarkeiten aufweisen, dass Eltern jedoch sehr genau abwägen müssen, wovor sie ihre Kinder mit dem Fernhalten schützen möchten. Vielfach wollen Heranwachsende nicht geschützt werden, indem sie von einem Diskurs ausgeschlossen werden, der auch ihr Leben tangiert. Das war ein Ergebnis unserer Untersuchung von Kindern und ihrem Erleben während der Corona-Pandemie.

Inwiefern?
Die meisten Heranwachsenden wollen mitreden und ihre eigenen Wahrnehmungen und Ängste schildern. Deshalb sind aus meiner Sicht Mütter und Väter zunächst diejenigen, die am besten einschätzen können, über welche spezifischen Themen ihre Kinder informiert werden möchten und wie viele Infos sie dazu jeweils bewältigen können. Sie sollten genau auf die Bedürfnisse ihrer Kinder achten. Dabei spielt das Alter eine Rolle – ein siebenjähriges Kind wird in der Regel stärker auf eine elterliche Einordnung von medial vermittelten Nachrichten angewiesen sein als ein zwölfjähriges Kind oder ein Teenager, der sich auch unter seinesgleichen austauscht.
Welche Themen sollten innerhalb der Familie besprochen werden?
Generell plädiere ich dafür, die Heranwachsenden als kompetente Akteure im Umgang mit schwierigen Situationen ernst zu nehmen und sie nicht zu sehr abzuschirmen. Kinder wollen – wie wir Erwachsene – integriert und beteiligt sein, wenn sie sich von einem Ereignis betroffen fühlen, natürlich in einem Mass, das für sie bewältigbar und erträglich ist.
Themen, die sie unmittelbar betreffen, sollen besprochen werden, mit Rücksicht auf das Informationsbedürfnis, das sehr unterschiedlich sein kann. Hier gilt als Faustregel: Je mehr ein Kind sich von einem Ereignis subjektiv betroffen fühlt, desto grösser ist sein Informationsbedürfnis. Dass ein Kind mit einem Informationsgehalt nicht zurechtkommt, lässt sich daran ablesen, dass es sich von einem Thema sofort abwendet oder zeitverzögert eine heftige Reaktion zeigt. Es gibt auch Kinder, die schwierige Themen ganz zu sich nehmen, auffällig stumm werden und sich zurückziehen.
Wie verhalten sich Eltern in solchen Situationen richtig?
Da Nachrichten nicht überfordern sollten, scheint es mir wichtig, Medien zu wählen, die eine sorgfältige Redaktion haben und in denen Kinder auch selbst zu Wort kommen. Je nach Situation kann es trotzdem sinnvoll sein, selbst in die Sendungen reinzuhören oder bei Bedarf nach Inhalten zu suchen, die thematisch für die Familie gerade relevant sind.
Kinder sind in sehr vielen Bereichen kompetente Akteure, die auch ohne die ständige Begleitung durch Erwachsene vieles bewältigen können.
Empfehlenswerte Angebote in der Schweiz sind beispielsweise «Zambo» und «SRF Kids News» des Schweizer Fernsehens oder Kindersendungen auf lokalen Sendern wie Radio Lora. Ob man diese zusammen hört oder schaut, würde ich vor allem davon abhängig machen, ob das Kind eine Begleitung wünscht oder erkennbar begrüsst. Das wird bei Siebenjährigen eher sein als bei Teenagern.
Das sind spezielle Kinderformate. Wie sieht es mit den Nachrichtensendungen für Erwachsene aus?
Wenn es in diesen Nachrichten Bilder gibt, die mein Kind ängstigen – wie beispielsweise Bilder von einschlagenden Raketen –, würde ich diese nicht mit ihm anschauen. Nachrichten kann man heute ebenso auf dem Handy oder Computer verfolgen, wenn die Kinder nicht im Raum sind.
Und wenn ein eher ängstliches Kind bei Freunden aufrüttelnde Nachrichten sieht oder hört, weil dort das Radio ständig läuft?
Wenn ich merke, dass ein Thema wie die Berichterstattung über einen Krieg mein Kind überfordert und es andernorts Informationen dazu hört oder sieht, würde ich das Gespräch suchen. So könnte ich herausfinden, ob es für meine Tochter oder meinen Sohn eine Erleichterung ist, wenn ich stellvertretend dazu etwas sage. Natürlich bewegt man sich hier auf einem schmalen Grat, wenn man, vielleicht aus eigener Ängstlichkeit heraus, dem Kind Überforderung attestiert, obwohl es durchaus mit den Informationen umgehen könnte.
Warum ist das so?
Man nimmt dem Kind die Möglichkeit, die eigene Handlungsfähigkeit im Umgang mit schwierigen Themen zu stärken. Unsere heutigen Normen zur Kindheit stellen die Schutzbedürftigkeit von Kindern sehr stark in den Vordergrund – mit gutem Grund. Die Kindheitsforschung stellt jedoch ebenso heraus, dass Kinder in sehr vielen Bereichen kompetente Akteurinnen und Akteure sind, die auch ohne die ständige Begleitung und Bearbeitung durch Erwachsene vieles bewältigen können.
Wie können Mütter und Väter mit Ohnmachtsgefühlen und der Angst ihrer Kinder umgehen?
Ohnmacht und Angst sind existenzielle Gefühle, mit denen wir alle immer wieder einen Umgang finden müssen. Dabei ist Offenheit zielführender als Tabuisierung. Am Beispiel der Klimakrise könnte man eigene Ohnmachtsgefühle als Eltern thematisieren, aber auch versuchen, aktiv nach Lösungsansätzen zu suchen, auf der politischen wie auch der individuellen Ebene.
Eltern müssen sehr genau abwägen, wovor sie ihr Kind mit dem Fernhalten schützen möchten.
So gibt es beispielsweise in grösseren Wohngenossenschaften häufig Mitmachmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, oder man kann solche einfordern. Gemeinden und Quartiere bieten oft Mitwirkung in Initiativen an, da gibt es Gartenclubs, Umweltdetektive und vieles mehr. Ich erinnere mich, dass in den 1980er-Jahren das Waldsterben ein grosses Thema war. In dieser Zeit wurde das Buch «Umweltschutz – was jeder tun kann» für mich als Jugendliche zu einer Art Bibel, in der ich immer wieder nachschlug. Solche Informationen findet man heute im Internet, unter anderem bei den klassischen Umweltverbänden.
Was sollten Eltern auf jeden Fall unterlassen?
Kinder in ihrer Wahrnehmung und ihren Bedürfnissen nicht ernst nehmen. Das passiert leider schneller, als man denkt, weil Erwachsene oft sehr von den eigenen Angelegenheiten in Anspruch genommen sind. Ich sehe das in meiner eigenen Familie: Meine jüngere Tochter beschäftigt der Klimawandel sehr, und bereits Nachrichten über das aktuelle Wetter, wenn es wieder einmal zu warm und zu trocken ist, lassen sie verzweifeln. Wenn es dann Situationen gibt, in denen ich nur mehr oder weniger schulterzuckend sage: «Ja, das ist ein Problem» und nichts darüber hinaus, trägt das wenig dazu bei, sie in ihrem Gefühl zu unterstützen, dass wir hier gemeinsam Handlungsfähigkeit entwickeln können.
Was würde stattdessen helfen?
Wenn wir eine solche Krise als Anlass nehmen, ein bisschen zu recherchieren: Was gibt es für konkrete Handlungsoptionen? Was nützt dem Klima am meisten? Dann kommen wir auf Antworten. Die können unbequem sein, wie das Einschränken von Flugreisen. Andere – wie die Reduktion des Fleischkonsums oder von Autofahrten – sind für uns als Familie schon länger eingespielte Praxis. Manchmal gibt es auch Sammelaktionen und eine Kindergruppe verkauft im Quartier selbst gebackene Muffins für den Schutz von Eisbären und erwirtschaftet ein paar Franken. Aus der Erwachsenenperspektive hat das mehr symbolischen Charakter, aber es unterstützt die Kinder im Gefühl von «Wir tun etwas».
Altersgerechte Informationen zur Stärkung der Medienkompetenz
Eveline Hipeli: «Ulla aus dem Eulenwald»
www.ulladieeule.ch
Für unterschiedliche Altersgruppen
Peter Holzwarth: Life Skills mit Medien. Projektideen für Selbstbewusstsein und Lebenskompetenzen. Kopaed 2022, 218 Seiten, 28 Fr.
My Zambo
Hier werden die Inhalte nicht von den Redaktorinnen und Redaktoren vorgegeben, sondern zu einem grossen Teil von Kindern der Zambo-Community bestimmt.
SRF Kids News
SRF Kids News sind Nachrichten aus der Schweiz und der ganzen Welt für Kinder verständlich erklärt.
Kindersendungen
Podcasts und Kindersendungen aus aller Welt
www.lora.ch