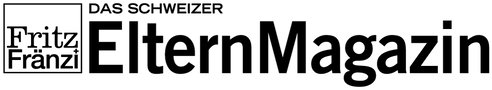Da un orecchio all'altro?
Domenica mattina, da qualche parte in Svizzera. Una madre grida: «No!». Il bambino fa finta di niente. «Se no, allora...», minaccia la madre. Inizia l'escalation di potere dei genitori.
Ordini, minacce, ammonizioni. Urla, lotte di potere, lacrime: ci siamo passati tutti. E ci chiediamo: è necessario?
«Desideriamo il rispetto e soffriamo quando non lo riceviamo».
Esperto di comunicazione René Borbonus
Non deve essere così, dice l'esperto di comunicazione René Borbonus. Dice: «Il rispetto è alla base di relazioni funzionanti. Le persone hanno bisogno di rispetto, soprattutto nelle relazioni genitori-figli. Desideriamo il rispetto e soffriamo quando non lo riceviamo».
Una comunicazione rispettosa significa «vedere» l'altra persona, entrare in empatia con lei.
Rispetto deriva dal latino respicere e significa guardare indietro. «Una comunicazione rispettosa esprime che vediamo l'altra persona e rispettiamo la sua opinione», spiega Borbonus. Se si fa questo, si può anche essere in disaccordo. «Ma il punto è: se sentiamo che la nostra opinione o idea non viene rispettata, sorgono problemi perché la comunicazione non ha successo».
Cinque esempi dalla vita quotidiana
1 Come si affrontano le accuse?
- Situation: «Nie darf ich ... immer muss ich!» (das Kind). «Wie oft muss sich dir noch sagen, dass ... (die Eltern).
- Resultat: Geschrei und Frustration. Niemand will nachgeben.
- Lösung: Zurück auf die Strasse der Sachlichkeit. Sich mit der Frage behelfen: «Worauf beziehst du dich?» «Woran denkst du ganz konkret?»
- Erklärung: Pauschalisierungen sind respektlos. Wir werden bewertet, das bereitet uns Probleme, sofern es kein Lob ist. Mit der Beobachtung passiert das nicht. Hinter jeder Bewertung steckt eine Beobachtung. Diese können wir erfragen und so mehr Ruhe ins Gespräch bringen.
2 Come si comunica in modo rispettoso?
- Situation: Das Kind ist nervös oder ängstlich, weil es anderntags eine Prüfung oder einen Auftritt hat. Es sagt: «Ich will nicht in die Schule!» Eltern antworten: «Ach komm, das ist doch nicht so schlimm, das schaffst du schon.»
- Resultat: Das Kind ist frustriert, fühlt sich nicht ernst genommen. Die Eltern sind genervt.
- Lösung: Empathisch sein, den andern sehen. Sich ins Kind hineindenken, die Angst sehen und sie thematisieren. Zum Beispiel: «Ja, du bist aufgeregt, du hast Angst, den Text zu vergessen, oder es macht dir Sorgen, dass du dich blamieren könntest.»
- Erklärung: Eltern neigen manch mal dazu, unfreiwillig respektlos zu sein, indem sie bagatellisieren und sagen: «Komm, ist doch nicht so schlimm, das schaffst du schon, du hast ja schon ganz andere Sachen geschafft, ein Beinbruch wär jetzt schlimmer.» Das ist gut gemeint, allerdings bedeutet es in Wahrheit: den andern nicht sehen. Wir sehen das Gefühl nicht, wir bagatellisieren es und delegitimieren es zusätzlich. Das Kind fühlt sich nun doppelt schlecht, zum einen, weil es Angst hat, zum andern, weil es sich in dieser Angst falsch wähnt, weil es als Einziges Angst hat, mit diesem Gefühl also offenbar auch nicht richtig liegt.
3. Quali sono le affermazioni da evitare in famiglia?
- Situation: Der Vater ist im Badezimmer und putzt sich die Zähne. Routinemässig überprüft er die Zahnbürste des Sohnes. Sie ist trocken. Er ruft in das Zimmer des Sohnes: «Sag mal, hast du dir die Zähne geputzt?» Das Kind ruft zurück: «Ja, klar.» Der Vater zitiert ihn ins Bad und bringt ihn dazu, die Zähne zu putzen.
- Resultat: Das Kind gehorcht, der Vater hat seine erzieherische Aufgabe erfüllt. Besonders gut fühlen sich aber beide nicht. Denn faktisch hat der Vater seinen Sohn als Lügner entlarvt («Du hast dir deine Zähne ja gar nicht geputzt!»).
- Lösung: «Kind, du hast dir deine Zähne noch nicht geputzt, komm bitte ins Bad, Zähne putzen.»
- Erklärung: Der Vater hat die Konsistenz seines Kindes in Frage gestellt, also auch dessen Glaubwürdigkeit. So entstehen in der Regel keine wirklich guten Gespräche.
4. Stiamo discutendo troppo?
- Situation: Die Mutter fragt das Kind nach der Schule: «Möchtest du nicht lieber zuerst Hausaufgaben machen?» Das Kind antwortet: «Nein.» Nach längerer Diskussion sagt die Mutter: «Du machst zuerst die Hausaufgaben und gehst dann Fussball spielen.»
- Resultat: Das Kind ist verwirrt, die Mutter verärgert.
- Lösung: Sich klar werden, welches Ergebnis man will. Eine klare Aussage machen, ohne Begründung.
- Erklärung: Wir stellen zu viele Fragen. Damit verwirren wir unsere Kinder. Wenn das Kind auf obige Frage mit Nein antwortet und ich seine Entscheidung korrigiere, respektiere ich seine Entscheidung nicht. Mit meiner Frage habe ich streng genommen dem Kind einen Entscheidungsrahmen übergeben, den ich eigentlich gar nicht übergeben wollte, weil ich ja gerne hätte, dass es so entscheidet, wie ich will.
5. dovete giustificare un «no»?
- Situation: Kind: «Papa, ich möchte noch ein Gummibärchen.» Vater: «Nein, du hattest schon welche.» Kind: «Aber nur drei, und die waren alle weiss.»
- Resultat: Der Vater ist ratlos.
- Lösung: Ein Nein nicht begründen, sondern drei Schritte weiterdenken. Sagen: «Ja, Gummibärchen, das wär jetzt toll, würd ich auch gern essen, am liebsten einen ganzen Haufen. Das geht jetzt aber nicht, denn wir essen gleich. Frag mich doch nach dem Abendessen nochmals.»
- Erklärung: Man sollte es vermeiden, ein Nein zu begründen, weil man sich damit auf weitere Diskussionen einlässt, die ärgerlich sein können. Begründet man ein Nein, geht es nur noch um den Grund, nicht um das Nein. Besser: Einen alternativen Impuls setzen und sagen: Frag mich nach dem Essen nochmals. So bleibt die Energie im Spiel. Schlimmstenfalls fragt dann das Kind: Warum nicht? Dann kann man es begründen, muss es aber nicht. Begründet man es aber, ist man da, wo man immer schon war.
Quattro consigli per una buona comunicazione e non solo
René Borbonus su ...
... Scuse:
È uno degli strumenti più potenti della comunicazione. Se ci si scusa in modo corretto, sincero e corretto, le scuse hanno un grande potere. Una buona scusa ha bisogno di tre cose. Primo: il rimorso. Se le scuse sono credibili, ripristinano immediatamente la fiducia. In secondo luogo, l'empatia. Dire che l'accaduto vi ha colpito e che ora siete tristi. Terzo: un piano. Rassicurare in modo credibile che non accadrà più.
... Confronti:
Spesso critichiamo facendo paragoni: «Guarda come Anna ha riordinato bene la sua stanza!». «Nicolas suona così bene il pianoforte, si esercita tutti i giorni». Il risultato che otteniamo con i nostri figli è che odiano a morte Anna o Nicolas.
... domande false:
«Perché la tua giacca è per terra?». La domanda è puramente retorica, perché riguarda qualcos'altro: la giacca dovrebbe essere appesa. Le critiche a rovescio sono fastidiose.
... Requisiti:
«Tutti gli altri sono autorizzati, ma non io». È una questione di emozioni. Quindi dici: «Sì, sarebbe fantastico giocare per dieci ore di fila». E ora sei arrabbiato perché pensi che sia ingiusto. Ma vorrei mostrarti come la vedo io". Poi iniziate le trattative. Ma rimanete inflessibili nell'area che vi sta a cuore.
... conflitti:
I bambini hanno bisogno di conflitti. È estenuante e può anche essere dannoso. Ma credo che sia un errore per i genitori voler evitare il conflitto e l'escalation. Molti genitori si lasciano prendere da questa esigenza di benessere. Dobbiamo ai nostri figli una discussione, anche se poi ci urlano «Ti odio!» o ci chiamano «la peggior mamma o il peggior papà del mondo». Dobbiamo sopportarlo. L'importante è non farsi condizionare. La nebbia ormonale si diraderà.
Come comunicare correttamente: quattro consigli
- Parlare brevemente. Più si parla, più si crea resistenza.
- Un linguaggio semplice. Non usate parole che l'interlocutore non conosce. Soprattutto i bambini spesso non fanno domande perché non vogliono rendersi ridicoli.
- Procedere in modo strutturato. Quindi prima dite il motivo, poi l'obiettivo.
- Rendere udibile la struttura. Quindi, formulate i paragrafi oralmente, come se lo steste facendo per iscritto. Menzionate le tre idee o i tre aspetti, per esempio.
All'autore:
Per saperne di più:
- L'inizio della scuola materna comporta molti cambiamenti per i genitori e per i loro figli. La scienziata dell'educazione Margrit Stamm chiede: «I genitori devono lasciarsi andare di più».
- Nervosi prima del primo giorno? Come far partire bene il vostro bambino nel «Chindsgi»