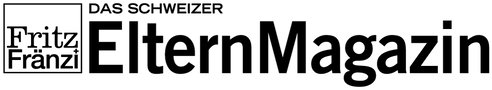Herr Wampfler, machen digitale Medien Schule besser?
* Wir verwenden in diesem Text die männliche, die weibliche und beide Formen im Wechsel, um allen Geschlechtern gerecht zu werden. Wie gefällt Ihnen das? Feedback gerne an redaktion@fritzundfraenzi.ch oder in die Kommentarfunktion.
Herr Wampfler, Sie waren vermutlich einer der ersten Lehrer der Schweiz, die digitale Medien im Unterricht eingesetzt haben. Schon 2012 haben Sie ein Buch über Soziale Medien in der Schule geschrieben. Was war Ihre Motivation?
Wir hatten an unserer Schule eine sehr theoretische Fortbildung zum Thema Soziale Medien mit externen Experten. In der Lehrerschaft hat das eher für mehr Verunsicherung gesorgt. Was zu kurz kam, war die Frage, wie Jugendliche diese Netzwerke nutzen. Da gibt es eine Wissenskluft zwischen Schülern und Lehrpersonen. Kurz darauf bin ich in Weiterbildungsferien gegangen, habe einen Blog zum Thema begonnen, Tagungen besucht und das erste Buch zum Einsatz von Social Media in Schulen geschrieben. Seither werde ich selbst als Experte zu Weiterbildungen in Schulen eingeladen. Wobei ich den Schulen sage: «Ihr könnt die Verantwortung nicht dauerhaft an Externe delegieren.» Die Lehrpersonen und die Schulleitung müssen sich selbst mit den neuen Medien auseinandersetzen.

Machen digitale Medien den Unterricht grundsätzlich besser?
Ein Unterricht ohne den Einsatz von Medien ist gar nicht möglich. Auch die Wandtafel ist ein Medium. Digitale Medien sind einfach zeitgemässe Medien. Ein Unterricht ohne diese wirkt künstlich. Ich brauche die Tafel noch oft – manchmal digitalisiere ich sie. Ich schaue immer, was didaktisch sinnvoll ist
Bei welchen Aufgaben müssen digitale Medien auf jeden Fall aussen vor bleiben?
Zum Beispiel, wenn sich die Schülerinnen und Schüler zusammensetzen, um einen Konflikt zu lösen. Da wäre es problematisch, wenn es digitale Aufzeichnungen geben würde. Oder wenn die Motorik wichtig ist: Was beim von Hand schreiben in der Primarschule passiert, kann mit digitalen Medien nicht gefördert werden.
«Wenn die Schülerinnen souveräner sind als die Lehrperson, verschieben sich die Machtverhältnisse.»
Sind Sie auf Widerstände bei Kolleginnen und Kollegen gestossen, als Sie neue Medien im Unterricht eingesetzt haben?
Im Prinzip war das den anderen egal, was ich im Klassenzimmer gemacht habe. Nach und nach hat aber die Schulleitung gemerkt, dass sie auf den Mediengebrauch der Kinder reagieren muss. Zunächst hat man es mit einem Handyverbot probiert. Das liess sich aber nicht umsetzen. Also wurde umgeschwenkt auf «Bring your own Device»: Die Geräte, die die Jugendlichen ohnehin dabei hatten, sollten im Unterricht genutzt werden. Das hat zu einigen negativen Reaktionen geführt.
Was sind denn die Vorurteile oder Ängste, die im Lehrerkollegium verbreitet sind?
Manche Lehrer an Gymnasien unterrichten ihr Fach noch so, wie sie es im Studium gelernt haben. Gerade in den Sprachwissenschaften heisst das: in Bibliotheken gehen, Bücher suchen und lesen. Dann kommen Schüler und sagen: «Ich finde das aber alles im Netz!» Das kann zu einer Sinnkrise der Lehrperson führen. In einer digitalisierten Welt ändert sich auch deren Rolle. Sie ist nicht mehr die einzige Wissensquelle. Zudem begibt man sich mit den neuen Medien auf ein Feld, auf dem die Schüler souveräner sind. Damit verschieben sich die Machtverhältnisse.
Aber es gibt ja auch jüngere Lehrpersonen, die selbst schon seit Jahren digitale Medien benutzen.
Ja, das ist ein Grund, warum sich die Lage langsam entspannt. Allerdings zeigen auch Untersuchungen, dass die Menschen, die sich für den Lehrerberuf ausbilden lassen, dem Einsatz der digitalen Medien in der Schule generell eher kritisch gegenüberstehen.
Wie kommt das?
Sie haben selbst positive Erfahrungen mit der analogen Schule gemacht und werden Lehrerinnen, um das weiter zu geben. Nicht um etwas zu ändern.
«Wir müssen immer wieder überlegen und begründen, was wir mit digitalen Medien tun. Und das ist gut so.»
Gibt es auch von den Eltern Gegenwind?
Eltern sind eine sehr heterogene Gruppe. Die einen sagen: «Ich kämpfe ja zu Hause schon gegen das Gerät, warum wollt ihr es jetzt auch noch in der Schule einsetzen?» Andere arbeiten selbst mit digitalen Medien und finden die Schule völlig veraltet. Die meisten Eltern aber stehen dem Thema unaufgeregt gegenüber. Ganz anders als noch vor fünf oder zehn Jahren. Sie haben inzwischen eigene Erfahrung mit Smartphones und Computern gesammelt und sich eine Vorstellung davon geschaffen, welche Regeln es im Umgang mit den Geräten geben soll. Trotzdem gibt es natürlich einen Legitimationsdruck, wenn Schulen digitaler werden. Und das ist gut so.
Warum?
Weil wir immer wieder überlegen und begründen müssen, was wir tun. Das tut uns gut, Lehrpersonen sind ja keine Halbgötter.
Wie beeinflussen die Medienregeln aus dem Elternhaus den Unterricht?
Kinder aus einem Elternhaus mit hohem Bildungshintergrund haben oft strenge Regeln und die Kinder bekommen meist auch erst spät ein Smartphone, zum Beispiel mit Übertritt in die Oberstufe. Bei niedrigem Bildungshintergrund wird das Handy hingegen häufig früher gegeben und mit weniger Regeln verbunden, zum Beispiel damit das Kind ruhig ist. Die Kinder, die schon jung, mit sechs oder sieben, ein Handy besitzen, haben also oft keine Mediennutzungsregeln gelernt. Das sehen dann die Lehrpersonen und sagen: «Also bei so jungen Kindern sollte man Handys nicht einsetzen.»
Und wie sehen Sie das? Sollte es schon in der Primarschule Kontakte mit digitalen Medien geben?
Ganz klar ja. Nicht als Ersatz für den Wald und motorische Erlebnisse, aber zusätzlich. Die Primarschule prägt stark unser Verständnis von Schule und Wissensaneignung. Sie ist – bis auf ein paar Vorzeigeprojekte – stark analog geprägt. Dabei lernen Kinder in der Welt ausserhalb der Schule Sprache und Bilder oft digital kennen. Meine Kinder haben das Schreiben an den Tram-Automaten gelernt, wo sie Buchstaben eingegeben haben.
Wie viel digital wäre zu viel?
Es gibt dieses amerikanische Modell, eine echte Schreckensvision: Jeder Schüler ist abgetrennt hinter dem PC und für 100 Schüler hat es vielleicht 3 Lehrpersonen, alles andere regeln speziell auf jeden einzelnen Schüler angepasste Lernprogramme. Und hinter denen steht eine mächtige Industrie. Der wichtigste Aspekt von Schule ist doch der soziale. Man muss hier Beziehungen knüpfen können.
Ihr Schülerinnen und Schüler sind um die 15 Jahre alt und haben alle ein eigenes Smartphone. Wie setzen Sie neue Medien im Unterricht konkret ein?
Nehmen wir als Beispiel den Deutschunterricht: Ich könnte einfach an die Wandtafel schreiben, was «erlebte Rede» ist. Oder ich lasse es die Schülerinnen selber mit dem Smartphone suchen, erstelle ein Google Doc und darin tragen die Schüler verschiedene Informationen zusammen. Anschliessend können sie vergleichen: Was ist eine gute Quelle? Dabei stellen sie fest, dass es verschiedene Definitionen gibt, also keine Einigkeit vorherrscht. Das dauert nicht ewig, vielleicht 10 bis 15 Minuten. Aber ich bin überzeugt davon, dass sie es sich so besser merken können, als wenn ich es ihnen nur erzähle.
Haben Sie noch ein Beispiel?
Alles Organisatorische läuft über einen WhatsApp-Chat. Hier können die Schüler mir Fragen zu den Hausaufgaben stellen und ich weiss, wo sie stehen. Daran kann ich im Unterricht anknüpfen.
Das heisst, Sie als Lehrer müssen 24 Stunden erreichbar sein?
Nein, da muss man eine Kommunikations-Kultur finden. Ich habe feste Zeiten, wo ich bei WhatsApp online bin und Fragen beantworte. Man entwickelt auch eine Filterkompetenz und sieht, auf welche Nachrichten man sofort antworten muss.
Eine Kompetenz, die auch die Schüler erlernen sollten…
Ja klar, darüber sprechen wir im Unterricht. Es gibt unterschiedliche Erwartungen, wie schnell jemand antworten muss. Das kann in Stress ausarten. Vor Prüfungen haben manche meiner Schülerinnen die Strategie entwickelt, den Klassenchat stumm zu schalten. Damit sie sich nicht gegenseitig verrückt machen können.
Müssen Handys in ihren Prüfungen ausgeschaltet bleiben?
Klassische Prüfungen mache ich persönlich nicht. Ich arbeite kompetenzorientiert. Zum Beispiel habe ich gerade Schülerinnen einen Kommentar zu einem Roman schreiben lassen – in Google Docs. Dazu geben dann andere Schüler und ich nach strengen Regeln Feedback. Danach können die Schülerinnen ihren Text fertig schreiben. Wir arbeiten zusammen daran, einen Text zu verbessern. Das wird auch dem heutigen Textverständnis gerecht: Digitale Texte sind nie einfach fertig. Ich möchte, dass die Schüler bei mir so zu arbeiten lernen, wie sie es auch später in der Berufswelt brauchen.
Aber geben sich Schülerinnen und Schüler nicht weniger Mühe mit einem Text, wenn sie wissen, dass es nur eine erste Version ist?
Das würde ich nicht sagen. Bei Aufsätzen hat es schon immer viele Texte gegeben, die eher unüberlegt schienen, und die man besser noch einmal überarbeitet hätte. Der Wille, einen bereits fertigen Text zu verbessern, war hingegen eher noch kleiner.
«Wenn man echtes Interesse zeigt für die Mediennutzung der Jugendlichen, baut sich ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis auf.»
Sind manche Schülerinnen eigentlich neidisch auf Ihren eigenen riesigen Erfolg in den Sozialen Medien?
Nein, das was ich mache ist ja nicht besonders cool. Meine Posts haben ja einen ganz anderen Stil als die von Jugendlichen. Aber sie haben Respekt und finden es spannend. Manchmal nehme ich sie auch mit, wenn ich irgendwo als Experte eingeladen bin und versuche sie so einzubinden – denn auch sie sind Experten – für IHRE Kommunikation.
Ist man als medienaffiner Lehrer automatisch auch Vertrauensperson für die Schüler?
Es ist ein gegenseitiges Vertrauen, dass sich dadurch aufbaut, dass mich wirklich interessiert, wie sie neue Medien nutzen. Ich stelle ihnen Fragen, weil ich vieles nicht verstehe, und so kommt man in einen Dialog.
Lernen die Schüler auch aus Ihren Fehlern bei der Mediennutzung?
Sie fragen mich manchmal, wenn es auf meinen Profilen zu hitzigen Diskussionen kommt: «Was haben Sie da jetzt wieder für einen Stress?». Dann schauen wir das gemeinsam an und ich frage sie: «Wie würden Sie denn jetzt reagieren?» Aber es lässt sich wirklich oft schwer vergleichen, weil Jugendliche zum Beispiel viel zurückhaltender mit öffentlicher Kritik sind.
«Unter Mädchen wird es schon als ein Akt von Aggression gewertet, wenn jemand ein Instagram-Bild nicht liked.»
Das überrascht mich.
Ja, unter Mädchen wird es zum Beispiel schon als Akt von Aggression gewertet, wenn jemand ein Instagram-Bild nicht liked. Dass wir Lehrer dann in den Kommentaren des Klassen-Youtube-Kanals eine Diskussion austragen, finden sie das peinlich. Das sei öffentliches Drama, das solle man doch nicht allen zeigen.
Wird bei Ihnen überhaupt noch auf Papier geschrieben?
Ja. Während der Stunde Notizen machen, funktioniert auf Papier besser. Da gibt es auch viele Studien, die das belegen.
Wie beurteilen Sie das Modul Medien und Informatik im Lehrplan 21?
Gelungen finde ich, dass Anwendungskompetenzen, Reflexionskompetenzen und Informatik zur Sprache kommen. Das Modul schafft eine Verbindlichkeit und ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist keine Revolution. Der Raum, den die neuen Medien einnehmen ist zu klein, und die Medienkompetenz wird zu wenig mit anderen Kompetenzen verwoben. Ich befürchte, dass einzelne Fachlehrer deshalb denken, dass sie selbst ja nichts mehr mit neuen Medien machen müssen.
Wie gut ist die Medienkompetenz der Jugendlichen?
Das hängt von der Perspektive ab. Erwachsene verstehen oft überhaupt nicht, wie komplex die Mediennutzung mit all ihren Kommunikationsregeln bei Jugendlichen ist. Was man alles können und wissen muss. Diese Kompetenz wird von den Erwachsenen nicht gewürdigt. An anderer Stelle sehe ich Handlungsbedarf: Vielen Jugendlichen fällt es schwer, relevante und wahre Informationen zu filtern. Da ist die Schule gefordert, die Jugendlichen aufs Leben vorzubereiten. Wenn man bei Google eine Frage eingibt, findet man immer die Antwort, die man auch hören möchte. Jugendliche sollten wieder lernen, ein Wissensnetzwerk aufzubauen und Fachleute zu fragen, wenn sie unsicher sind. Das war noch nie so einfach, wie heute, über das Internet.
Die digitale Revolution im Klassenzimmer. Unser grosses Dossier im Oktober 2017
Wie digital sind Schweizer Schulen? Was sagen Kinder und Eltern zum Unterricht mit dem Tablet und Co? Wie gehen Lehrpersonen mit den Umbrüchen um? Und wie schützt man die Daten von Schülern, wenn alles digital wird?
Alles darüber in unserem grossen Dossier im Oktoberheft. Bestellen Sie es hier.
Weiterlesen: Wie viel Medien stecken im Lehrplan 21?