Eltern auf Zeit?

Bilder: Gabi Vogt / 13Photo
In der Schweiz leben rund 15 000 Kinder in Pflegefamilien und Heimen. Warum wachsen sie nicht bei Vater und Mutter auf? Und wie fühlt sich das an: Eltern auf Zeit? Eine Spurensuche.
Wann greift der Staat ein?
Der Begriff «Gefährdung» ist in diesem Zusammenhang weit gefasst. In den meisten Fällen finden sich auf Seiten der Eltern mehrere Faktoren, die zusammengenommen eine Krise auslösen können: Überforderung, psychische Labilität, Krankheit, niedriges Bildungsniveau, kein soziales Netzwerk am Wohnort, Trennung vom Partner, von der Partnerin, Verschuldung, Alkohol und Substanzmissbrauch, Kriminalität und so weiter.
Ein Teil der Mütter und Väter hat einen Migrationshintergrund, aber oft genug sind die strauchelnden Eltern auch Schweizer. Im schlimmsten Fall entlädt sich die Wut über das eigene Scheitern am Kind, manchmal muss es auch mit ansehen, wie beispielsweise der Vater die Mutter schlägt. Eine weitere Form der Vernachlässigung liegt vor, wenn das Kind keinen geregelten Tagesablauf hat, wenn es häufig alleine gelassen wird und niemand an seinem Bett sitzt, wenn es krank ist. Vorausgesetzt, da ist überhaupt ein Bett.
Was sind die Folgen?
Manchmal fruchten die Hilfsmassnahmen aber nicht oder nur teilweise. Dann kann es passieren, dass die Behörden zum Schluss kommen, dass es besser ist, ein Kind vorübergehend oder dauerhaft aus der Herkunftsfamilie herauszunehmen. Bis eine solche Fremdunterbringung vorgenommen wird, vergeht Zeit. Nur, wenn Gesundheit und Leben des Kindes akut gefährdet sind, wenn es misshandelt oder missbraucht wird oder wenn es komplett sich selbst überlassen ist, muss es schnell gehen.
Sorge um das Wohl des Kindes
Jedes hundertste Kind in der Schweiz lebt im Heim oder bei einer Pflegefamilie.
Die Gründe liegen auf der Hand: Je jünger ein Mensch ist, desto eher ist er noch in der Lage, sich an weitere Personen zu binden. Ausserdem haben vor allem Kleinkinder ein anderes Zeitgefühl, ein Jahr fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Von Fall zu Fall können ganz unterschiedliche Arrangements sinnvoll sein. Neben der Dauerpflege, bei der das Kind komplett in der neuen Familie lebt, gibt es auch die sogenannte Wochenpflege, bei der es samstags und sonntags in die Herkunftsfamilie zurückkehrt.

Wo finden sich geeignete Pflegefamilien?
Häufig gelingt dies auf Anhieb, vorausgesetzt, der Fachstelle stehen genügend Pflegefamilien zur Verfügung. Die «Ersatzfamilie» kann entweder klassisch aus einem Paar oder nur aus einer Person bestehen. Wer sich für die anspruchsvolle Aufgabe interessiert, muss einen standardisierten Abklärungsprozess durchlaufen, bei dem die zuständigen Sozialarbeitenden prüfen, ob man sich grundsätzlich für ein solches Engagement eignet.
Wenn es zu einem späteren Zeitpunkt um die Vermittlung eines bestimmten Kindes geht, wird die Passung zwischen ihm und einer möglichen Ersatzfamilie nochmals genau geprüft. Das Kind und seine leiblichen Eltern werden – wann immer möglich – in den Auswahlprozess miteinbezogen. Es ist ein schmerzlicher Gedanke, aber Mama und Papa müssen den Entscheid im Interesse ihres Nachwuchses emotional mittragen.
Nur jedes fünfte Pflegekind lernt seine neuen Eltern erst im Verlauf der Vermittlung kennen.
Ein anspruchsvoller Job
Auf die Pflegeeltern wartet ein anspruchsvoller Job: Sie sollen den Kindern einen geregelten Alltag ermöglichen, ihnen Geborgenheit geben und ihr Selbstvertrauen stärken, kurzum, sie müssen für sie sorgen. Auf diese Weise entsteht im Idealfall eine enge Bindung. Die Ersatzeltern müssen aber akzeptieren können, dass die neuen Familienmitglieder mitunter irritierende Verhaltensmuster an den Tag legen.
«In machen Fällen waren schon ganz junge Pflegekinder in ihrer ersten Familie für viele Dinge zuständig: Kleider auswählen, einkaufen, alleine essen, sich unter Umständen um die Eltern und kleineren Geschwister kümmern», erläutert Peter Hausherr. «Und jetzt sollen sie plötzlich wieder ein Kind sein, für das gesorgt wird und an dessen Alltagserlebnissen Anteil genommen wird?» Eine verunsichernde Situation, die auf beiden Seiten grosse Spannungen auslösen kann. Die Ankömmlinge brauchen viel Zeit, um sich an ihre Rollen zu gewöhnen, um zu verstehen, wie die neue Familie «tickt» – und umgekehrt. Viele Mädchen und Buben sind zudem traumatisiert und weisen Entwicklungsrückstände auf.
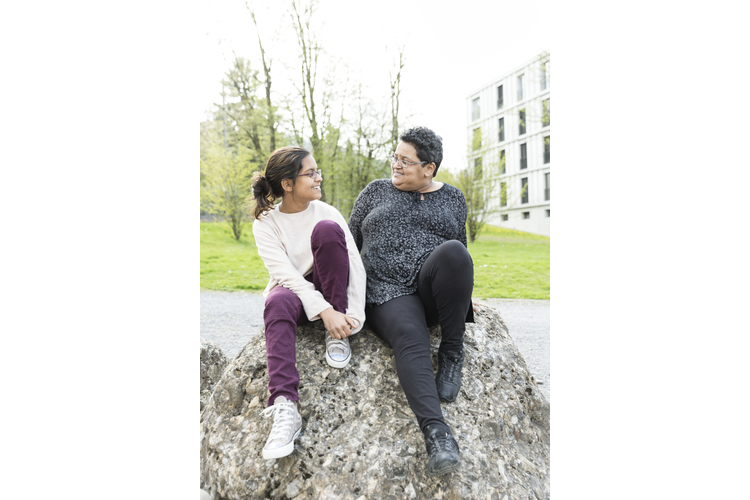
Finanzielle Unterstützung
Selbstverständlich erhalten die Ersatzeltern auch eine finanzielle Unterstützung von den leiblichen Eltern oder – an deren Stelle – von den Städten und Gemeinden, um ihre laufenden Kosten decken zu können. Hinzu kommt noch eine Entschädigung für die geleistete Erziehungsarbeit. Je nach Situation können so bei Dauerpflege auf den Kanton Zürich bezogen zwischen 900 und 2000 Franken pro Monat zusammenkommen.
Ein Pflegekind hat ein Recht darauf, möglichst viel über seine «echten» Eltern zu erfahren.
Wenn sich herausstellt, dass die Treffen die Mädchen und Buben zu sehr belasten, müssen die Zusammenkünfte anders gestaltet oder eingestellt werden. Die Behörden prüfen – gemeinsam mit allen Beteiligten – in regelmässigen Abständen, ob eine Rückkehr des Kindes in seine Herkunftsfamilie möglich ist. Falls nichts dagegenspricht, wird auch dieser Schritt sorgfältig und mit Umsicht geplant.
Das Pflegekind im Zentrum
Die Zürcher Fachstelle Pflegekinder ist ein öffentlicher Dienst. In manchen Fällen genügt es aber nicht, wenn die Sozialarbeitenden nur zu Bürozeiten erreichbar sind. Es gibt komplexe Pflegesituationen, bei denen sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die Pflegeeltern eine besonders engmaschige Unterstützung brauchen, damit die Fremdunterbringung gelingt und die Minderjährigen zur Ruhe kommen können.
Bussola ist eines von verschiedenen Unternehmen im Bereich der Familienpflege, das sich auf genau solche Situationen spezialisiert hat. Der in der Ostschweiz ansässige Anbieter begleitet rund 40 Pflegefamilien im eher ländlichen Raum. «Wir sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar, damit wir bei Krisen oder in Notlagen schnell und flexibel handeln können», erläutert Gabriele Buss, Sozialpädagogin und Mitglied der Geschäftsleitung. Heisst: Wenn sich in einer Herkunftsfamilie eine Situation zuspitzt, kann Bussola – mit dem Mandat der zuständigen Behörden – binnen 24 Stunden einen geeigneten Platz in einer Pflegefamilie bereitstellen. Und wenn es dort zu einer schwierigen Entwicklung kommt, sind die Bussola-Mitarbeiter auch schnell zur Stelle, um Konflikte zu entschärfen.
«Die Fremdunterbringungen sind rückläufig»
Gabriele Buss, Sozialpädagogin
Die Fachfrau begrüsst diese Entwicklung ausdrücklich, zeige sie doch, dass man auf einem guten Weg sei. «Wir sind aber erst dann am Ziel, wenn alle Kinder in ihren Herkunftsfamilien aufwachsen können.»


















