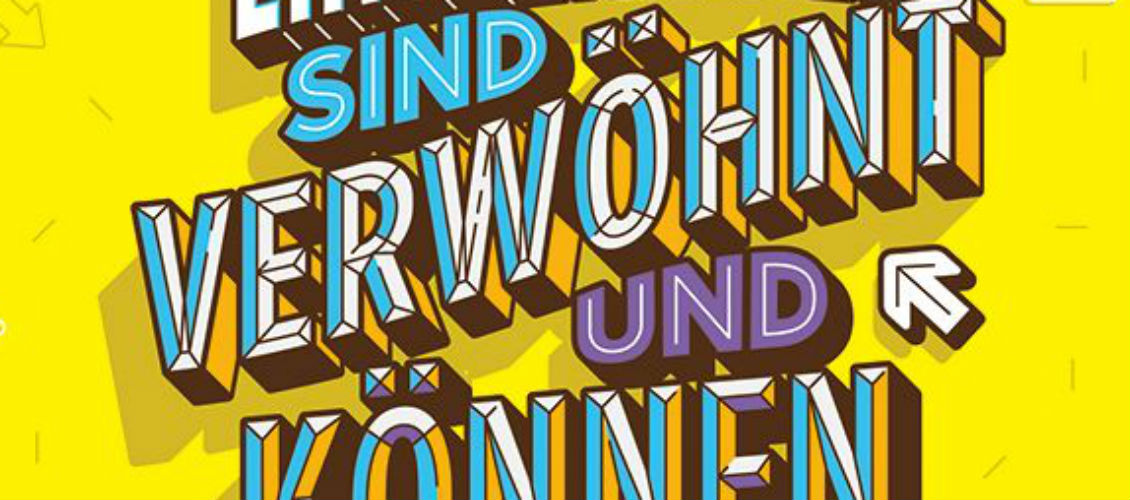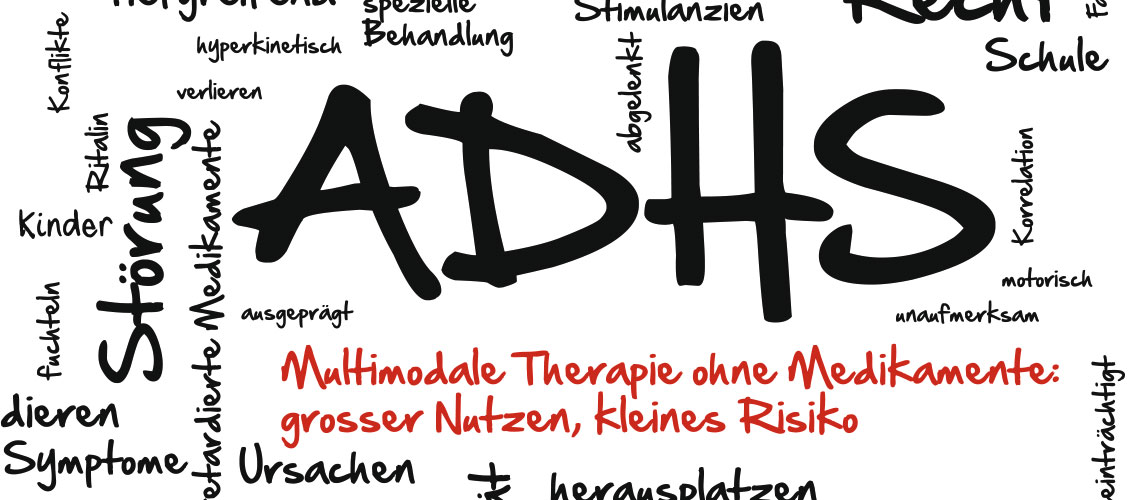Armes Einzelkind?

Geschwister-Mythen: Teil 4
Sie galten lange als egoistisch, selbstbezogen und verwöhnt. Dabei stehen Einzelkinder Kindern mit Geschwistern in Sachen Sozialkompetenz in nichts nach – wenn ihre Eltern einige Punkte
beachten.
Sie wollen stets ihren Kopf durchsetzen und können nicht teilen, so das gängige Vorurteil gegen verhätschelte Einzelkinder. Wer danach sucht, wird wohl auch immer wieder Bestätigung für das Klischee vom geschwisterlosen Tyrannen finden. In der Wissenschaft geht die Idee vor allem auf das Jahr 1896 zurück. Der Pädagoge E. Bohannon von der Clark University in Massachusetts hatte Probanden einen Fragebogen vorgelegt – seinerzeit eine recht neue Form der Datenerhebung – mit Fragen zum Gemüt von beliebigen Einzelkindern, die den Teilnehmern in den Sinn kamen.
In 196 von 200 Fällen beschrieben sie die betreffenden Kinder als «übertrieben verwöhnt». Andere Fachkollegen pflichteten Bohannon bei. Die damals verbreitete Skepsis gegenüber Einzelkindern rührte auch daher, dass Mittelschichtfamilien immer weniger Kinder bekamen und so mancher privilegierte Zeitgenosse die Ausbreitung angeblich unterlegener Bevölkerungsschichten befürchtete.
Im frühen 20. Jahrhundert waren sogar Bedenken verbreitet, das Aufwachsen ohne Geschwister lasse Kinder zu überempfindlichen Mimosen verkümmern. Wenn die Eltern ihre ganzen Sorgen und Ängste auf einen Sprössling konzentrierten, würde dieser irgendwann selbst zum Hypochonder mit schwachem Nervenkostüm.
Einzelkinder entwickeln häufiger fiktive Freunde, mit denen sie sich verbünden und den Alltag teilen. Dies fördert ihre soziale Entwicklung.
Alles Quatsch, sagt die Datenlage im 21. Jahrhundert. Einzelkinder zeigen keine gravierenden Defizite. Toni Falbo, Psychologin an der University of Texas in Austin und selbst Einzelkind, wehrt sich gegen die Vorstellung, man brauche notwendigerweise Geschwister, um zu einem anständigen Menschen heranzuwachsen.
In ihrer Überblicksarbeit von 1986, für die sie mehr als 200 Studien zum Thema in Augenschein genommen hatte, kam sie zum Schluss: Die Wesenszüge von Einzel- und Geschwisterkindern unterscheiden sich nicht. Lediglich die Beziehung zu den Eltern scheint eine besondere zu sein; bei den untersuchten Einzelkindern war sie enger.
Eine besonders gute Beziehung zu den Eltern
Das bestätigt eine Untersuchung von 2018. Sven Stadtmüller und Andreas Klocke von der Frankfurt University of Applied Sciences spürten in Längsschnittdaten von rund 10 00 deutschen Schülerinnen und Schülern den Eigenheiten von Erstgeborenen, Nesthäkchen, Sandwich-Kindern und Geschwisterlosen nach.
Dabei betrachteten sie unter anderem die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung, die sie als sehr gut auffassten, wenn das Kind angab, es falle ihm leicht, sowohl mit seiner Mutter als auch mit seinem Vater über wichtige persönliche Dinge zu sprechen. Einzelkinder bejahten das mit zirka 25 Prozent am häufigsten, dicht gefolgt von den Erstgeborenen mit knapp 24 Prozent.
Unter den mittleren Kindern berichteten 20 Prozent und unter den jüngsten 18 Prozent von einer sehr guten Beziehung zu beiden Eltern. Ein überraschender Befund, sagt man doch Nesthäkchen nach, sie hingen besonders am Rockzipfel der Mama.
Trotz des guten Verhältnisses zu den Eltern bedauern Einzelkinder häufig, ohne Geschwister aufgewachsen zu sein. 2001 baten Lisen Roberts von der Western Carolina University in Cullowhee und Priscilla Blanton von der University of Tennessee in Knoxville geschwisterlose junge Erwachsene, ihre Kindheit rückblickend zu bewerten.

Besonders schade fanden viele, dass sie damals keinen vertrauten Spielkameraden hatten wie andere Kinder mit Geschwistern. Tatsächlich entwickeln Einzelkinder im Vorschulalter auch häufiger fiktive Freunde, mit denen sie sich verbünden und den Alltag teilen.
Grund zur Sorge besteht dabei nicht. Im Gegenteil: Das kreative Spiel mit dem imaginären Gefährten fördert sogar die soziale Entwicklung und die Kommunikationsfähigkeit. Doch es gibt durchaus Hinweise darauf, dass Einzelkinder etwas weniger bereit sind, sich mit anderen zu arrangieren. Neue Erkenntnisse zum Thema kommen aus China, wo die Ein-Kind-Politik 36 Jahre lang die Familienplanung vorschrieb.
Einzelkinder stellten sich als bessere Querdenker heraus. Vor allem in der Kategorie flexibles Denken hatten sie die Nase vorn.
Forscher um den Psychologen Jiang Qiu von der Southwest University in Chongqing untersuchten 126 Studenten ohne Geschwister sowie 177 mit Geschwistern hinsichtlich Denkvermögen und Persönlichkeit. Die Einzelkinder erreichten bei einer Befragung geringere Werte im Wesenszug Verträglichkeit.
Besonders verträgliche Menschen sind gemäss dem Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit altruistisch, hilfsbereit, mitfühlend und kooperativ. Wer wenig verträglich ist, wird häufig als streitbar, misstrauisch und egozentrisch sowie als stärker wettbewerbsorientiert charakterisiert. Zudem mussten die Probanden die «Torrance Tests of Creative Thinking» meistern.
Zum Beispiel sollten sie sich möglichst viele originelle Verwendungsmöglichkeiten für einen Alltagsgegenstand einfallen lassen, etwa eine Blechdose. Einzelkinder stellten sich dabei als bessere Querdenker heraus. Vor allem in der Kategorie flexibles Denken hatten sie die Nase vorn.
Die Autoren erklären das unter anderem damit, dass Menschen ohne Geschwister sich als Kind häufig allein beschäftigen mussten und so notgedrungen früh erfinderisch wurden.
Bessere Vorstellungskraft, schlechtere Gefühlsregulation?
Aber nicht nur das: Ein Test im Kernspintomografen enthüllte sogar Unterschiede in der Hirnstruktur. Im supramarginalen Gyrus, einem Kortexareal, das Forscher mit Kreativität und Vorstellungskraft in Verbindung bringen, fanden sie bei Einzelkindern mehr graue Substanz.
Weniger graue Zellen als bei den Studenten mit Geschwistern entdeckten sie hingegen im Frontalhirn, genauer im medialen präfrontalen Kortex. Dieses Defizit ging einher mit einer geringeren Verträglichkeit. Auch frühere Studien schrieben der Hirnregion bereits wichtige Funktionen bei der Verarbeitung emotionaler Informationen zu – darunter die Fähigkeit, anderen Menschen Gefühle zuzuschreiben sowie die eigenen zu regulieren.
In einer Untersuchung stellten sich Einzelkinder als bessere Querdenker heraus. Vor allem in der Kategorie flexibles Denken lagen sie vorn.
Rainer Riemann, Professor für differenzielle Psychologie an der Universität Bielefeld, rät allerdings dazu, Befunde wie diese immer kritisch zu hinterfragen. «Studien, die Eigenheiten von Einzelkindern oder Geschwistern eines bestimmten Geburtsrangs untersuchen, sind generell mit Vorsicht zu geniessen», gibt er zu bedenken.
«Hier kommt es immer darauf an, auszuschliessen, dass andere Faktoren, die mit dem betrachteten Merkmal verwoben sein könnten, für die Unterschiede verantwortlich sind. Im Fall des Einzelkindes ist das vor allem der sozioökonomische Status der Familie. Gut situierte Eltern neigen dazu, weniger Nachwuchs zu bekommen.»

Da Kinder aus kleinen Familien erwiesenermassen tendenziell intelligenter sind als solche aus grossen, könnte man annehmen, dass Einzelkinder alle anderen im Intellekt übertrumpfen. Doch das ist nur bedingt der Fall.
Zwar überholen sie Menschen, die in der Geburtenfolge später angesiedelt sind – also als zweites, drittes oder viertes Kind zur Welt kamen –, um einige IQ-Punkte. Das Ranking der Schlauköpfe führen aber Erstgeborene mit Geschwistern an.
Diese geniessen eine Zeit lang die volle Aufmerksamkeit der Eltern und fungieren später als Vorbild für die Jüngeren, was ihnen möglicherweise den entscheidenden Vorteil gegenüber Geschwisterlosen verleiht.
Auch Einzelkinder sind nicht von der Umwelt abgeschnitten. Die Kontakte in der Kita bieten ein vielfältiges Trainingsgelände.
Demnach können Erstgeborene ihr intellektuelles Potenzial am besten ausschöpfen, Einzelkinder liegen nur im Mittelfeld. Diesen Tutor-Effekt postulierte in den 1970er-Jahren der renommierte US-amerikanische Sozialpsychologe Robert Zajonc, der an der Stanford University in Kalifornien lehrte und forschte.
Wie viel Einfluss der Effekt heute noch hat, ist fraglich. Dies hängt womöglich davon ab, wie viele Gelegenheiten ein Einzelkind regelmässig bekommt, seine sozialen und kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Schliesslich sind auch Einzelkinder keineswegs von der sozialen Umwelt abgeschnitten. So bieten etwa die Kontakte in der Kita ein vielfältiges zwischenmenschliches Trainingsgelände.
Dieser Artikel erschien zuerst in «Spektrum Psychologie», 1/2019.
- Die Wesenszüge von Einzel- und Geschwisterkindern unterscheiden sich nicht. Lediglich die Beziehung zu den Eltern scheint eine besondere zu sein; bei Einzelkindern ist sie laut einer Studie von 1986 enger.
- Einzelkinder bedauern häufig, ohne Geschwister aufgewachsen zu sein.
- Forscher fanden Hinweise, dass Einzelkinder etwas weniger bereit sind, sich mit anderen zu arrangieren.
- Studien zufolge sind Einzelkinder bessere Querdenker, vor allem in der Kategorie flexibles Denken. Forscher erklären das unter anderem damit, dass sie sich als Kind häufig allein beschäftigen mussten und so notgedrungen früh erfinderisch wurden. In Sachen IQ haben Erstgeborene mit Geschwistern die Nase vorn.
- Studien, die Eigenheiten von Einzelkindern oder Geschwistern eines bestimmten Geburtsrangs untersuchen, sind generell mit Vorsicht zu geniessen, da kleine Familien oft sozial bessergestellt sind als grosse.
- Kontakte in der Kita bieten Einzelkindern ein vielfältiges zwischenmenschliches Trainingsgelände, in dem sie regelmässig die Gelegenheit bekommen, ihre sozialen und kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln.